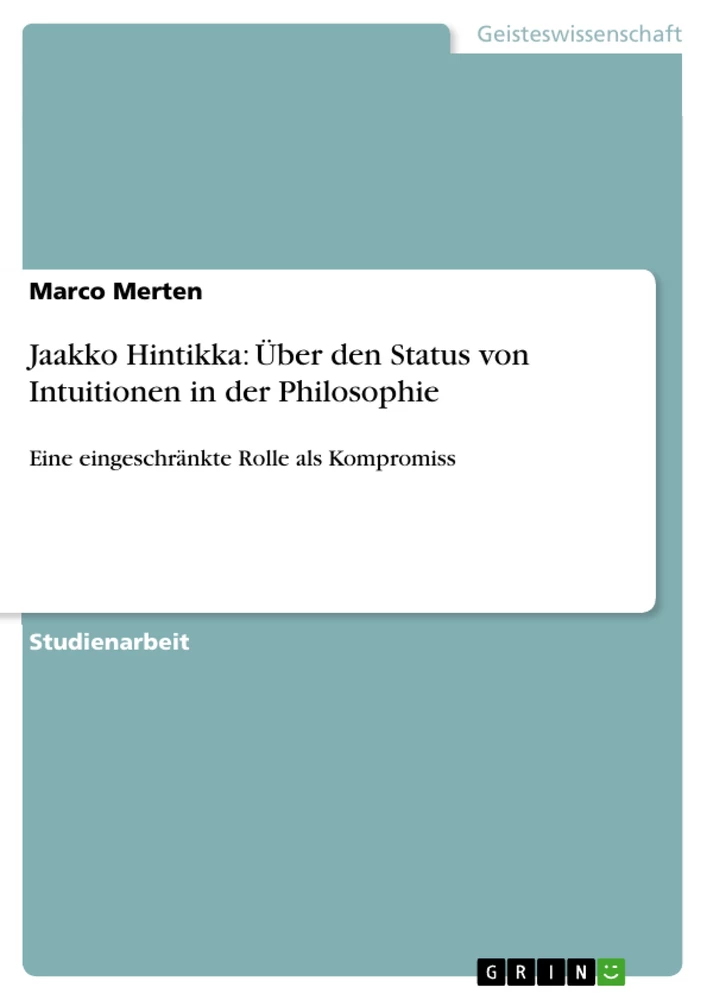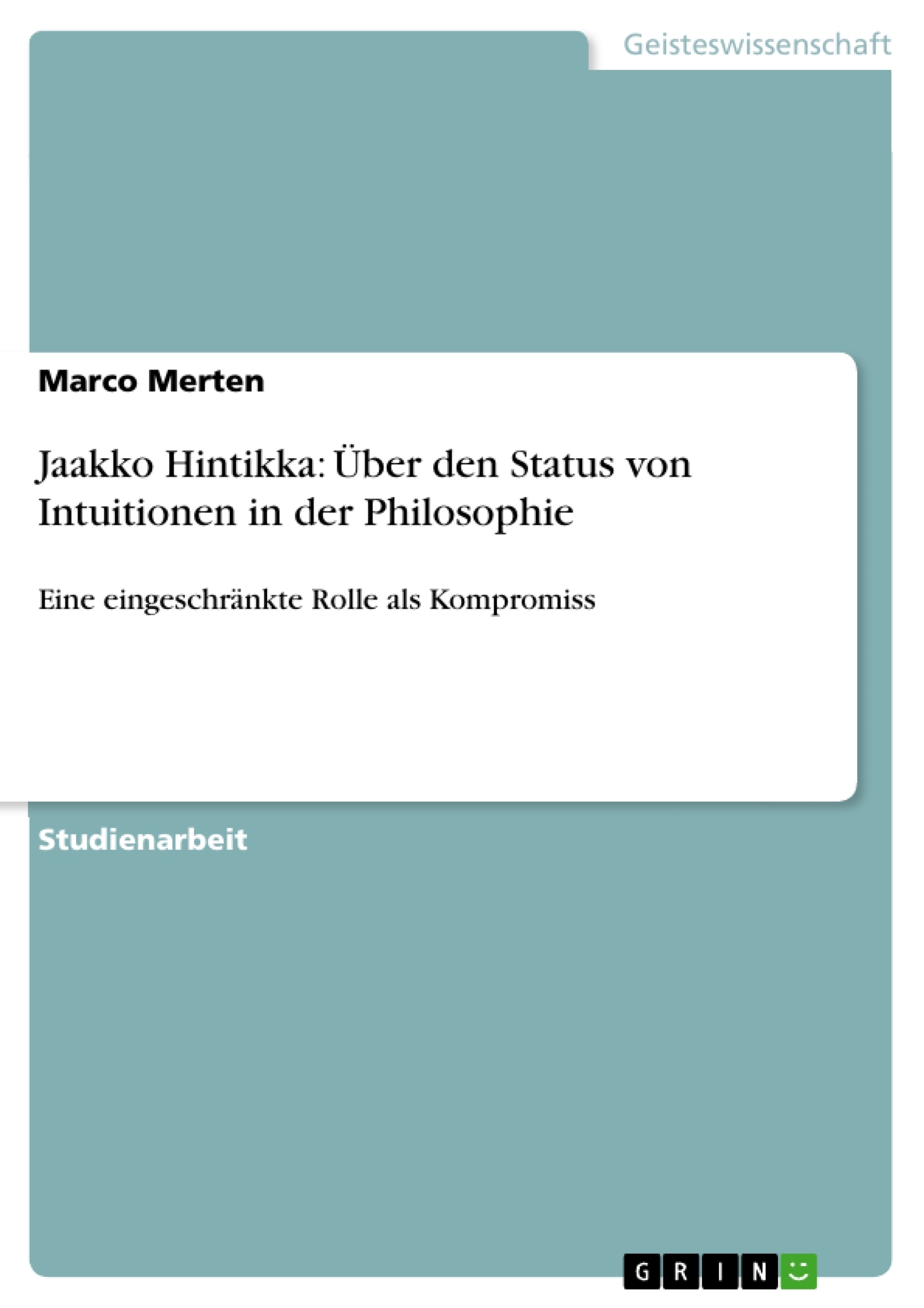Intuitionen sind ein Phänomen, das zweifellos jeder schon einmal erfahren hat und welches sich dabei in ganz alltäglichen Situationen nicht selten bewähren konnte. So sind sie auch tief in der Philosophiegeschichte verankert: Bereits für Aristoteles war das Denken an etwas das authentische Realisieren seiner Form in der eigenen Seele, anhand dessen man durch rein intuitive Erkenntnis alles über diese Form zu erfahren in der Lage war (vgl. Hintikka, 1999, S. 130). Auch Descartes spricht Intuitionen in seinen Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft eine immense Bedeutung zu:
Unter Intuition verstehe ich [...] ein so müheloses und deutlich bestimmtes Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes, daß über das, was wir erkennen, gar kein Zweifel zurückbleibt, oder, was dasselbe ist: eines reinen und aufmerksamen Geistes unbezweifelbares Begreifen, welches allein dem Lichte der Vernunft entspringt, und das [...] zuverlässiger ist als selbst die Deduktion [...] (Descartes, 1972, S. 10)
Allerdings begegnet die heutige Philosophie Intuitionen nicht mehr mit einer solchen Euphorie: Skeptiker beziehen eine intuitionsfeindliche Position und hegen starke Zweifel an ihrer Verlässlichkeit hinsichtlich einer philosophischen Beweisführung. Auch die experimentelle Philosophie zeigt, wie stark Intuitionen zu ein und demselben Sachverhalt variieren können (vgl. Knobe, 2007). Dem gegenüber stehen überzeugte Befürworter, die intuitiver Erkenntnis nach wie vor eine beweiskräftige Rolle zuschreiben.
In der Debatte um den Status von Intuitionen in der Philosophie scheint der finnische Philosoph Jaakko Hintikka eine Kompromisslösung anzubieten: Seiner Ansicht nach sind Intuitionen durchaus dazu in der Lage, als Beweise zu fungieren, doch müssen sie zunächst einmal kritisch analysiert und in miteinander in Beziehung gesetzt werden. Außerdem schränkt Hintikka ihren Wirkungsbereich stark ein: Während man mit Hilfe von Intuitionen viel über Dinge wie die eigenen Konzepte herausfinden kann, haben sie bei Auseinandersetzungen mit empirischen Fragestellungen nichts verloren.
In dieser schriftlichen Hausarbeit soll Hintikkas Ansatz als eine mögliche Kompromisslösung der aktuellen Debatte um den Status von Intuitionen diskutiert werden. Dabei gilt es auch, mögliche Folgen für die Philosophie an sich zu berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Hintikka über den Status von Intuitionen in der Philosophie
2 Intuitionen: Eine kurze Einführung in die Problematik
2.1 VerschiedeneAuffassungenvonlntuitionen
2.2 Intuitionen in der Praxis
2.3 Skeptizismus
3 HintikkaüberdenStatusvonlntuitioneninderPhilosophie
3.1 ÜberdenfalschenUmgangmitlntuitionen
3.2 Intuitionen sind nicht (immer) unbewusst!
3.3 Über den richtigen Umgang mit Intuitionen
3.4 Anwendungsbereiche
4 Hintikkas Ansatz als Kompromiss
4.1 Folgen
4.2 Eine Verwissenschaftlichung der Philosophie als Kompromisslösung?
5 Zusammenfassung und Fazit
6 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Intuitionen in der Philosophie nach Jaakko Hintikka?
Hintikka sieht Intuitionen als potenzielle Beweise, die jedoch kritisch analysiert und auf begriffliche Fragen beschränkt werden müssen.
Können Intuitionen bei empirischen Fragen helfen?
Nein, Hintikka schränkt ihren Bereich stark ein: Bei empirischen Sachverhalten haben Intuitionen laut ihm keine Beweiskraft.
Was versteht Descartes unter Intuition?
Descartes definiert sie als ein müheloses und deutliches Begreifen des Geistes, das zuverlässiger ist als die Deduktion.
Warum wird der Status von Intuitionen heute skeptisch gesehen?
Experimentelle Studien zeigen, dass Intuitionen zu identischen Sachverhalten stark variieren können, was ihre Verlässlichkeit in Frage stellt.
Bietet Hintikka eine Kompromisslösung an?
Ja, sein Ansatz versucht, die Beweiskraft von Intuitionen zu retten, indem er sie methodisch strenger einrahmt und ihren Anwendungsbereich klärt.
- Quote paper
- Marco Merten (Author), 2013, Jaakko Hintikka: Über den Status von Intuitionen in der Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231284