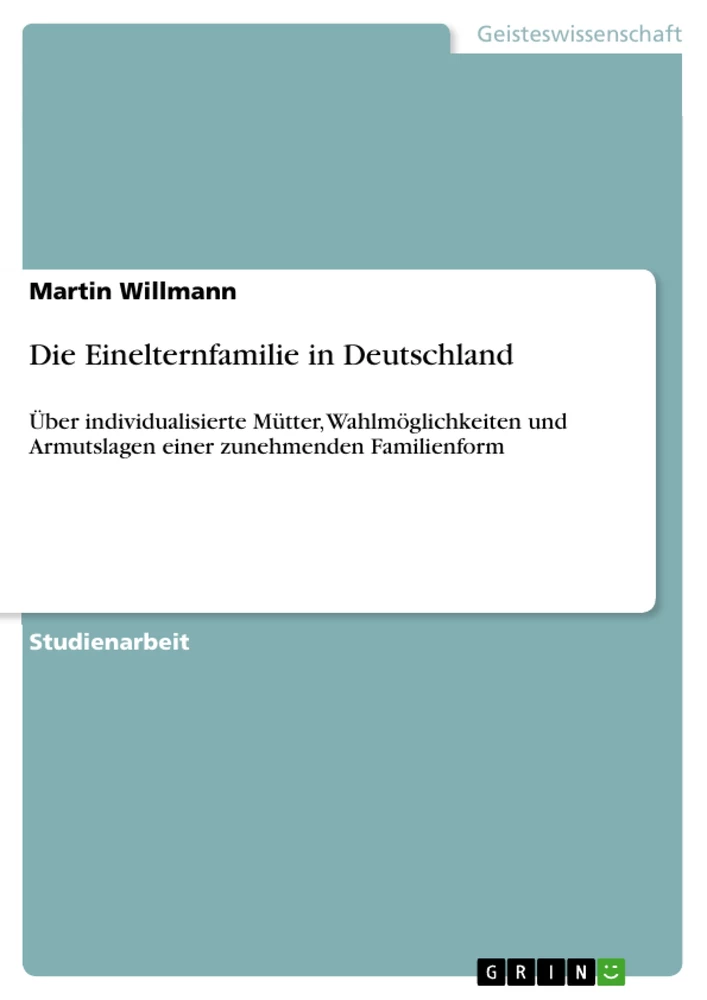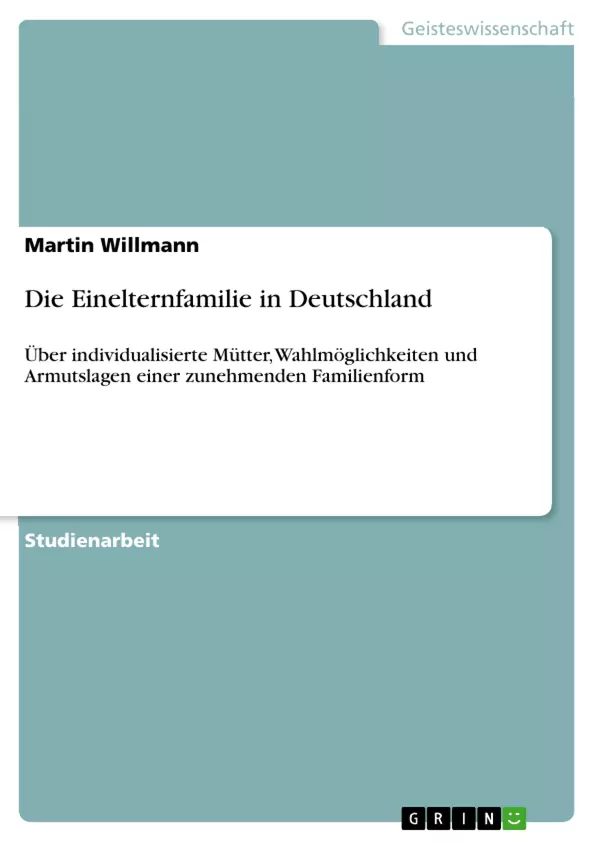Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich im Kontext des familiären Wandels der letzten Jahrzehnte mit dem Thema Einelternfamilien in Deutschland. Dabei wurden zwei Schwerpunkte gelegt: Es wird der Versuch unternommen, deren steigende Anzahl mittels der Kernaussage der Individualisierungstheorie zu erklären. Ferner die häufig mit dieser Familienform in Verbindung gebrachte Armutslage anhand von Einkommen analysiert.
Der Hauptteil beginnt mit einer einleitenden Darstellung der Thematik. Hier wird der gegenwärtige Wandel der Familie skizziert und der vieldeutige Begriff ,Familie’ eingegrenzt, indem er dem Kontext der Arbeit entsprechend präzisiert wird. Im 2. Kapitel geht es um die Erläuterung des Begriffs ,Einelternfamilie’ und die empirische Darstellung dieser Familienform. Das 3. Kapitel hat das Kernstück der Arbeit zum Inhalt und bietet ihren theoretischen Anspruch. An der Stelle wird sich kritisch mit der in Deutschland verbreitetsten Form der Individualisierungsthese nach Beck (1986) auseinandergesetzt. Hierbei wird einerseits deren Kernaussage als Erklärungsansatz mit dem Thema Einelternfamilie verknüpft, andererseits deutliche Grenzen bezüglich der Aussage aufgezeigt. Im 4. Kapitel wird ein Blick in die derzeitige Armutsdiskussion geworfen, um Armut von Einelternfamilien als Paradoxon grob zu erarbeiten. Des Weiteren wird sich vorwiegend auf das Konzept der Einkommensarmut festgelegt, damit ein Armutsaspekt der vielschichtigen Armutslage von Einelternfamilien empirisch belegt und konkretisiert werden kann. Zudem legt das Kapitel wesentliche Probleme der Eltern und Kinder in dieser Lebenslage offen und macht auf entscheidende Herausforderungen der Politik aufmerksam. Anschließend widmet sich das 5. Kapitel einigen Überlegungen zu familienpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung der Lage. Dabei werden verschiedene Betrachtungsweisen dargestellt, die aufzeigen, dass nicht nur alleinerziehende Eltern am sozialen Phänomen ,Einelternfamilie’ teilhaben. Zum Abschluss der Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend formuliert und eine Verbindung der Aufgabenstellung zur Sozialen Arbeit hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Familie: eine gegenwartsbezogene Begriffsklärung
- Einelternfamilien in Deutschland
- Definition: Einelternfamilie/alleinerziehend
- Demografische Eckdaten
- Entstehungszusammenhänge
- Individualisierte Mütter zwischen Selbst- und Fremdbestimmung einer Familienform: ein Erklärungsversuch
- Einelternfamilien in Armutslagen
- Armut: eine paradoxe Betrachtungsweise
- Dynamik von Armut
- Statik von Armut
- Erwerbstätigkeit und relative Einkommensarmut
- Erzieherische und finanzielle Hilfebedürftigkeit
- Ungleiche Lebenschancen für Kinder
- Armut: eine paradoxe Betrachtungsweise
- Überlegungen zur Verbesserung der Lage aus Sicht der Einelternfamilie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Anstieg von Einelternfamilien in Deutschland im Kontext des familiären Wandels. Sie versucht, diesen Anstieg anhand der Individualisierungstheorie zu erklären und analysiert die oft damit verbundene Armutssituation anhand von Einkommensdaten. Die Arbeit konzentriert sich auf die soziologischen und ökonomischen Aspekte dieser Familienform.
- Der Wandel des Familienbegriffs in der Gegenwart
- Die demografischen Entwicklungen von Einelternfamilien in Deutschland
- Die Erklärung des Anstiegs von Einelternfamilien durch Individualisierung
- Armut als Paradoxon in Einelternfamilien
- Familienpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Einelternfamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den Anstieg von Einelternfamilien in Deutschland und deren häufig damit verbundene Armut, indem sie den Wandel des Familienbegriffs beleuchtet und die Individualisierungstheorie als Erklärungsansatz heranzieht. Sie legt den Fokus auf die Analyse von Einkommensarmut und die damit verbundenen Herausforderungen für Eltern und Kinder.
Die Familie: eine gegenwartsbezogene Begriffsklärung: Dieses Kapitel analysiert den Wandel des Familienbegriffs. Es beschreibt, wie das traditionelle Familienbild durch gesellschaftliche Veränderungen wie die Frauen- und Studentenbewegung in Frage gestellt wurde und wie sich die Vorstellung von Familie in Richtung Individualisierung und Pluralisierung entwickelt hat. Die Arbeit argumentiert, dass eine heutige Familiendefinition eine breite Vorstellung von verschiedenen Lebensformen berücksichtigen muss, wobei ein dauerhafter Zusammenhang durch Solidarität und Verbundenheit als Kernmerkmal hervorgehoben wird.
Einelternfamilien in Deutschland: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Einelternfamilie“ und präsentiert relevante demografische Daten. Es wird betont, dass der Begriff „Einelternfamilie“ weniger stigmatisierend ist als ältere Begriffe wie „unvollständige Familie“. Die demografischen Daten zeigen einen stetigen Anstieg der Einelternfamilien in Deutschland, wobei Mutterfamilien deutlich überwiegen. Die Hauptursache für die Entstehung von Einelternfamilien ist die Trennung oder Scheidung der Eltern.
Individualisierte Mütter zwischen Selbst- und Fremdbestimmung einer Familienform: ein Erklärungsversuch: [Kapitelzusammenfassung fehlt im gegebenen Text]
Einelternfamilien in Armutslagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Armut bei Einelternfamilien. Es diskutiert Armut als ein Paradoxon und konzentriert sich auf die Einkommensarmut als einen wichtigen Aspekt. Empirische Daten werden verwendet, um die Armutssituation zu verdeutlichen und die damit verbundenen Probleme für Eltern und Kinder aufzuzeigen. Es werden auch wichtige Herausforderungen für die Politik aufgezeigt.
Überlegungen zur Verbesserung der Lage aus Sicht der Einelternfamilie: [Kapitelzusammenfassung fehlt im gegebenen Text]
Schlüsselwörter
Einelternfamilien, Individualisierung, Armut, Familienwandel, Deutschland, Demografie, Einkommensarmut, Familienpolitik, Soziale Arbeit, Individualisierungsthese, Alleinerziehende.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einelternfamilien in Deutschland: Sozioökonomische Aspekte und Herausforderungen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Anstieg von Einelternfamilien in Deutschland und die damit oft verbundene Armut. Sie analysiert den Wandel des Familienbegriffs, erklärt den Anstieg der Einelternfamilien anhand der Individualisierungstheorie und beleuchtet die sozioökonomischen Aspekte dieser Familienform.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Wandel des Familienbegriffs, demografische Entwicklungen von Einelternfamilien in Deutschland, die Erklärung des Anstiegs von Einelternfamilien durch Individualisierung, Armut als Paradoxon in Einelternfamilien, und familienpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Einelternfamilien.
Wie wird der Begriff "Einelternfamilie" definiert?
Der Begriff "Einelternfamilie" wird als weniger stigmatisierend als ältere Begriffe wie "unvollständige Familie" betrachtet. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer breiten Definition, die verschiedene Lebensformen berücksichtigt, wobei ein dauerhafter Zusammenhang durch Solidarität und Verbundenheit als Kernmerkmal hervorgehoben wird.
Welche demografischen Daten werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Daten, die einen stetigen Anstieg von Einelternfamilien in Deutschland zeigen, wobei Mutterfamilien deutlich überwiegen. Die Trennung oder Scheidung der Eltern wird als Hauptursache für die Entstehung von Einelternfamilien genannt.
Wie wird der Anstieg von Einelternfamilien erklärt?
Der Anstieg von Einelternfamilien wird im Kontext des familiären Wandels und unter Verwendung der Individualisierungstheorie erklärt. Die Arbeit argumentiert, dass gesellschaftliche Veränderungen wie die Frauen- und Studentenbewegung das traditionelle Familienbild in Frage gestellt und zu einer Individualisierung und Pluralisierung der Familienformen geführt haben.
Welche Rolle spielt Armut in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die häufige Armutssituation von Einelternfamilien. Armut wird als Paradoxon betrachtet und die Einkommensarmut als wichtiger Aspekt analysiert. Empirische Daten verdeutlichen die Armutssituation und die damit verbundenen Probleme für Eltern und Kinder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Einleitung, Begriffsklärung des Familienbegriffs, Einelternfamilien in Deutschland (inkl. Demografie und Entstehungszusammenhänge), individualisierte Mütter und Selbst-/Fremdbestimmung, Einelternfamilien in Armutslagen (inkl. Dynamik und Statik von Armut, Erwerbstätigkeit und Einkommensarmut, erzieherische und finanzielle Hilfebedürftigkeit sowie ungleiche Lebenschancen für Kinder) und Überlegungen zur Verbesserung der Lage aus Sicht der Einelternfamilie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einelternfamilien, Individualisierung, Armut, Familienwandel, Deutschland, Demografie, Einkommensarmut, Familienpolitik, Soziale Arbeit, Individualisierungsthese, Alleinerziehende.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Herausforderungen auf, die mit dem Anstieg von Einelternfamilien und der damit verbundenen Armut einhergehen. Sie betont die Notwendigkeit von familienpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Einelternfamilien und ihren Kindern.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Martin Willmann (Autor:in), 2011, Die Einelternfamilie in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231320