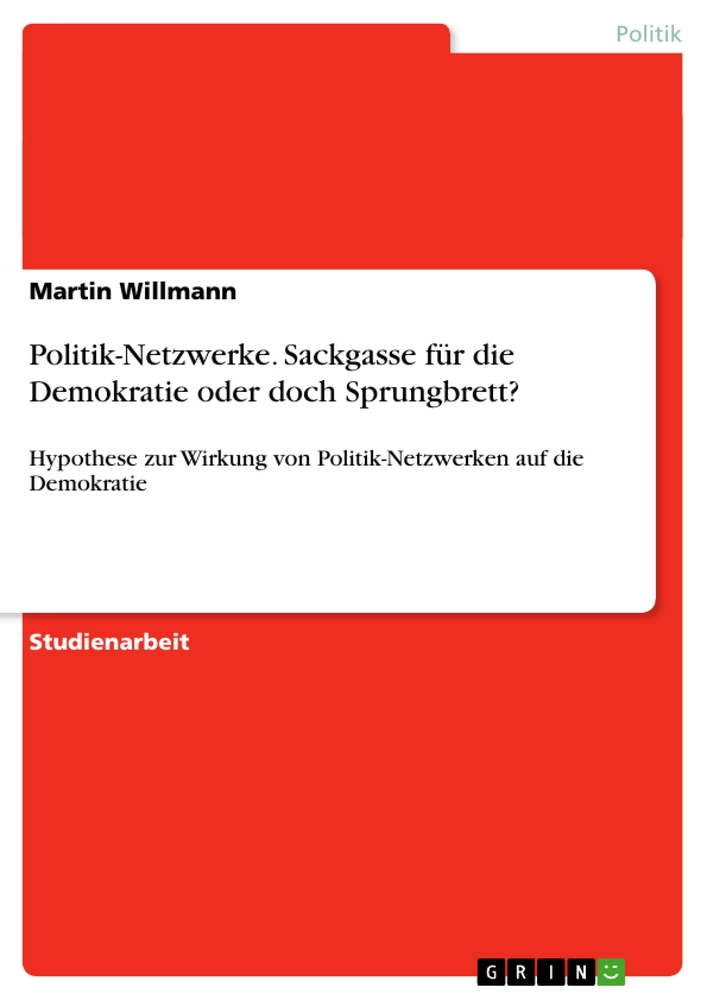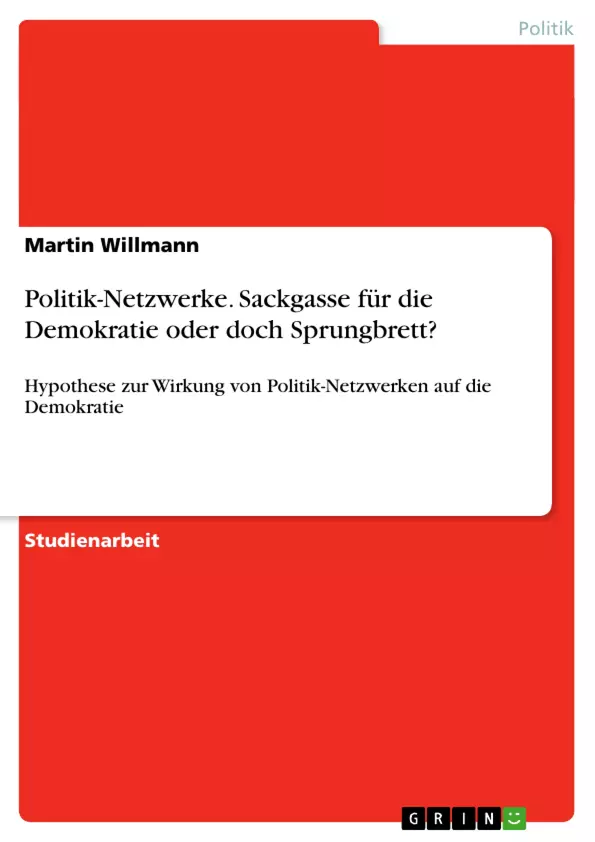Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich vordergründig mit der Frage, welche mögliche Wirkung das Aufkommen von Politik-Netzwerken auf die Demokratie verbreiten könnte? Bei der Bearbeitung dieser Frage ist überwiegend das politische Netzwerk Gegenstand der Untersuchung und weniger die Demokratie, denn sicherlich verlangt die Frage nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem diffusen Begriff der Demokratie, Macht und vor allem auch mit dem Foucault´schen Konzept der Gouvernementalität. Deshalb liegt das Ziel der Arbeit nicht in einer detaillierten Darstellung der aktuellen Diskussion über Demokratie, vielmehr ist die Arbeit darauf abgesteckt, aus dem sozialen und politischen Netzwerkgedanken heraus Argumente bezüglich der Fragestellung zu diskutieren, um abschließend – auch durch die persönliche Reflexion des Seminarinhalts – einen eigenen Standpunkt in Form einer Hypothese hervorzuheben. Um dieses Ziel zu erreichen, basiert die methodische Herangehensweise, die dieser Arbeit zugrunde liegt, sowohl auf einer umfangreichen Recherche einschlägiger Fachliteratur als auch auf dem wissenschaftlich getreuen Arbeitsethos kritischer Literaturverarbeitung. Bevor das Kernstück der Seminararbeit beginnt, vorab eine Darstellung für den Einstieg in das facettenreiche Netzwerkthema.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Weit und breit wohin man sieht: Netzwerke
2. Politik-Netzwerke: Sackgasse für die Demokratie - oder doch Sprungbrett?
2.1 Entstehungsthese der politischen Netzwerkperspektive
2.2 Politik-Netzwerke als Zugang zu den politischen Arenen
2.2.1 Sackgasse für die Demokratie
2.2.2 Sprungbrett für die Demokratie
3. Schluss und Ergebnis
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich vordergründig mit der Frage, wel- che mögliche Wirkung das Aufkommen von Politik-Netzwerken auf die Demo- kratie verbreiten könnte? Bei der Bearbeitung dieser Frage ist überwiegend das politische Netzwerk Gegenstand der Untersuchung und weniger die Demokratie, denn sicherlich verlangt die Frage nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem diffusen Begriff der Demokratie, Macht und vor allem auch mit dem Foucault´schen Konzept der Gouvernementalität. Deshalb liegt das Ziel der Arbeit nicht in einer detaillierten Darstellung der aktuellen Diskussion über Demokratie, vielmehr ist die Arbeit darauf abgesteckt, aus dem sozialen und politischen Netz- werkgedanken heraus Argumente bezüglich der Fragestellung zu diskutieren, um abschließend - auch durch die persönliche Reflexion des Seminarinhalts - einen eigenen Standpunkt in Form einer Hypothese hervorzuheben. Um dieses Ziel zu erreichen, basiert die methodische Herangehensweise, die dieser Arbeit zugrunde liegt, sowohl auf einer umfangreichen Recherche einschlägiger Fachliteratur als auch auf dem wissenschaftlich getreuen Arbeitsethos kritischer Literaturverarbei- tung. Bevor das Kernstück der Seminararbeit beginnt, vorab eine Darstellung für den Einstieg in das facettenreiche Netzwerkthema.
1. Weit und breit wohin man sieht: Netzwerke
Netzwerke scheinen gegenwärtig überall zu sein. Es lässt sich beobachten, dass der Begriff ,Netzwerk’ in vielfacher Weise Verwendung findet. Deshalb ist dem Begriff offenbar eine Omnipräsenz zuzuschreiben. Denn im Verlauf der letzten Jahrzehnte nimmt er mittlerweile in öffentlichen Diskursen und gleich mehreren Wissenschaften eine prominente Position ein (vgl. Fischbach 2005: 7). Netzwerke als Formel zur Beschreibung von Technologien, Organisationen, virtuellen Räu- men, Sozialbeziehungen, Protestbewegungen, Schleuserbanden und terror- istischen Vereinigungen haben sich fest in das Vokabular etabliert. Und mehr noch: Vernetzung ist geradezu zum Inbegriff einer modernen Gesellschaft avan- ciert (vgl. Kaufmann 2004: 182ff.). Folgerichtig trifft Castells (2001) den Nerv der Zeit, indem der Autor im momentanen soziologischen Gesellschaftsdiskurs den „Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“ diagnostiziert. Auch Straus (2002: 3) formuliert etwas radikaler: „Früher dachte man die Erde sei eine Scheibe, dann eine Kugel, heute scheint sie ein Netz(-werk) zu werden.“
Das Netzwerk als neuartiger Ausdruck des menschlichen Zusammenle- bens? Gewiss ist der Mensch schon seit jeher auf ein Beziehungsgeflecht mit an- deren Menschen angewiesen und meidet Vereinzelung, was überhaupt als Grund- konstante der Menschheitsgeschichte verstanden werden kann. Aus Sicht von Berger und Luckmann (2010: 54) ist das „spezifisch Menschliche des Menschen und sein gesellschaftliches Sein […] untrennbar verschränkt. Homo sapiens ist immer und im gleichen Maßstab auch Homo socius “. Doch spätestens seitdem das Internet die technologischen Möglichkeiten globaler Vernetzung revolutioniert hat, ist der Eindruck zu gewinnen, dass etwas Neues und Vielseitiges in sowie aus Netzwerken entsteht (vgl. Holzer 2006: 5f.). Teubner (1992: 208/189) illustriert Netzwerke mystisch als „vielköpfige Hydra“ oder beschreibt sie auch als „kollek- tive Akteure höherer Ordnung“, weil vernetzte Arrangements vielfältige Formen annehmen können und zur Erfüllung unterschiedlichster Aufgaben dienen. Viel- leicht lässt sich auf subjektiver Ebene mittlerweile selbst der Descartes`sche Grundsatz cogito ergo sum wie folgt anpassen: „Ich bin vernetzt, also bin ich“, so schildert zumindest Rifkin (2010: 408).
Aufgrund des linguistischen Booms, der scheinbar universellen Einsetz- barkeit und des relativ jungen Einzugs in die Wissenschaft könnte man in puncto Netzwerk mit den Worten von Fontane (2005: 141) resignierend argumentieren: Netzwerke - „das ist ein zu weites Feld“, kontextuell besser gesagt ein riesiges Netz von Literatur, studentischen Gedanken und Ideen zum Thema. Oder aber man versucht den inzwischen „inflationierte[n] Netzbegriff“ (Fischbach 2005: 14) insofern von allen unwissenschaftlichen Verwendungsweisen und irreführenden Assoziationen abzugrenzen, als dass man sozusagen das eigene Revier von deren Spuren säubert, um ein Netzwerk auf die eigene methodische Herangehensweise hin zu bestimmen (vgl. Keupp 1987: 12f.). Solch ein Reduktionsversuch ist im Rahmen dieser Arbeit unternommen, indem ein Netzwerk aus dem Blickwinkel der Graphentheorie rein formal „als eine abgegrenzte Menge von Knoten oder Elementen [(Akteuren); M.W.] und der Menge der zwischen ihnen verlaufenden sogenannten Kanten [(Beziehungen); M.W.]“ (Jansen 2003: 58) bestimmt ist. Auch Pappi (1993: 85) entwirrt den Netzwerkbegriff in das analytisch Wesentli- che und definiert Netzwerke „als eine durch Beziehungen eines bestimmten Typs verbundene Menge von Einheiten.“ Trotz allem, es bleibt der Interpretationsraum und das Dilemma der Allgegenwärtigkeit: Netzwerk, wohin man auch sieht. Wie zu vermuten ist, entstehen und bestehen Netzwerkstrukturen aus Vielem, also gewiss auch im Bezugsrahmen der Politik oder Politikwissenschaft.
2. Politik-Netzwerke: Sackgasse für die Demokratie - oder doch Sprungbrett?
2.1 Entstehungsthese der politischen Netzwerkperspektive
„Können Sie mir sagen, wo Sie diese Engel finden wollen, die die unsere Gesell- schaft planen sollen?“ Diese Frage, die Friedman (1979) in einem Interview auf- wirft, mag vielleicht etwas überspitzt dazu nutzen, zumindest eine Ausgangsthese zur Entstehung von Politik-Netzwerken zu beleuchten. Sie enthält diesbezüglich aber einen wichtigen Kerngedanken, denn die Frage konfrontiert eindringlich mit der komplexer werdenden Aufgabe, eine moderne Gesellschaft, die makro- perspektivisch funktional differenziert erscheint, Regieren, Führen oder Steuern zu können.
Noch bis in die 1970er Jahre hinein herrschte eine stereotypische Vorstel- lung, die eine strikte Trennung von einem Staat als zentrale autoritäre Institution und der Gesellschaft vorsah. Erst mit dem Aufkommen tiefgreifender Wand- lungsprozesse der Gesellschaftsstruktur und dadurch bedingten Grenzen und Bar- rieren staatlicher Regierungs- und Steuerungsfähigkeit, änderte sich diese Art der Staatsvorstellung und ebenso die Politikproduktion. Heute entsteht Politik häufig weniger einseitig in einem Prozess aus mehreren Phasen an dem eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Kollektivakteuren aus unterschiedlichen Gesellschafts- bereichen teilhaben, was folglich der Netzwerkperspektive einen Weg in die Poli- tik und die Politikwissenschaft ebnete (vgl. Mayntz 1996: 471ff.). Dies zeigt auch ein Blick auf die analytischen Methoden der politischen Netzwerkforschung, denn sie sind nach Héritier (1993: 9) dazu konzipiert, „der Unordentlichkeit des politi- schen Alltags und dem verschränkten Handeln staatlicher und privater Akteure Rechnung zu tragen“.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind Politik-Netzwerke?
Politik-Netzwerke sind Zusammenschlüsse von staatlichen und privaten Akteuren, die gemeinsam an der Gestaltung und Umsetzung politischer Entscheidungen arbeiten.
Sind Netzwerke eine Gefahr für die Demokratie?
Kritiker sehen sie als „Sackgasse“, da sie Entscheidungsprozesse in informelle, weniger transparente Räume verlagern könnten, die sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen.
Können Netzwerke die Demokratie auch fördern?
Befürworter sehen sie als „Sprungbrett“, da sie Expertenwissen einbinden, die Flexibilität erhöhen und eine breitere Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen ermöglichen.
Was meint Manuel Castells mit der „Netzwerkgesellschaft“?
Castells diagnostiziert, dass die moderne Gesellschaft zunehmend durch globale, technologisch gestützte Netzwerke strukturiert wird, was traditionelle Hierarchien ablöst.
Welche Rolle spielt das Internet für politische Netzwerke?
Das Internet hat die technologischen Möglichkeiten der Vernetzung revolutioniert, wodurch globale Kommunikation und Koordination in Echtzeit möglich geworden sind.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Martin Willmann (Author), 2011, Politik-Netzwerke. Sackgasse für die Demokratie oder doch Sprungbrett?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231322