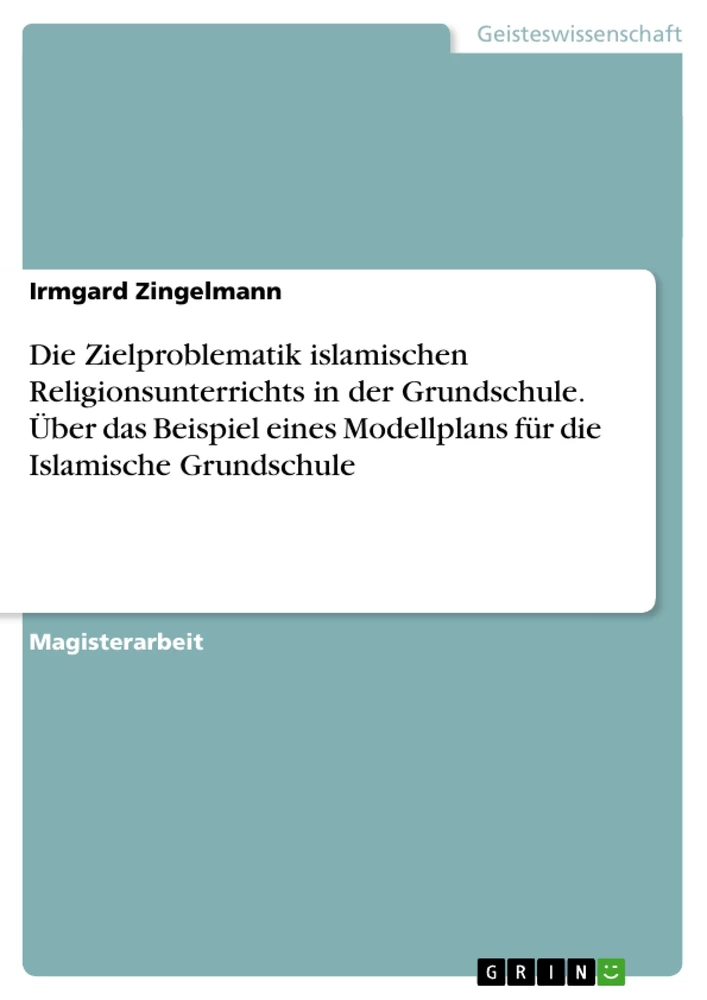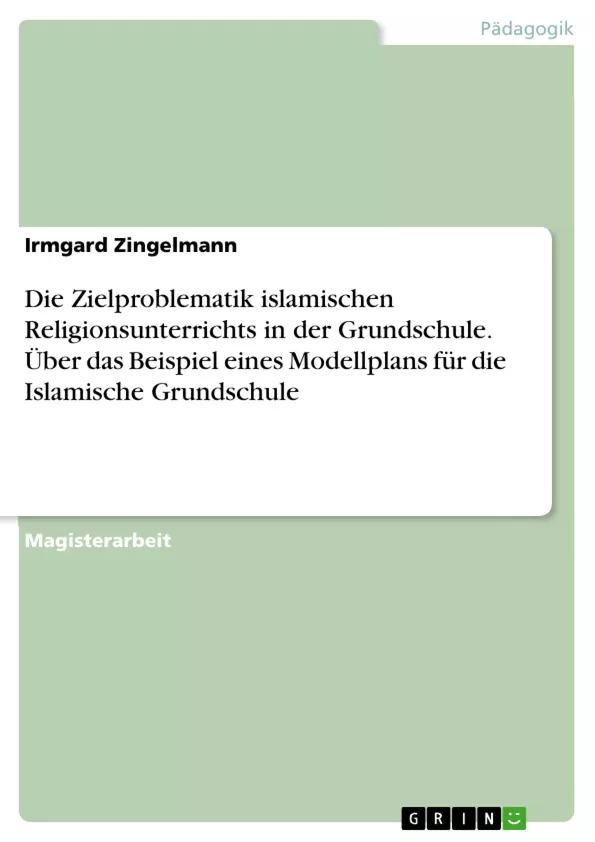Zur Zeit leben über zweieinhalb Millionen Muslime in der Bundesrepublik Deutschland.
Das Gros stammt aus der Türkei und aus Bosnien, ein geringerer Teil aus arabischen Ländern, dem Kosovo-(Albanien) sowie aus Staaten des mittleren Ostens, 100.000 Muslime sind deutsche Konvertiten.
Die Etablierung des Islam als heute drittgrößter Religionsgemeinschaft neben den beiden christlichen Konfessionen begann mit den Anwerbevereinbarungen in den sechziger Jahren, die zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs von der Regierung der Bundesrepublik nach Italien, Spanien und Griechenland am 31. Oktober 1961 auch mit der Türkei abgeschlossen wurden. Obwohl die Anzahl der Muslime ein Jahr später um 130% angestiegen war, partizipierten sie zu dieser Zeit und auch viele Jahre später nur am Rande an der deutschen Gesellschaft und lebten meist isoliert zwischen Arbeitsplatz und Wohnheim. Ihre Intention war es damals, nach einem zeitlich begrenzten Arbeitsaufenthalt in ihrer Heimat eine Existenz zu gründen. In den folgenden zehn Jahren änderten die muslimischen Arbeitsmigranten diese Zielsetzung.
Im November 1973 erließ die Bundesregierung einen Anwerbestopp für Ausländer.
Daraufhin reduzierte sich die Anzahl der Griechen und der Spanier, die der Türken stieg im gleichen Zeitraum an, weil sich viele auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland einrichteten und ihre Familien nachkommen ließen. Damit fand der Islam nach und nach Eingang in die deutsche Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Islam in Deutschland
- Islamische Unterweisung im europäischen Vergleich Deutschland - Österreich
- Formen der islamischen Unterweisung in Berlin
- Islamische Grundschule
- Psychologische, soziologische, sprachwissenschaftliche und methodische Voraussetzungen des Islamischen Religionsunterrichts
- Curriculum-Theorien
- Entwicklungstheorien
- Sprachwissenschaftliche Implikationen
- Religionsdidaktik
- Islamische Religionsdidaktik
- Abendländische Religionsdidaktik
- Eigene Intentionen eines Lehrplans für den IRU
- Zur Entscheidungsfindung der unter Punkt 2 gestellten Problematik: Die Kommission zur Erarbeitung von Lehrplänen des IRU
- Mitglieder der Kommission
- Befragung der KommissionsteilnehmerInnen
- Zur Vorgehensweise der Kommission
- Zur Arbeitsweise der Kommission: Sachanalyse, Didaktische Reduktion, Planung der Unterrichtseinheiten
- Schwierigkeiten bei der Kommissionsarbeit
- Der vorläufige Lehrplan für den Islamischen Religionsunterricht
- Die Quellen des Islam: Koran, sunna, Konsens der Gelehrten (igma)
- Zum Koran
- Zur sunna (ahadit)
- Zu den Rechtsschulen (madahib)
- Zum Konsens der Gelehrten (igma)
- Zum islamischen Dogma (`aqida)
- Die Oberbegriffe der Lernziele
- Die immanente Hierarchie der Themen in den Lernzielen und Lerninhalten des Oberbegriffs "Religiöses Wissen" der Klassen 1-6
- ALLAH (t), SEINE Eigenschaften
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Der Islam, die fünf Säulen, die sechs Glaubensartikel
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 1
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 2
- Muhammed (a.s.s.), der letzte Gesandte ALLAHS (t)
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Die Schöpfung, sichtbar und unsichtbar
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 3
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 4
- Koran und sunna, die Quellen des Glaubens
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 5
- Muslime in der Welt, die Vielfältigkeit des Islam
- Islamisch-theologische Begründung des Themas
- Religionsdidaktische Begründung des Themas
- Beispiele aus den Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung von Klasse 6
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Entwicklung eines Lehrplans für islamischen Religionsunterricht an Grundschulen in Deutschland. Sie analysiert die psychologischen, soziologischen, sprachwissenschaftlichen und methodischen Aspekte, die bei der Gestaltung eines solchen Lehrplans berücksichtigt werden müssen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Entstehungsprozesses eines Modellplans und der damit verbundenen Schwierigkeiten.
- Entwicklung eines Lehrplans für islamischen Religionsunterricht an Grundschulen
- Analyse der methodisch-didaktischen Herausforderungen
- Soziologische und psychologische Aspekte des islamischen Religionsunterrichts
- Der Entstehungsprozess eines Modelllehrplans
- Die Rolle von theologischen und pädagogischen Überlegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den Islam in Deutschland als wachsende Religionsgemeinschaft beschreibt und die Notwendigkeit eines angepassten Religionsunterrichts an Grundschulen herausstellt. Sie skizziert die Herausforderungen der Integration muslimischer Kinder in das deutsche Schulsystem und den damit verbundenen Bedarf an entsprechenden Lehrmaterialien.
Psychologische, soziologische, sprachwissenschaftliche und methodische Voraussetzungen des Islamischen Religionsunterrichts: Dieses Kapitel beleuchtet die vielfältigen Faktoren, die die Gestaltung eines effektiven islamischen Religionsunterrichts beeinflussen. Es werden theoretische Grundlagen aus der Curriculum- und Entwicklungspsychologie diskutiert und die sprachlichen sowie methodischen Besonderheiten berücksichtigt. Der Vergleich zwischen islamischer und abendländischer Religionsdidaktik spielt eine wichtige Rolle.
Zur Entscheidungsfindung der unter Punkt 2 gestellten Problematik: Die Kommission zur Erarbeitung von Lehrplänen des IRU: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Lehrplanentwicklung durch eine Expertenkommission. Es werden die Mitglieder der Kommission vorgestellt, deren Arbeitsweise analysiert und die dabei auftretenden Schwierigkeiten erörtert. Die Darstellung gibt Einblicke in die Herausforderungen der Zusammenarbeit und den Kompromissfindungsprozess bei der Lehrplanerstellung.
Der vorläufige Lehrplan für den Islamischen Religionsunterricht: Dieses Kapitel präsentiert den entwickelten Lehrplan, indem es die zentralen Quellen des Islam (Koran, Sunna, Idschma) erläutert und die Lernziele und -inhalte beschreibt. Es fokussiert sich auf die Grundlagen des islamischen Glaubens und die didaktische Aufbereitung für den Religionsunterricht an Grundschulen.
Die immanente Hierarchie der Themen in den Lernzielen und Lerninhalten des Oberbegriffs "Religiöses Wissen" der Klassen 1-6: Dieses Kapitel analysiert die Struktur und den Aufbau des Lehrplans, indem es die Themenhierarchie im Bereich des "Religiösen Wissens" für die Klassen 1-6 detailliert darlegt. Die islamisch-theologische und religionsdidaktische Begründung der einzelnen Themen wird explizit erläutert, und es werden konkrete Beispiele aus den Unterrichtshinweisen für die einzelnen Klassenstufen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Islamischer Religionsunterricht, Grundschule, Lehrplanentwicklung, Religionsdidaktik, Interkulturelle Bildung, Integration, Islam in Deutschland, Theologie, Pädagogik, Kommissionsarbeit, Koran, Sunna, Idschma, Lernziele, Unterrichtsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen zum Lehrplan Islamischer Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Lehrplans für den Islamischen Religionsunterricht (IRU) an deutschen Grundschulen. Sie analysiert die Herausforderungen dieses Prozesses und beleuchtet die psychologischen, soziologischen, sprachwissenschaftlichen und methodischen Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Entstehung eines Modelllehrplans und der damit verbundenen Schwierigkeiten.
Welche Themen werden im Lehrplan behandelt?
Der vorläufige Lehrplan umfasst die grundlegenden Quellen des Islam (Koran, Sunna, Idschma) und zentrale Glaubensgrundlagen. Die Lernziele und -inhalte konzentrieren sich auf Themen wie Allah, die fünf Säulen des Islam, die sechs Glaubensartikel, den Propheten Muhammad, die Schöpfung und die Vielfalt des Islam. Der Lehrplan ist nach Klassenstufen (1-6) gegliedert und enthält detaillierte Hinweise zur Unterrichtsgestaltung.
Welche methodisch-didaktischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die methodisch-didaktischen Herausforderungen beim IRU, berücksichtigt dabei verschiedene Curriculum- und Entwicklungstheorien und vergleicht die islamische mit der abendländischen Religionsdidaktik. Sprachliche Besonderheiten und die Notwendigkeit interkultureller Bildung werden ebenfalls thematisiert.
Wie wurde der Lehrplan entwickelt?
Der Lehrplan entstand in einem Prozess, der von einer Expertenkommission begleitet wurde. Die Arbeit beschreibt die Zusammensetzung der Kommission, deren Arbeitsweise, die auftretenden Schwierigkeiten und den Kompromissfindungsprozess. Die Kommission berücksichtigte sowohl islamisch-theologische als auch religionsdidaktische Aspekte bei der Lehrplanerstellung.
Welche Struktur hat der Lehrplan?
Der Lehrplan ist hierarchisch aufgebaut. Das Kapitel "Die immanente Hierarchie der Themen in den Lernzielen und Lerninhalten des Oberbegriffs 'Religiöses Wissen' der Klassen 1-6" analysiert diesen Aufbau detailliert. Für jede Themeneinheit werden die islamisch-theologische und religionsdidaktische Begründung sowie konkrete Beispiele aus den Unterrichtshinweisen für die einzelnen Klassenstufen vorgestellt.
Welche Rolle spielen soziologische und psychologische Aspekte?
Die Arbeit untersucht die soziologischen und psychologischen Aspekte des Islamischen Religionsunterrichts. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Integration muslimischer Kinder in das deutsche Schulsystem und die Notwendigkeit eines angepassten Religionsunterrichts, der den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht wird.
Welche Quellen wurden für den Lehrplan verwendet?
Der Lehrplan basiert auf den zentralen Quellen des Islam: dem Koran, der Sunna (Überlieferungen des Propheten), dem Konsens der Gelehrten (Idsma) und dem islamischen Dogma (`Aqida).
Wer waren die Mitglieder der Kommission?
Die Arbeit nennt die Mitglieder der Kommission, die den Lehrplan erarbeitet hat, jedoch nicht explizit.
Welche Schwierigkeiten traten bei der Kommissionsarbeit auf?
Die Arbeit beschreibt die Schwierigkeiten bei der Kommissionsarbeit, geht aber nicht im Detail auf die spezifischen Probleme ein.
Für welche Altersgruppe ist der Lehrplan konzipiert?
Der Lehrplan ist für den Islamischen Religionsunterricht an Grundschulen (Klassen 1-6) konzipiert.
- Quote paper
- Irmgard Zingelmann (Author), 1999, Die Zielproblematik islamischen Religionsunterrichts in der Grundschule. Über das Beispiel eines Modellplans für die Islamische Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231403