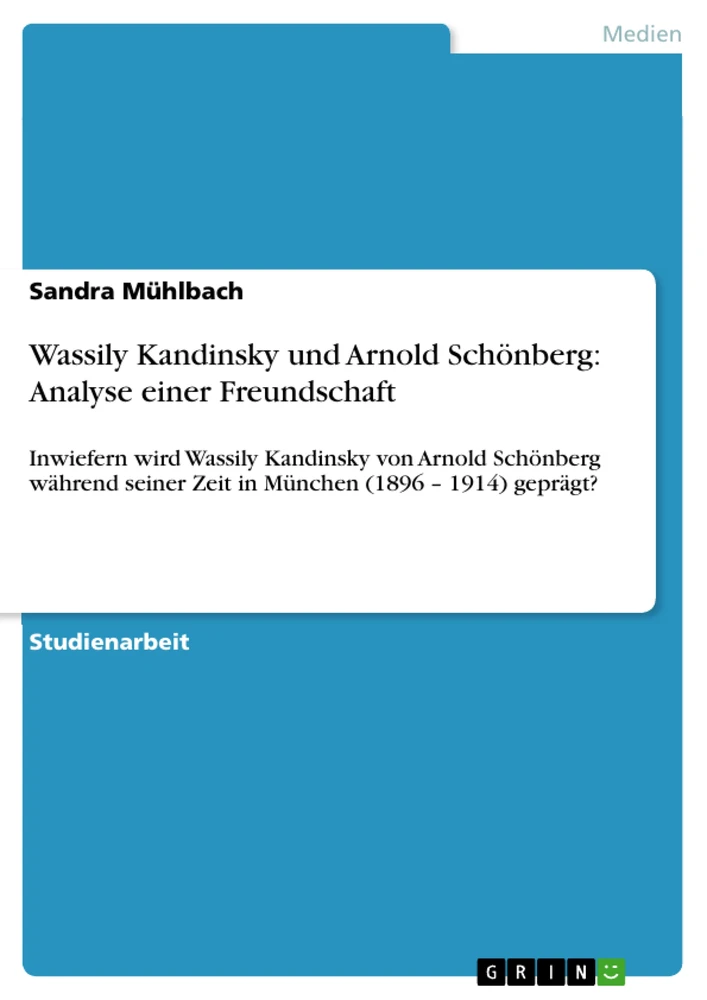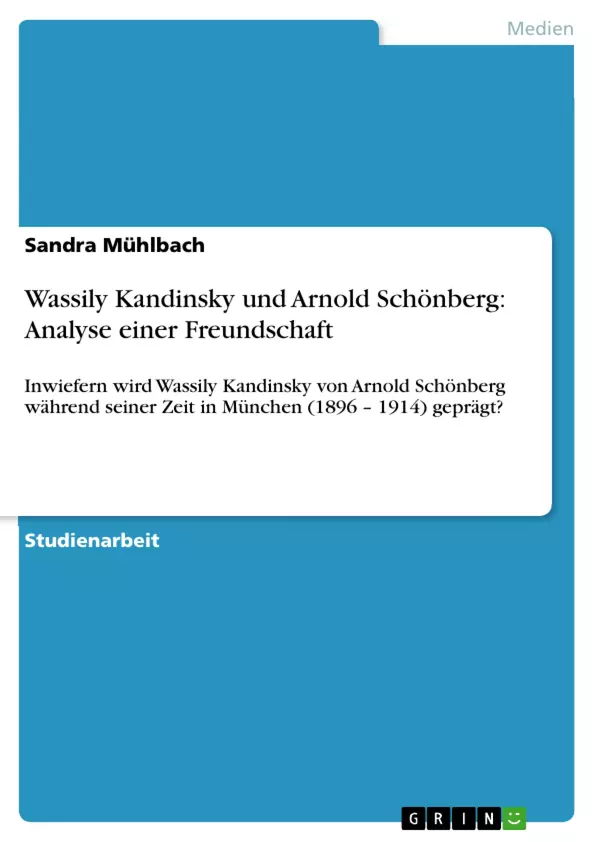Wassily Kandinsky gilt als einer der bekanntesten Vertreter abstrakter Kunst; er entwickelte eine einzigartige Farb- und Formenlehre. Seine Werke inspirierten und bereicherten die europäische und internationale Kunstszene.
Während seines, fast zwei Jahrzehnte wärenden Aufenthaltes in Deutschland freundet er sich mit dem Komponisten Arnold Schönberg an. Beide unterhalten einen regen Briefwechsel, in dem sie sich über ihr gegenseitiges Kunstverständnis austauschen und einander beratend zur Seite stehen. Kandinsky durchläuft in dieser Zeit eine maßgebliche Entwicklung: sein expressiver Malstil wird zunehmend abstrakt. Seine Kunst löst sich vom Gegeständlichen. Schönberg beschreitet seinerseits mit atonale Kompositionen neue Wege. Beide Künstler sind in unterschiedlichen Metiers heimisch und ergänzen sich dennoch. Prägte einer das Kunstverständnis des anderen oder sind die parallelen Entwicklungen als autonom zu betrachten?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einordnung in den historischen Kontext mit Fokussierung auf die Kunstszene in Deutschland und Russland
- Kandinskys erste Berührungen mit der Kunst / Aufbruch nach München
- Wassily Kandinsky und Arnold Schönberg - Analyse einer Freundschaft
- Zusammenfassung und Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung des Künstlers Wassily Kandinsky während seiner Zeit in München (1896-1914) und konzentriert sich insbesondere auf die prägende Begegnung mit dem Komponisten Arnold Schönberg. Ziel ist es, die Einflüsse dieser Freundschaft auf Kandinskys künstlerisches Schaffen zu beleuchten.
- Kandinskys künstlerische Entwicklung von der Gegenwartskunst zum Abstrakten
- Der Einfluss des Expressionismus und des Impressionismus auf Kandinskys Werke
- Die Rolle der Sinneswahrnehmung und der Farblehre in Kandinskys Kunst
- Die Bedeutung von Kandinskys russisch-folkloristischen Motiven
- Die künstlerische und persönliche Beziehung zwischen Kandinsky und Schönberg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt Wassily Kandinsky als einen bedeutenden Vertreter der abstrakten Kunst vor und skizziert seine Lebensgeschichte bis zu seinem Umzug nach München. Die Hausarbeit konzentriert sich auf Kandinskys Zeit in München und seine Beziehung zu Arnold Schönberg.
- Einordnung in den historischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Kunstszene in Europa um die Jahrhundertwende und zeigt die Entstehung des Jugendstils als Gegenentwurf zum Historismus. Der Einfluss des Impressionismus auf die Entwicklung der Malerei wird hervorgehoben.
- Kandinskys erste Berührungen mit der Kunst: Die Kapitel beschreibt Kandinskys künstlerischen Aufbruch nach München und seine Begegnungen mit einflussreichen Künstlern.
- Wassily Kandinsky und Arnold Schönberg - Analyse einer Freundschaft: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Kandinsky und Schönberg und untersucht, wie diese Freundschaft die künstlerischen Entwicklungen beider Künstler beeinflusst hat.
Schlüsselwörter
Abstrakte Kunst, Expressionismus, Impressionismus, Sinneswahrnehmung, Farblehre, russisch-folkloristische Motive, Kandinsky, Schönberg, München, Jahrhundertwende, Kunstgeschichte, künstlerische Entwicklung, Freundschaft, künstlerische Beeinflussung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Arnold Schönberg die Kunst von Wassily Kandinsky?
Die Freundschaft und der Briefwechsel mit dem Komponisten Schönberg bestärkten Kandinsky in seinem Streben nach Abstraktion. Schönbergs atonale Musik fand eine Parallele in Kandinskys Loslösung vom Gegenständlichen in der Malerei.
Was zeichnet Kandinskys Farblehre aus?
Kandinsky entwickelte eine Theorie, die Farben bestimmte emotionale und psychologische Wirkungen sowie synästhetische Eigenschaften (Verbindung von Farbe und Klang) zuschrieb.
Welche Rolle spielte München für Kandinskys künstlerische Entwicklung?
München war zwischen 1896 und 1914 ein Zentrum der Avantgarde. Hier vollzog Kandinsky den entscheidenden Schritt vom Expressionismus hin zur rein abstrakten Kunst.
Inwiefern ergänzten sich Malerei und Musik bei diesen Künstlern?
Beide suchten nach neuen Ausdrucksformen jenseits traditioneller Harmonien (Musik) oder realistischer Darstellung (Malerei). Sie sahen in der "inneren Notwendigkeit" die Basis für ihr Schaffen.
Welchen Einfluss hatte die russische Folklore auf Kandinsky?
Trotz seines Weges zur Abstraktion blieben russisch-folkloristische Motive und eine leuchtende Farbigkeit, die er aus seiner Heimat kannte, ein wichtiges Element in seinem frühen Werk.
- Quote paper
- Sandra Mühlbach (Author), 2013, Wassily Kandinsky und Arnold Schönberg: Analyse einer Freundschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231407