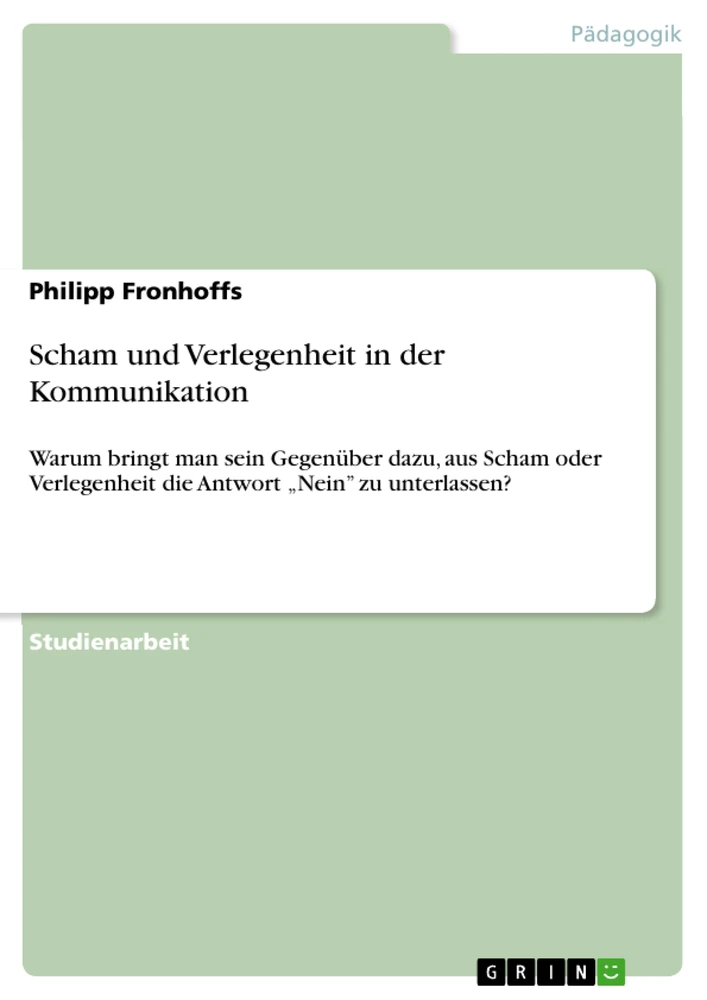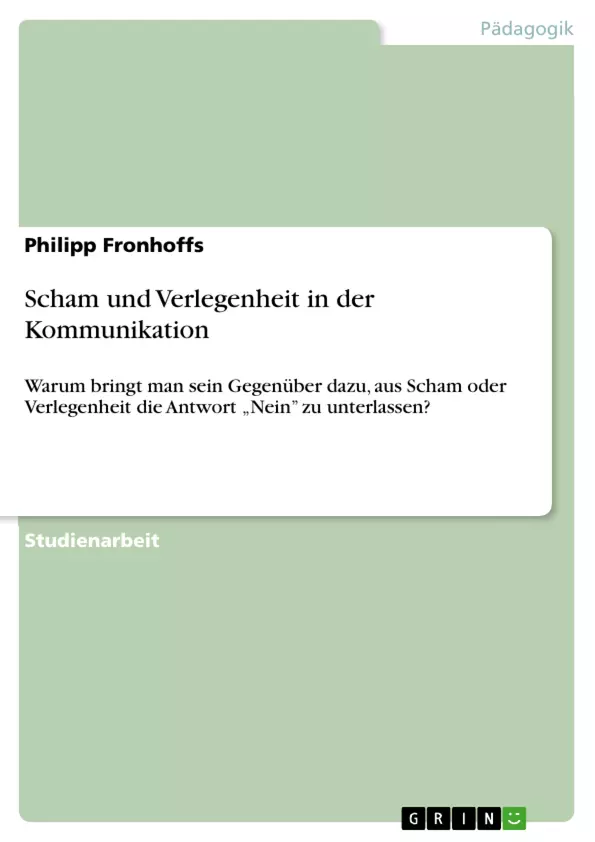Das Gefühl der Scham scheint jedem Menschen bekannt zu sein und ist trotzdem für uns Menschen eine einzigartige Empfindung, die kein anderes Lebewesen in dem Maße spüren kann. Das Schamgefühl überkommt einen, trifft die jeweilige Person tief im Inneren und gilt als Ausgangspunkt für diverse andere Gefühle wie beispielsweise für die Verlegenheit (vgl. Lipps 1941: 31f.). Obwohl das Schamgefühl schwer zu deuten ist und eine Definition erst recht strittig wäre, scheint es bei vielen Menschen eher als unbeliebtes Gefühl eingeordnet zu werden, welches mit dem Wunsch verbunden ist, auf der Stelle zu verschwinden. Die Konnotationen sind meist eher negativ (vgl. Baer/ Frick-Baer 2000: 9ff.). Auf der anderen Seite kann Scham oder Verlegenheit aber auch als Signal oder Warnhinweis verstanden werden, wenn beispielsweise die gewünschte Distanz zwischen zwei Menschen nicht eingehalten wird oder Intimitätsgrenzen verletzt werden (vgl. Hilgers 2013: 20f.).
(...)
Im Weiteren soll im Hauptteil das Phänomen des Wortes „Nein“ vor dem Hintergrund von Scham und Verlegenheit näher betrachtet werden. Warum bringe ich mein Gegenüber dazu, aus Scham nicht „Nein“ sagen zu können oder nur schamhaft bzw. verlegen „Nein“ zu sagen? Warum erzeuge ich generell eine Scham- oder Verlegenheitssituation, die mein Gegenüber als unangenehm empfindet?
Im letzten Teil meiner Arbeit werde ich ein Fazit ziehen, wobei ich zentrale Punkte meiner Analyse nochmals kurz darstelle. Wichtig wird hier vor allem der Feldbegriff des Lernens sein, der von dem Psychologen Kurt Lewin geprägt wurde. Neben vielen anderen wichtigen Aspekten ging es Kurt Lewin auch um den bewussten Widerspruch, die Verneinung und um die Handlungsfreiheit des Menschen. Die Möglichkeit und Fähigkeit, ein „Nein“ hervorzubringen, obwohl bei Befolgung eine positive Verstärkung in Aussicht steht, die Kritikfähigkeit und die Reflexionsfähigkeit von Menschen sind für ihn der Inbegriff von demokratischem Verhalten und Handeln (vgl. Lewin 1982: 174f).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Scham und Verlegenheit
- 3. Scham und Verlegenheit in der Kommunikation
- 3.1. Einfluss und Motive
- 3.2. Das Wort „Nein“
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen von Scham und Verlegenheit, insbesondere im Kontext der zwischenmenschlichen Kommunikation. Es wird analysiert, wie diese Gefühle beeinflusst werden können und welche Rolle sie im Umgang mit dem Wort „Nein“ spielen. Die Arbeit basiert auf den Theorien von Hans Lipps und Guy van Kerckhoven.
- Definition und Abgrenzung von Scham und Verlegenheit
- Einflussfaktoren auf Scham und Verlegenheit in der Kommunikation
- Die Bedeutung des Wortes „Nein“ im Kontext von Scham und Verlegenheit
- Der Zusammenhang zwischen Scham, Verlegenheit und der Handlungsfreiheit des Menschen
- Die Bedeutung von Toleranz, Respekt und Akzeptanz im Umgang mit Verneinungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Scham und Verlegenheit ein und betont deren Einzigartigkeit im menschlichen Erleben. Sie skizziert die Forschungsfragen der Arbeit: die Abgrenzung von Scham und Verlegenheit zu anderen Gefühlen, deren Einfluss in der Kommunikation und die Rolle des Wortes „Nein“. Die Arbeit basiert auf den Theorien von Hans Lipps und Guy van Kerckhoven, wobei eine phänomenologische Perspektive eingenommen wird.
2. Scham und Verlegenheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von Scham und Verlegenheit. Es wird der oft unscharfe Übergang zwischen diesen beiden Gefühlen hervorgehoben und die Möglichkeit von Mischformen aufgezeigt. Hans Lipps’ Konzept der „prohibitiven Scham“, die präventiv auf das Vermeiden von Schamsituationen abzielt, wird erläutert. Das Kapitel betont, dass Scham oft mit dem Wunsch nach Verbergen und dem Schutz der persönlichen Integrität verbunden ist, und dass das Scheitern dieses Schutzes zu dem Gefühl der Scham führt.
3. Scham und Verlegenheit in der Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Scham und Verlegenheit auf die Kommunikation, insbesondere auf die Äußerung des Wortes „Nein“. Es wird analysiert, wie man das Gegenüber bewusst oder unbewusst beeinflussen kann, um ein „Nein“ zu verhindern oder zu modifizieren, und welche Motive dahinter stehen könnten. Der Fokus liegt auf den Mechanismen, durch die Scham- und Verlegenheitssituationen erzeugt werden und wie diese die Kommunikation prägen.
Schlüsselwörter
Scham, Verlegenheit, Kommunikation, „Nein“, zwischenmenschliche Interaktion, Hans Lipps, Guy van Kerckhoven, Handlungsfreiheit, Toleranz, Respekt, Akzeptanz, phänomenologische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Scham und Verlegenheit in der Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen von Scham und Verlegenheit, insbesondere im Kontext der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der Fokus liegt auf der Analyse des Einflusses dieser Gefühle und ihrer Rolle im Umgang mit dem Wort „Nein“. Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Hans Lipps und Guy van Kerckhoven.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit umfasst folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Scham und Verlegenheit, Einflussfaktoren auf Scham und Verlegenheit in der Kommunikation, die Bedeutung des Wortes „Nein“ im Kontext von Scham und Verlegenheit, der Zusammenhang zwischen Scham, Verlegenheit und der Handlungsfreiheit des Menschen sowie die Bedeutung von Toleranz, Respekt und Akzeptanz im Umgang mit Verneinungen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Scham und Verlegenheit (Definition und Abgrenzung), Scham und Verlegenheit in der Kommunikation (inkl. Einflussfaktoren und der Rolle des Wortes „Nein“) und Fazit.
Wie wird Scham und Verlegenheit in der Hausarbeit definiert und abgegrenzt?
Kapitel 2 befasst sich ausführlich mit der Definition und Abgrenzung von Scham und Verlegenheit. Es wird der oft unscharfe Übergang zwischen diesen beiden Gefühlen hervorgehoben und die Möglichkeit von Mischformen aufgezeigt. Hans Lipps’ Konzept der „prohibitiven Scham“ wird erläutert. Die Verbindung von Scham mit dem Wunsch nach Verbergen und dem Schutz der persönlichen Integrität wird betont.
Welche Rolle spielt das Wort „Nein“ in der Hausarbeit?
Das Wort „Nein“ steht im Mittelpunkt von Kapitel 3. Hier wird analysiert, wie Scham und Verlegenheit die Äußerung des Wortes „Nein“ beeinflussen und wie man das Gegenüber bewusst oder unbewusst beeinflussen kann, um ein „Nein“ zu verhindern oder zu modifizieren. Die Motive hinter solchen Strategien werden ebenfalls untersucht.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit basiert auf den Theorien von Hans Lipps und Guy van Kerckhoven und nimmt eine phänomenologische Perspektive ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Scham, Verlegenheit, Kommunikation, „Nein“, zwischenmenschliche Interaktion, Hans Lipps, Guy van Kerckhoven, Handlungsfreiheit, Toleranz, Respekt, Akzeptanz, phänomenologische Perspektive.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, das Phänomen von Scham und Verlegenheit im Kontext der Kommunikation zu untersuchen und deren Einfluss auf zwischenmenschliche Interaktionen zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf die Äußerung von Verneinungen.
- Quote paper
- Philipp Fronhoffs (Author), 2013, Scham und Verlegenheit in der Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231439