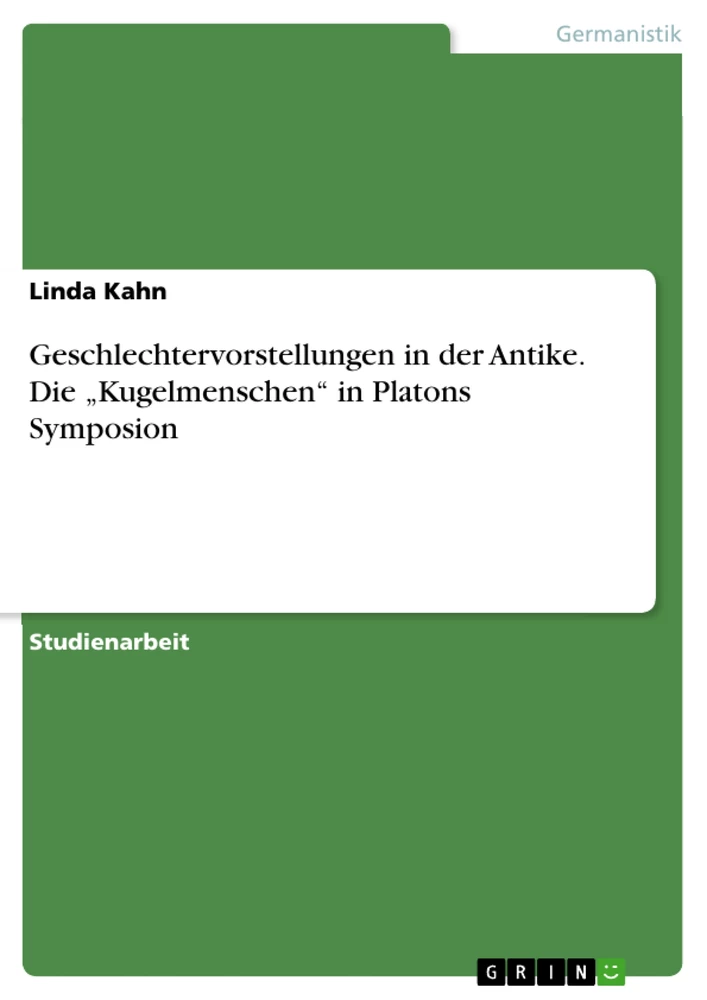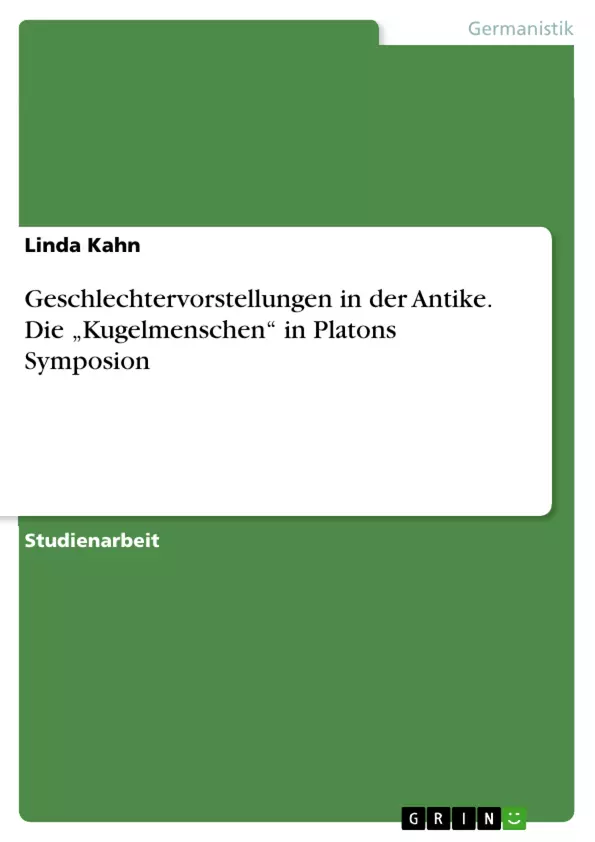Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, gängige Vorstellungen der Antike über Liebe und Geschlecht mit der literarischen Fiktion des „Kugelmenschen“-Mythos in Platons Symposion zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. „Die Antike“: Erläuterung eines problematischen Begriffs
3. Platon: Sein Werk und seine Zeit
3.1. Eine kurze Biographie Platons
3.2. Was ist ein „Symposion“?
3.3. Platons Symposion
3.3.1. Aristophanes
3.3.2. Zwischenüberlegung zur „Ernsthaftigkeit“ der Aristophanes- Rede
3.3.3. Der Kugelmenschenmythos
4. Die Geschlechtervorstellungen
4.1. Die Beziehung zwischen Mann und Frau
4.1.1. bei Aristophanes/Platon
4.1.2. Hintergrund: Ehe & Liebe
4.1.3. Anwendung auf die „Kugelmenschen“
4.2. Die Beziehung zwischen Mann und Knabe
4.2.1. bei Aristophanes/Platon
4.2.2. Hintergrund: Päderastie
4.2.3. Anwendung auf die „Kugelmenschen“
4.3. Die Beziehung zwischen Frau und Frau
4.3.1. bei Aristophanes/Platon
4.3.2. Hintergrund: „Lesbische“ Liebe
4.3.3. Anwendung auf die „Kugelmenschen“
5. Schlussbemerkungen
Glossar
Quellenverzeichnis
- Quote paper
- Linda Kahn (Author), 2011, Geschlechtervorstellungen in der Antike. Die „Kugelmenschen“ in Platons Symposion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231478