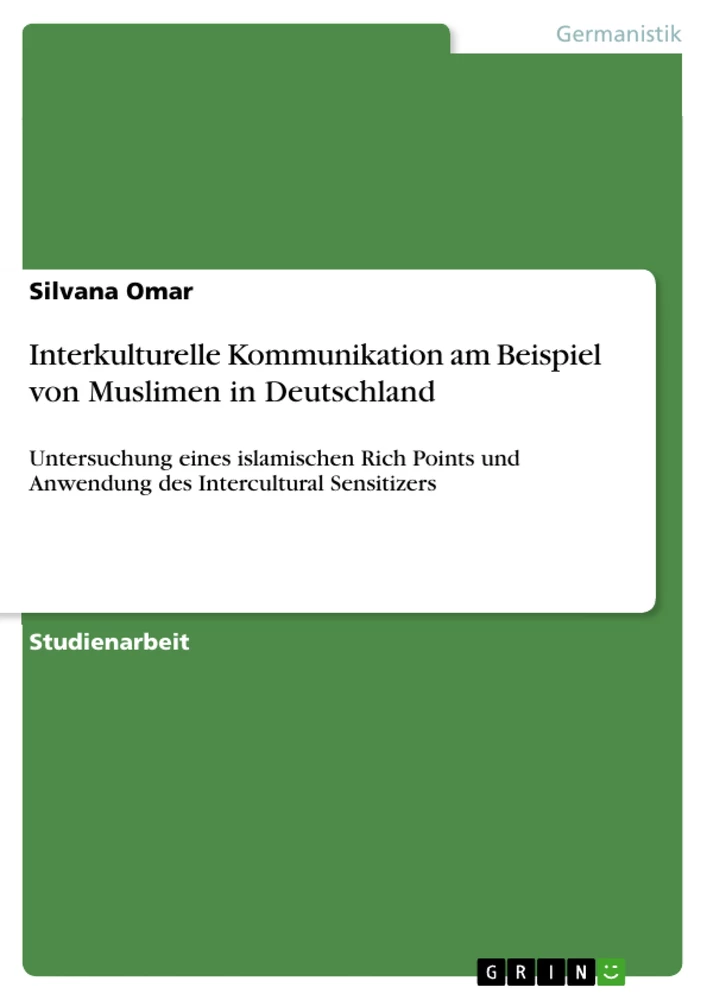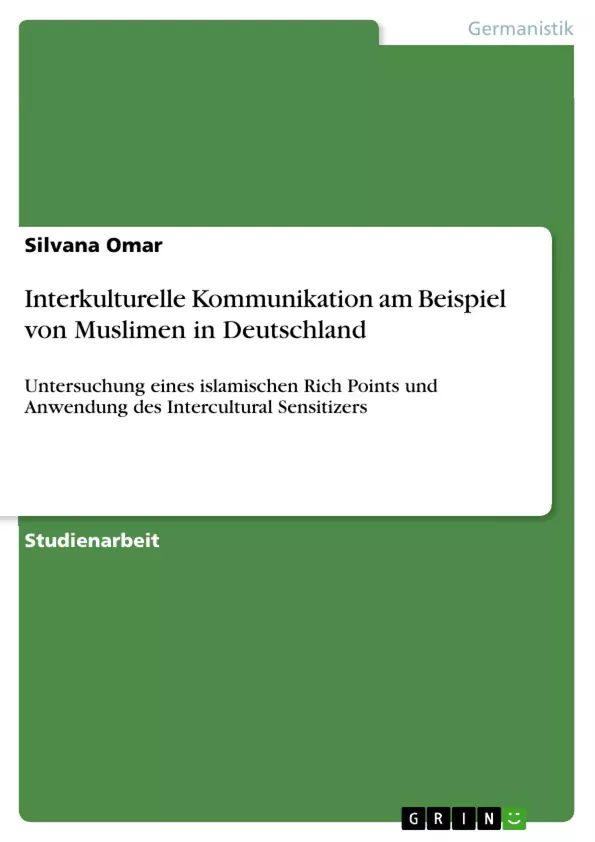Diese Abhandlung versucht sich einem Vergleich ausgewählter Bereiche
islamischer und deutscher Kultur kommunikations- und sprachwissenschaftlich zu nähern.
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
1. Was ist Kultur?
2. Konzepte als Werkzeuge
3. Sensibilisierung als mittelfristiges Ziel
II. Von intra- zu interkulturell
1. Intrakulturell
a) Rich Points
b) širk
c) Fazit
2. Interkulturell
a) Intercultural Sensitizer
b) Critical Incidents & Ergebnisse
c) Feedback
d) Fazit
3. Verknüpfung vorgestellter Konzepte
III. Schlusslicht
1. Zusammenfassung & Ausblick
2. Literaturverzeichnis
IV. Anhang
1. Fragebogen zum Rich Point širk
2. Intercultural Sensitizer
Final del extracto de 39 páginas
- subir
- Citar trabajo
- Silvana Omar (Autor), 2012, Interkulturelle Kommunikation am Beispiel von Muslimen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231480
Leer eBook