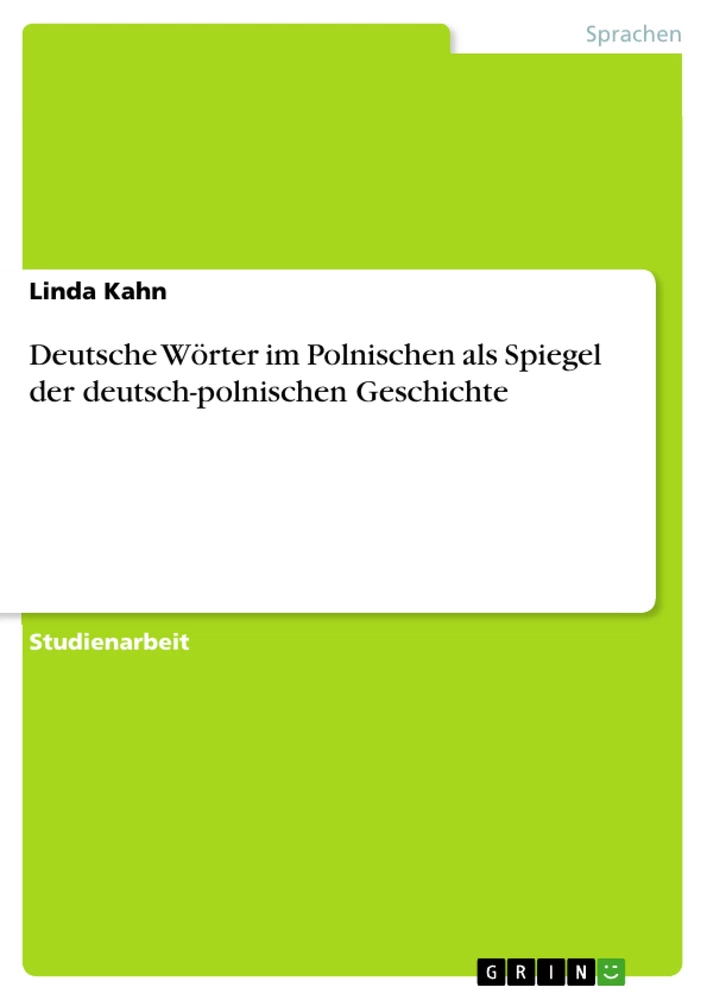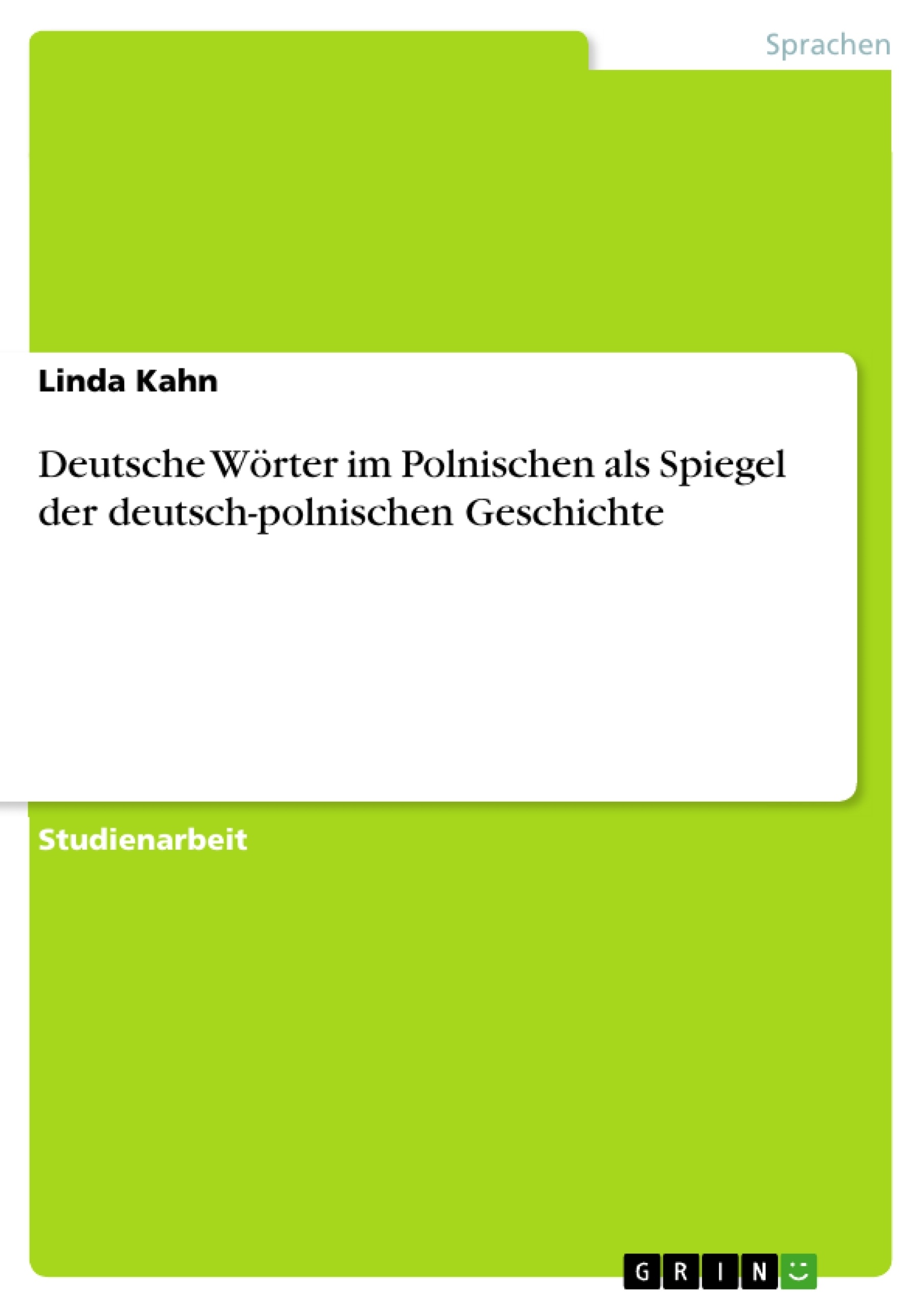Die vorliegende Arbeit soll der Frage nachgehen, wie Germanismen ins Polnische kamen und was ihr Vorhandensein noch heute über die Geschichte und die gemeinsamen Kontakte der beiden Nachbarländer aussagt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typologisierung der Lehnprozesse
- Quantitative Betrachtung
- Diachrone Betrachtung
- Vor- und frühpolnische Periode (700-1150)
- Altpolnische Periode (1150-1500)
- Mittelpolnische Periode (1500-1750)
- Neupolnische Periode (1750-1945)
- Gegenwart (1945-2010)
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Germanismen im Polnischen und deren Bedeutung als Spiegel der deutsch-polnischen Geschichte. Es werden die Wege der Übernahme deutscher Wörter in die polnische Sprache beleuchtet, deren quantitative Bedeutung im Vergleich zu anderen Sprachen abgeschätzt und die diachrone Entwicklung dieser Lehnwörter analysiert. Der Fokus liegt auf der exemplarischen Darstellung, wie historische Ereignisse und Sprachkontakte im heutigen polnischen Wortschatz widergespiegelt werden.
- Typologisierung der Lehnprozesse (direkter vs. indirekter Sprachkontakt)
- Quantitative Analyse deutscher Lehnwörter im Polnischen
- Diachrone Betrachtung der Lehnwörter über verschiedene historische Perioden
- Etymologische Unterscheidung der Lehnwörter (ursprünglich deutsch vs. über andere Sprachen vermittelt)
- Sprachkontakt und historische Ereignisse als Einflussfaktoren auf die Entwicklung des polnischen Wortschatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage, die untersucht wird: Wie gelangten Germanismen ins Polnische und was sagt ihr heutiges Vorhandensein über die deutsch-polnische Geschichte aus? Die Struktur der Arbeit wird vorgestellt, mit der Beschreibung der einzelnen Kapitel und deren jeweiligen Schwerpunkte. Die Einleitung betont den Fokus auf die exemplarische Darstellung der Sprachkontakte und deren Spiegelung im heutigen polnischen Wortschatz, anstatt auf eine vollständige Auflistung aller Lehnwörter.
Typologisierung der Lehnprozesse: Dieses Kapitel untersucht die Wege, auf denen deutsche Wörter ins Polnische gelangten. Es unterscheidet zwischen direktem und indirektem Sprachkontakt. Direkter Kontakt beschreibt den Austausch zwischen deutsch- und polnischsprachigen Menschen, der zur direkten Übernahme deutscher Wörter führte. Indirekter Kontakt hingegen meint die Vermittlung durch eine andere Sprache, z.B. Tschechisch. Innerhalb beider Kategorien wird weiter zwischen etymologisch deutschen Wörtern (ohne Vermittlung durch eine dritte Sprache) und etymologisch nicht-deutschen Wörtern (über eine dritte Sprache vermittelt) unterschieden. Beispiele für beide Arten von Lehnwörtern werden angeführt, um die Unterscheidung zu verdeutlichen und den jeweiligen Prozess zu illustrieren. Die Unterscheidung ist essentiell für das Verständnis der komplexen Geschichte des deutsch-polnischen Sprachkontakts.
Quantitative Betrachtung: Dieses Kapitel bietet einen quantitativen Überblick über die deutschen Lehnwörter im Polnischen. Es betrachtet den Stellenwert des Deutschen als Lehnwortgeber im Vergleich zu anderen Sprachen wie Lateinisch oder Französisch. Obwohl nicht im Detail ausgearbeitet, liefert es ein notwendiges Fundament für die qualitative Analyse, indem es die relative Bedeutung des Deutschen als Quelle von Lehnwörtern im polnischen Wortschatz einordnet und den Kontext für die folgenden Kapitel liefert.
Diachrone Betrachtung: Dieses Kapitel untersucht die deutschen Lehnwörter unter diachronem Aspekt, gegliedert in fünf Unterperioden der polnischen Sprachgeschichte. Jede Periode wird hinsichtlich der typischen Lehnwörter und der historischen Kontexte untersucht, die zu deren Übernahme führten. Es wird gezeigt, wie sich historische Ereignisse und Sprachkontakte in der Auswahl und Entwicklung der Lehnwörter widerspiegeln. Die Kapitel heben die Bedeutung der exemplarischen Auswahl hervor, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Geschichte und Sprache zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Germanismen, Polnisch, Deutsch, Lehnwörter, Sprachkontakt, Sprachgeschichte, Diachronie, Quantität, Etymologie, deutsch-polnische Geschichte, direkte und indirekte Entlehnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Germanismen im Polnischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Germanismen (Lehnwörter aus dem Deutschen) im Polnischen und analysiert deren Bedeutung als Spiegel der deutsch-polnischen Geschichte. Sie beleuchtet die Wege der Übernahme deutscher Wörter, deren quantitative Bedeutung im Vergleich zu anderen Sprachen und die diachrone Entwicklung dieser Lehnwörter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Typologisierung der Lehnprozesse (direkter vs. indirekter Sprachkontakt), eine quantitative Analyse deutscher Lehnwörter im Polnischen, eine diachrone Betrachtung über verschiedene historische Perioden, die etymologische Unterscheidung der Lehnwörter (ursprünglich deutsch vs. über andere Sprachen vermittelt) und den Einfluss von Sprachkontakt und historischen Ereignissen auf den polnischen Wortschatz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Typologisierung der Lehnprozesse, zur quantitativen Betrachtung, zur diachronen Betrachtung (unterteilt in fünf polnische Sprachperioden: Vor- und frühpolnische Periode (700-1150), Altpolnische Periode (1150-1500), Mittelpolnische Periode (1500-1750), Neupolnische Periode (1750-1945), Gegenwart (1945-2010)) und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Germanismen im Polnischen.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie gelangten Germanismen ins Polnische und was sagt ihr heutiges Vorhandensein über die deutsch-polnische Geschichte aus?
Wie wird die quantitative Betrachtung durchgeführt?
Das Kapitel zur quantitativen Betrachtung liefert einen Überblick über den Stellenwert des Deutschen als Lehnwortgeber im Vergleich zu anderen Sprachen. Es bietet ein Fundament für die qualitative Analyse, indem es die relative Bedeutung des Deutschen als Quelle von Lehnwörtern im polnischen Wortschatz einordnet.
Wie wird die diachrone Betrachtung durchgeführt?
Die diachrone Betrachtung untersucht deutsche Lehnwörter in fünf Unterperioden der polnischen Sprachgeschichte. Jede Periode wird hinsichtlich typischer Lehnwörter und historischer Kontexte untersucht, um die Spiegelung historischer Ereignisse und Sprachkontakte in der Entwicklung der Lehnwörter aufzuzeigen.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf eine exemplarische Darstellung der Sprachkontakte und deren Spiegelung im heutigen polnischen Wortschatz, anstatt auf eine vollständige Auflistung aller Lehnwörter.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Germanismen, Polnisch, Deutsch, Lehnwörter, Sprachkontakt, Sprachgeschichte, Diachronie, Quantität, Etymologie, deutsch-polnische Geschichte, direkte und indirekte Entlehnung.
Wie werden direkte und indirekte Lehnwörter unterschieden?
Direkter Sprachkontakt beschreibt den Austausch zwischen deutsch- und polnischsprachigen Menschen, der zur direkten Übernahme deutscher Wörter führte. Indirekter Kontakt meint die Vermittlung durch eine andere Sprache (z.B. Tschechisch).
- Quote paper
- Linda Kahn (Author), 2011, Deutsche Wörter im Polnischen als Spiegel der deutsch-polnischen Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231484