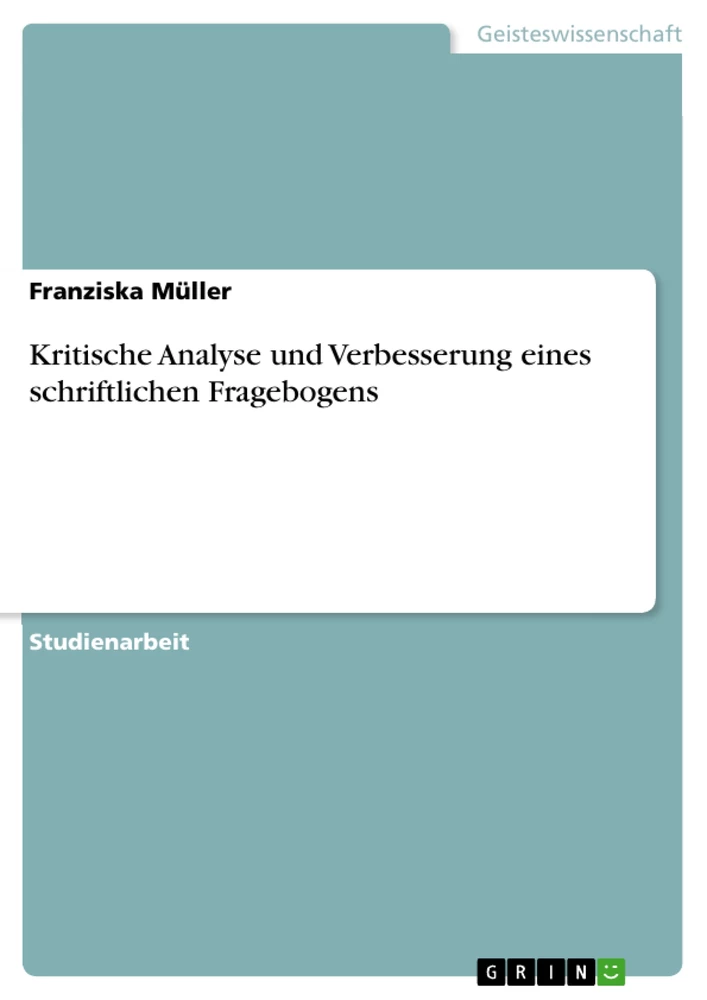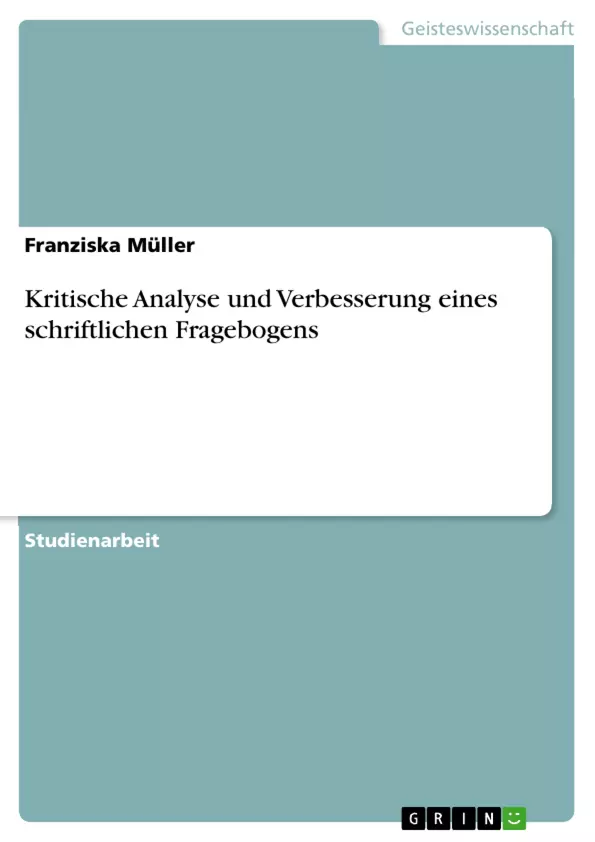Der Fragebogen als Erhebungs- und Messinstrument stellt in der empirischen Forschung eine grundlegende Möglichkeit dar, einen bestimmten Untersuchungsgegenstand aus einer Grundgesamtheit auszuwählen und diesen in Bezug auf eine bestimmte Forschungsfrage zu untersuchen. In der folgenden Ausarbeitung soll auf ein bereits bestehendes, und durchgeführtes Messinstrument in Form eines schriftlichen Fragebogens eingegangen werden. Diese Untersuchung kann hierbei als Pretest dienen, denn es erfolgt nun eine kritische Analyse der Konstruktion und des Ergebnisses, welches letztlich durch Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschläge ergänzt werden soll. Der Aufbau der Ausarbeitung gliedert sich daher in drei Teilabschnitte. In der ersten Instanz soll die Ausgangslage und der entsprechende Untersuchungsgegenstand vorgestellt werden. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Darstellung der Item-Konstruktion im Hinblick auf die Intention welche hierbei ausschlaggebend war. Letztlich soll eine kritische Untersuchung stattfinden, welche sich mit vorherrschenden Komplikationen in der Durchführung auseinander setzt und anschließend Lösungs- und Verbesserungsvorschläge offenbart.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes
- 3. Der Verlauf der Konstruktion
- 4. Kritische Analyse des Fragebogeninstruments
- 5. Lösungsvorschläge für eine überarbeitete Version des Erhebungsinstrumentes
- 6. Fazit/Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert einen schriftlichen Fragebogen zur Erhebung von ökonomischem Wissen und Einstellungen bei Hauptschülern der 10. Klasse. Ziel ist die kritische Bewertung des Instruments und die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen. Die Arbeit dient als Pretest-Analyse.
- Analyse eines bestehenden Fragebogens zur Erhebung ökonomischen Wissens und Einstellungen bei Hauptschülern.
- Bewertung der Itemkonstruktion und der Methodik der Datenerhebung.
- Identifizierung von Schwächen und Verbesserungspotenzial des Fragebogens.
- Entwicklung konkreter Lösungsvorschläge für eine überarbeitete Version des Instruments.
- Vergleich der Ergebnisse zwischen regulären Hauptschülern und Schülern in einem Berufsvorbereitungsprogramm (BUS).
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fragebogen als grundlegendes Instrument der empirischen Forschung und kündigt den Aufbau der Arbeit an: Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes, Darstellung der Itemkonstruktion und kritische Analyse mit Lösungsvorschlägen.
2. Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes: Dieses Kapitel beschreibt die untersuchte Stichprobe von 51 Schülern zweier 10. Klassen an Hauptschulen. Eine Klasse ist eine reguläre Hauptschulklasse, die andere nimmt an einem Berufsvorbereitungsprogramm (BUS) teil, welches Schule und Beruf verbindet und auf Schüler ausgerichtet ist, die die Schule ohne Anschluss verlassen könnten. Die Unterschiede in den Lernumgebungen und Zielen der beiden Klassen bilden den Kontext der Untersuchung.
3. Der Verlauf der Konstruktion: Das Kapitel erläutert den Konstruktionsprozess des Fragebogens ausgehend von zwei Hypothesen: Erstens, dass BUS-Schüler durch den einjährigen Praxisbezug besser mit wirtschaftlichen und beruflichen Anforderungen umgehen können; zweitens, dass viele Schüler zwar ihren Schulabschluss verbessern wollen, aber keine berufsvorbereitende Maßnahme in Anspruch nehmen möchten. Der Fragebogen umfasst 24 Items, kategorisiert in Wissensabfrage, persönliche Einstellung und sozioökonomische Daten (Alter, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit). Die Auswahl der Fragetypen (offen, geschlossen, gemischt) und die Gestaltung der Items werden detailliert beschrieben.
4. Kritische Analyse des Fragebogeninstruments: Diese Sektion bietet eine kritische retrospektive Analyse der Fragebogenkonstruktion. Der Text erwähnt die Notwendigkeit einer reflektierten Betrachtung der Fragekonzeption, deutet jedoch keine spezifischen Kritikpunkte an, sondern kündigt diese nur an. Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse und der methodischen Vorgehensweise fehlt an dieser Stelle in diesem Auszug.
Schlüsselwörter
Ökonomisches Wissen, Einstellungen, Hauptschüler, Berufswahl, Fragebogen, empirische Forschung, Itemkonstruktion, Pretest, Berufsvorbereitung, BUS-Programm, kritische Analyse, Lösungsvorschläge.
Häufig gestellte Fragen zum Fragebogen-Pretest
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert einen schriftlichen Fragebogen, der das ökonomische Wissen und die Einstellungen von Hauptschülern der 10. Klasse erhebt. Das Hauptziel ist die kritische Bewertung des Fragebogens und die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen. Die Analyse dient als Pretest-Analyse.
Welche Stichprobe wurde untersucht?
Die Untersuchung umfasst 51 Schüler aus zwei 10. Klassen an Hauptschulen. Eine Klasse ist eine reguläre Klasse, die andere nimmt an einem Berufsvorbereitungsprogramm (BUS) teil. Die Unterschiede in den Lernumgebungen und Zielen beider Klassen bilden den Kontext der Untersuchung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des bestehenden Fragebogens, die Bewertung der Itemkonstruktion und der Methodik, die Identifizierung von Schwächen und Verbesserungspotenzial, die Entwicklung konkreter Lösungsvorschläge für eine überarbeitete Version und den Vergleich der Ergebnisse zwischen regulären Hauptschülern und BUS-Schülern.
Wie ist der Fragebogen aufgebaut?
Der Fragebogen besteht aus 24 Items, die in Wissensabfrage, persönliche Einstellungen und sozioökonomische Daten (Alter, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit) kategorisiert sind. Es werden offene, geschlossene und gemischte Fragetypen verwendet. Der Konstruktionsprozess basiert auf zwei Hypothesen: besserer Umgang mit wirtschaftlichen Anforderungen bei BUS-Schülern und unterschiedliche Motivation bezüglich berufsvorbereitender Maßnahmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes, die Darstellung des Konstruktionsprozesses des Fragebogens, eine kritische Analyse des Fragebogeninstruments, Lösungsvorschläge für eine überarbeitete Version und ein Fazit/Stellungnahme.
Welche Kritikpunkte werden an dem Fragebogen geäußert?
Der Auszug enthält nur die Ankündigung einer kritischen retrospektiven Analyse der Fragebogenkonstruktion. Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse und der methodischen Vorgehensweise fehlt in diesem Auszug.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Ökonomisches Wissen, Einstellungen, Hauptschüler, Berufswahl, Fragebogen, empirische Forschung, Itemkonstruktion, Pretest, Berufsvorbereitung, BUS-Programm, kritische Analyse, Lösungsvorschläge.
- Arbeit zitieren
- Franziska Müller (Autor:in), 2011, Kritische Analyse und Verbesserung eines schriftlichen Fragebogens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231660