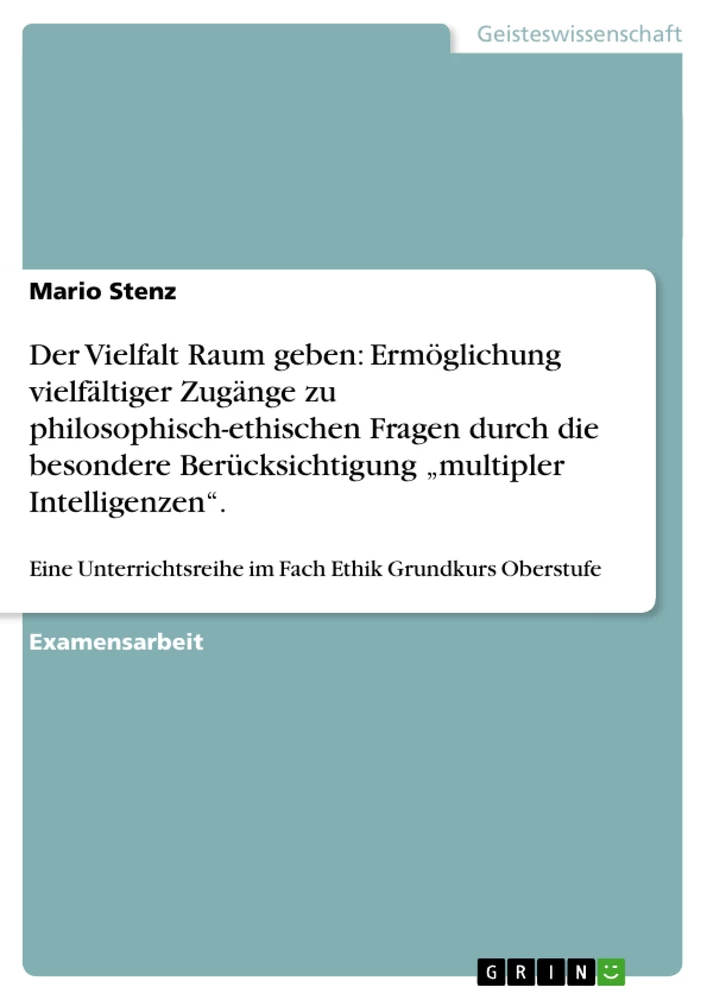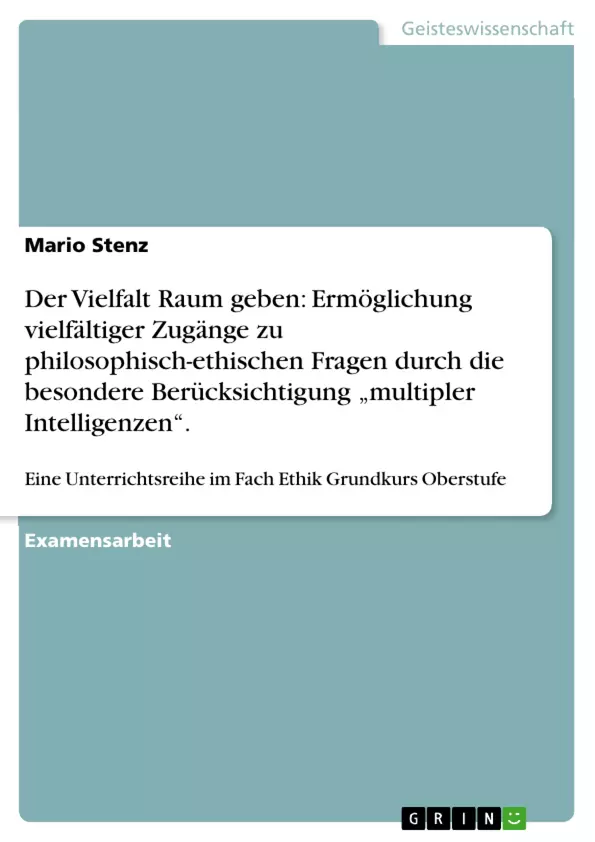Der Frage nachzugehen, welche Möglichkeiten existieren, um der Vielfalt Raum zu geben, also pädagogisch gewendet, wie die vorhandenen Ressourcen und die Interessen der Lerner wertgeschätzt werden können, hat für mich zwei lebensweltliche Schlüsselerlebnisse.
Zum einen ist die wiederkehrende Reserviertheit einiger Lerner gegenüber Textarbeit und Formen der Leistungsfeststellung wie z.B. schriftliche Stellungnahme und Textverfassung zu nennen. Allgemein gesagt, die „Vermeidungstendenzen“ gegen die Dechiffrierung oft sperriger philosophischer Texte und Ausdrucksformern, die vornehmlich die geschriebene Sprache im Zentrum haben und die eine logische, stringente Begründung verlangen.
Und zum anderen habe ich die im Folgenden behandelte Problemstellung durch einen Impuls in der Nachbesprechung einer benoteten Lehrprobe zu einer Ethikstunde erhalten, der die oben genannte Erfahrung indirekt aufgriff. Denn man fragte mich, ob ich mit Blick auf die Handlungsprodukte eine größere Bandbreite für möglich erachten würde, da ein vielseitiges Fach wie es das Fach Ethik ist, solche Möglichkeiten vermehrt biete. Ferner fragte man mich, ob ich in diesem Zusammenhang die „Theorie der multiplen Intelligenzen“ von Howard Gardner kennen würde. Mit Blick auf meinen methodischen Kompetenzzuwachs erachtete ich diese Öffnung der Handlungsproduktpalette wünschenswert. Und unter dem Namen „Multiple Intelligenzen“ konnte ich mir rein assoziativ und mit sprachlichem Feingefühl etwas wie „vielfältige Fähigkeiten“ vorstellen. Genaueres wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.
Infolgedessen und mit Blick auf die anstehende Hausarbeit beschäftigte ich mich aus intellektueller Neugierde und Professionalisierungsdrang mit dieser Theorie und merkte, dass mein Schlüsselerlebnis der Verschlossenheit vieler Lerner gegen sprachlich–logisches Arbeiten ein tieferliegendes Problem der Lernkultur ist. Dieses Problem liegt in der Dominanz eines bevorzugten Intelligenzprofils, dem zum einen weite Bereiche unseres Schulsystems unterliegen und in dem ich zum anderen schulisch als auch universitär sozialisiert wurde und darum vielleicht unbewusst meine kulturell bedingte „Intelligenzsozialisation“ mit in meine Unterrichtsplanung getragen habe. Es ist das Problem der vereinseitige Ausrichtung der „Schule im Einheitslook“ an der sprachlich und logisch-mathematischen Intelligenz der Lerner. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Mein Weg zur Problemstellung
- Theoretische Grundlagen: Die gedankliche Basis der Unterrichtsreihe
- Über Einfalt und Vielfalt des menschlichen Geistes
- „Multiple Intelligenzen": die Pluralität der Potentiale
- Sprachliche Intelligenz
- Logisch-mathematische Intelligenz
- Musikalische Intelligenz
- Körperlich-kinästhetische Intelligenz
- Visuell-räumliche Intelligenz
- Interpersonale Intelligenz
- Intrapersonale Intelligenz
- Naturalistische Intelligenz
- Existentiale Intelligenz
- „Multiple Intelligenzen" und ihre pädagogischen Implikationen
- Didaktisch-methodische Folgerungen aus der MI-Theorie
- Intelligenzen kennenlernen
- Lernerzentrierung
- Lerninhalte vielfältig aufbereiten
- Inhaltsreduktion
- Handlungsorientierung, Komplexität und Exemplarizität
- Komplexe Testverfahren
- Empathie
- Vielfältiges Lernarrangement
- Ressourcen- und Präferenzorientierung
- Argumente für den Einsatz der MI-Theorie im Unterricht
- Verbesserte Lernmotivation und -bereitschaft
- Steigerung des Selbstbewusstseins und Metakognition
- Unterrichtsklima von Wertschätzung und Toleranz
- Nachhaltiges Lernen
- Allgemeine Aspekte zur Unterrichtsreihe: Bedingungen und Entscheidungen
- Institutionell-strukturelle Bedingungen
- Meine Lerngruppe: Ethik Grundkurs BGYT 13
- Zeitlicher Ansatz
- Lehrplanbezug
- Didaktisch-methodische Entscheidungen
- Kurzer Abriss der Unterrichtsreihe und der Aspekt der „Doppelten Zugänglichkeit"
- Makromethode: Projektunterricht und didaktischen Konsequenzen.
- Kompetenzschwerpunkte
- Praktische Umsetzung: Unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion
- Die Unterrichtsreihe in einzelnen Phasen
- Informierungsphase (19.02.13)
- Planung des Unterrichts
- Beobachtungen inklusive Reflexion
- Planungsphase (26.02.13)
- Planung
- Beobachtung inklusive Reflexion
- Produktionsphase I (05.03.13)
- Planung
- Produktionsphase II (12.03.13)
- Planung
- Performanzphase: „Mein Lebensmotto, die Intelligenzen und ich" (16.03.13)
- Beschreibung und Beobachtungen
- Abschlussphase (09.04.13)
- Planung
- Beobachtungen inklusive Reflexion
- Kritischer Rückblick: Konzeptionelle Gesamtreflexion
- Was war das Ziel der Unterrichtsreihe?
- Was sehe ich als problematisch an?
- Problem des Testverfahrens
- Problem der Leistbarkeit
- Problem der strukturellen Vorgaben
- Problem der Interaktion
- Was nehme ich aus der Unterrichtsreihe für meine Professionalisierung mit?
- Neue Sichtweise
- Verbesserter Umgang mit Individualität (Heterogenität)
- Neue Wege der multiplen Zugangsmöglichkeiten
- Motivation der Lerner
- Fazit
- Literaturangabe
- Anhang
- Mein Konzept
- Didaktischer Plan der Unterrichtsreihe
- Erläuterung der Merkmale und Vorzüge des Projektunterrichts
- Grafik „Orientierungskompetenz"
- Kompetenzraster zur Unterrichtsreihe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Der Vielfalt Raum geben: Ermöglichung vielfältiger Zugänge zu philosophisch-ethischen Fragen durch die besondere Berücksichtigung „multipler Intelligenzen". Eine Unterrichtsreihe im Fach Ethik, Grundkurs. Berufsbildendes Gymnasium, Technik, Jgst. 13" zielt darauf ab, ein Unterrichtskonzept zu entwickeln und zu reflektieren, das die „Theorie der multiplen Intelligenzen" von Howard Gardner in die Praxis überträgt. Die Unterrichtsreihe soll den Lernenden ermöglichen, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und diese für einen selbstgesteuerten Zugang zu philosophisch-ethischen Fragen zu nutzen. Dabei steht die Frage nach einem persönlichen Lebensmotto im Mittelpunkt, welches die Lerner anhand ihrer Stärken und Fähigkeiten in einem interaktiven Handlungsprodukt für den „Tag der offenen Tür" an der BBS Westerburg präsentieren.
- Die „Theorie der multiplen Intelligenzen" von Howard Gardner
- Die Bedeutung von Individualität und Heterogenität im Unterricht
- Die Förderung von Orientierungskompetenz bei den Lernenden
- Die Gestaltung von intelligenzspezifischen Lernarrangements
- Die Rolle von Selbststeuerung und Partizipation im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den persönlichen Weg des Autors zur Problemstellung der Unterrichtsreihe. Er schildert zwei Schlüsselerlebnisse, die ihn zu der Frage führten, wie man die vorhandenen Ressourcen und Interessen der Lerner besser in den Unterricht integrieren kann. Insbesondere die „Theorie der multiplen Intelligenzen" von Howard Gardner soll dabei helfen, den Lernenden einen individuelleren und stärkenorientierten Zugang zu philosophisch-ethischen Fragen zu ermöglichen.
Das zweite Kapitel stellt die „Theorie der multiplen Intelligenzen" von Howard Gardner vor. Gardner unterscheidet acht verschiedene Intelligenzarten, die jedem Menschen als Potentiale innewohnen. Diese Intelligenzen sind unabhängig voneinander, können aber in Kombination in vielfältiger Weise gebraucht werden. Der Autor erläutert die einzelnen Intelligenzarten und ihre möglichen pädagogischen Konsequenzen.
Im dritten Kapitel werden die institutionellen Bedingungen der Unterrichtsreihe beschrieben, die den Rahmen der Unterrichtsplanung und -durchführung abstecken. Dazu gehören die Zusammensetzung der Lerngruppe, der zeitliche Ansatz und der Lehrplanbezug.
Kapitel vier beschreibt die praktische Umsetzung der Unterrichtsreihe in einzelnen Phasen. Die einzelnen Stunden werden in Bezug auf Planung, Durchführung und Reflexion dargestellt. Der Autor beschreibt die Herausforderungen und Erfolge der Unterrichtsreihe und reflektiert seine eigenen Erfahrungen als Lehrkraft.
Der fünfte Abschnitt bietet eine kritische Gesamtreflexion der Unterrichtsreihe. Der Autor reflektiert das Ziel der Unterrichtsreihe und identifiziert verschiedene Probleme, die sich im Verlauf der Planung und Durchführung ergeben haben. Er analysiert die Schwierigkeiten bei der Eruierung der Intelligenzen, die Leistbarkeit des Unterrichtskonzepts, die strukturellen Vorgaben und die Interaktion mit dem Publikum. Schlussendlich zieht der Autor positive Erkenntnisse aus der Unterrichtsreihe für seine weitere Professionalisierung und beschreibt, wie er seinen Unterricht in Zukunft gestalten möchte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Theorie der multiplen Intelligenzen" von Howard Gardner, die Förderung von Orientierungskompetenz, die Gestaltung von intelligenzspezifischen Lernarrangements, die Bedeutung von Individualität und Heterogenität im Unterricht sowie die Rolle von Selbststeuerung und Partizipation im Unterricht. Die Arbeit zeigt auf, wie man die „Theorie der multiplen Intelligenzen" in die Praxis umsetzen kann, um den Lernenden einen individuelleren und stärkenorientierten Zugang zu philosophisch-ethischen Fragen zu ermöglichen. Die Unterrichtsreihe selbst dient als Beispiel für die praktische Anwendung der Theorie und bietet konkrete Einblicke in die Planung, Durchführung und Reflexion eines intelligenzspezifischen Unterrichtskonzepts.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner?
Gardner unterscheidet acht (bis neun) verschiedene Intelligenzarten wie sprachliche, musikalische oder körperliche Intelligenz, die jedem Menschen als Potentiale innewohnen.
Wie kann das Fach Ethik von dieser Theorie profitieren?
Durch Berücksichtigung vielfältiger Intelligenzen erhalten Schüler individuelle Zugänge zu komplexen philosophisch-ethischen Fragen abseits der reinen Textarbeit.
Welches Projekt wurde in der Unterrichtsreihe umgesetzt?
Schüler entwickelten ein persönliches Lebensmotto und präsentierten dieses stärkenorientiert in einem Handlungsprodukt für einen Tag der offenen Tür.
Was ist das Problem der „Schule im Einheitslook“?
Es ist die einseitige Ausrichtung des Schulsystems an sprachlicher und logisch-mathematischer Intelligenz, was andere Talente vernachlässigt.
Welche pädagogischen Vorteile bietet der MI-Ansatz?
Er fördert die Lernmotivation, das Selbstbewusstsein und ein Unterrichtsklima der Wertschätzung und Toleranz durch Ressourcenorientierung.
- Quote paper
- Dipl. - Päd. Mario Stenz (Author), 2013, Der Vielfalt Raum geben: Ermöglichung vielfältiger Zugänge zu philosophisch-ethischen Fragen durch die besondere Berücksichtigung „multipler Intelligenzen“., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231710