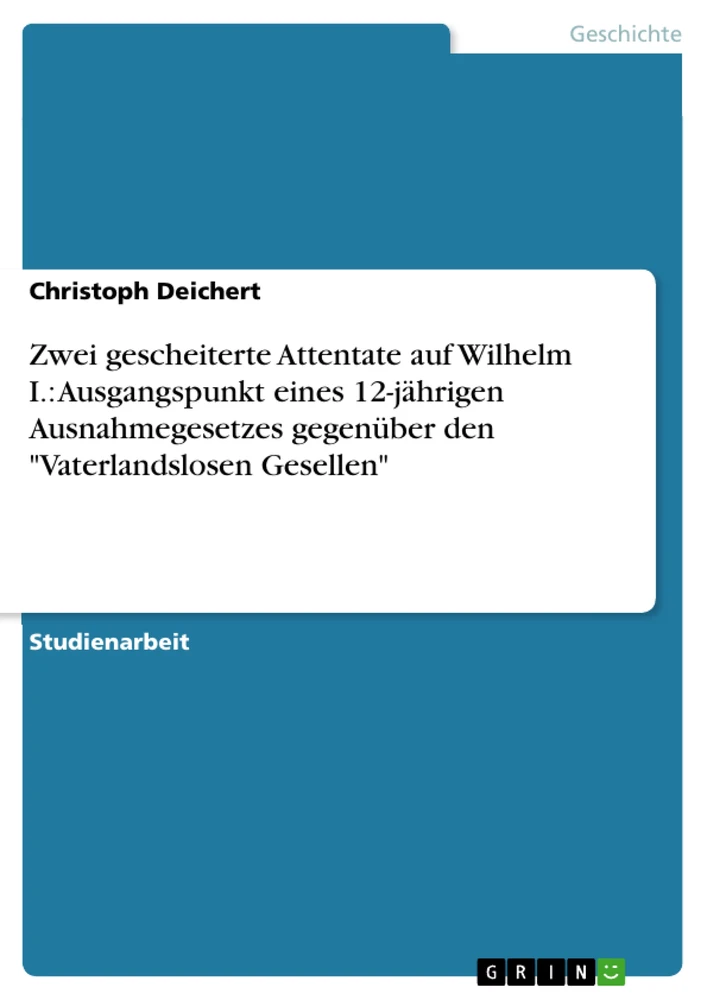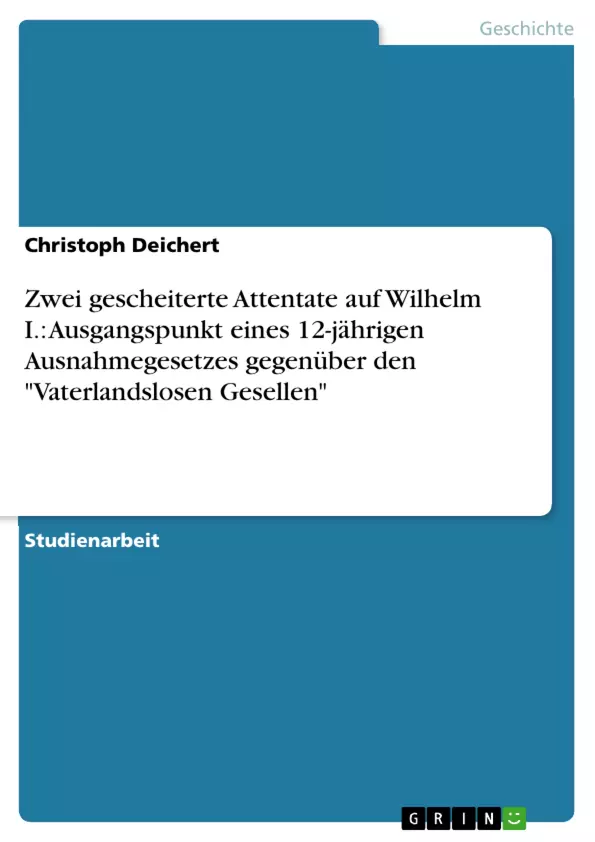1872 wurde mit dem Leipziger Hochverratsprozess eine Epoche der allgemeinen Verfolgung der Sozialdemokratie eingeleitet. Über den Hochverrat hinaus, ließ sich auf der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung nutzen, um einen Sozialdemokraten hinter Gittern zu bringen. Besonders vielfältige Möglichkeiten lieferte der Klassenkampfparagraf des Strafgesetzbuches. Als immer mehr Sozialdemokraten freigesprochen wurden, forderte der Reichskanzler Otto von Bismarck eine deutliche Verschärfung zu Ungunsten von Beschuldigten. Doch die Verschärfung scheiterte 1876 an der liberalen Reichstagsmehrheit....
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Forschungsstand
- I.2 Fragestellung
- I.3 Methode
- I. 4 Literaturdiskussion
- II. Begriffsdefinition „politisches Delikt“
- II. Crimen laesea maiestatis im Strafgesetzbuch von 1871
- II.1 Die ,,liberale Ära\" zwischen 1867 und 1878
- III. Attentat vom 11. Mai 1878 auf Wilhelm I
- III.1 Der Täter und seine Motive
- III.2 Verhaftung, Untersuchungshaft und Prozess
- IV. Attentat vom 2. Juni auf Wilhelm I.
- IV.1 Der Täter und seine Motive
- V. Öffentliche Begleitung der Taten
- VI. Unmittelbare rechtliche Folgen
- VII. Politische Reaktion der Obrigkeit
- VIII. Sozialistengesetz
- IX. Justizielle Folgen
- IX.1 Polizeiliche Methoden
- X. Auslaufen des Sozialistengesetzes
- XI. Bilanz des Sozialistengesetzes
- XII. Schlussfolgerungen
- XIII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Hintergründe und Folgen der beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm I. im Jahr 1878 und die Entstehung des Sozialistengesetzes in Deutschland. Die Analyse fokussiert auf die Rolle der Sozialdemokratie in diesem Kontext und hinterfragt die Legitimität der staatlichen Repressionen gegen sie.
- Die Entstehung und Entwicklung des Begriffs „politisches Delikt“
- Die Rolle des Majestätsverbrechens im deutschen Strafrecht und seine Anwendung gegen Sozialdemokraten
- Die Motivanalyse der Attentäter und ihre Einordnung in die sozialistische Bewegung
- Die politische und rechtliche Reaktion der Regierung auf die Attentate
- Die Auswirkungen des Sozialistengesetzes auf die Sozialdemokratie und die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsstand zu den Themen Attentate, Sozialistengesetz und staatliche Repression dar. Die Fragestellung untersucht die Legitimität des Sozialistengesetzes und die These, dass die Regierung es nutzte, um repressive Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie durchzusetzen. Die Methode der Arbeit ist strukturgeschichtlich, wobei die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge dargestellt werden.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Definition des Begriffs „politisches Delikt“, dem Majestätsverbrechen im Strafgesetzbuch von 1871 und der „liberalen Ära“ zwischen 1867 und 1878. Die beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm I. und die Motive der Täter werden detailliert beschrieben. Die öffentliche Begleitung der Taten, die unmittelbaren rechtlichen Folgen und die politische Reaktion der Obrigkeit werden beleuchtet.
Im Mittelpunkt steht die Darstellung des Sozialistengesetzes, seiner justiziellen Folgen und der polizeilichen Methoden, die während seiner Geltungsdauer angewandt wurden. Die Arbeit endet mit einer Analyse des Auslaufens des Sozialistengesetzes und seiner Folgen sowie mit Schlussfolgerungen und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen „politisches Delikt“, „Majestätsverbrechen“, „Sozialistengesetz“, „Attentat“, „Sozialdemokratie“, „Repression“, „Staat“ und „Gesellschaft“. Sie untersucht die historischen Entwicklungen im Kaiserreich und die Auswirkungen der staatlichen Repression auf die Sozialdemokratie in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Auslöser für das Sozialistengesetz von 1878?
Die unmittelbaren Auslöser waren zwei gescheiterte Attentate auf Kaiser Wilhelm I. im Mai und Juni 1878. Reichskanzler Otto von Bismarck nutzte diese Ereignisse, um das repressive Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie durchzusetzen.
Was bedeutete der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung?
Der Straftatbestand „Crimen laesea maiestatis“ wurde im Kaiserreich genutzt, um Sozialdemokraten gerichtlich zu verfolgen und zu inhaftieren, wenn sie das Staatsoberhaupt kritisierten oder beleidigten.
Wer waren die Attentäter von 1878?
Das Dokument behandelt die Täter der beiden Anschläge auf Wilhelm I., ihre Motive und deren (oft fälschliche) Einordnung in die sozialistische Bewegung durch die damalige Obrigkeit.
Welche Auswirkungen hatte das Sozialistengesetz auf die Gesellschaft?
Es führte zu einer zwölfjährigen Epoche der Verfolgung, in der sozialdemokratische Organisationen verboten wurden. Die Arbeit untersucht die polizeilichen Methoden und die justiziellen Folgen dieser Repression.
Wann lief das Sozialistengesetz aus?
Das Gesetz wurde nach zwölf Jahren nicht mehr verlängert. Die Arbeit zieht eine Bilanz der Auswirkungen und analysiert die langfristigen Folgen für den deutschen Staat und die Arbeiterbewegung.
- Quote paper
- Christoph Deichert (Author), 2012, Zwei gescheiterte Attentate auf Wilhelm I.: Ausgangspunkt eines 12-jährigen Ausnahmegesetzes gegenüber den "Vaterlandslosen Gesellen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231787