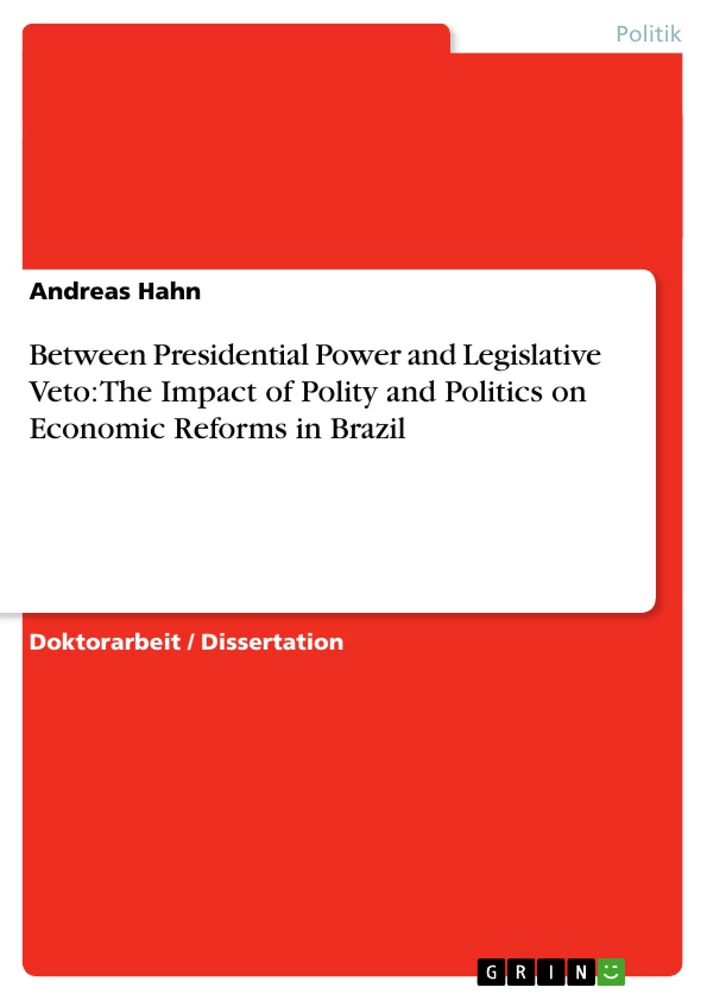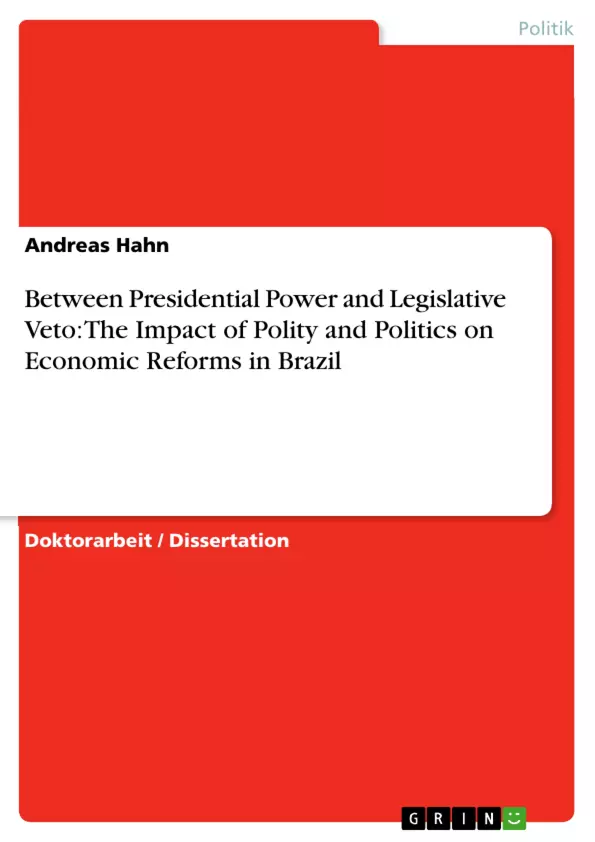The pace and scope of the Brazilian economic development in the 1980s and 1990s is intrinsically linked to the wide-ranging discussion of political and economic reform projects. In the wake of the crisis of the import-substitution economic model a wide array of approaches and theories revolved around one basic question: When there occurs a crisis in the economy – whatever definition of crisis may be applied in a particular case – which are the best ways of overcoming anti-reform resistances, regain economic growth and promote sustainable and ―future-approved‖ development? In the most general sense a crisis of the political or economic system can be referred to as two-dimensional: on the one hand it means the shattering and dis-equilibrating of a formerly successful status quo, on the other hand it opens up the necessity to find a new status quo (or status quo post) that can be deemed compatible to the new economic, domestic as well as international, circumstances. In fact, the longer a prosperous status quo lasts, the more difficult a subsequent change will get. Path-dependencies develop, stable institutions arise, group interests and organizations take root and expectations about growth, inflation, external trade and other variables cement into place.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Widmung
- l. Den Herausforderungen des "Verlorenen Jahrzehnts" begegnen
- l. Den Herausforderungen des "Verlorenen Jahrzehnts" begegnen - Reformdynamik in Brasilien zwischen Heterodoxie und Orthodoxie
- l.l Einleitung - Struktur der Dissertation
- l.2 Die Relevanz der brasilianischen Wirtschaftsreformen als empirische Grundlage
- 2. Marktorientierte Reformen mit mehreren Vetoakteuren gestalten - Die theoretischen Bedingungen der Reformfähigkeit
- 2.l Die Rational-Choice-Perspektive
- 2.l.l Allgemeine Ansätze
- 2.l.2 Phasen der Reform
- 2.l.3 Schlussfolgerung
- 2.2 Ausarbeitung einer institutionellen Grundperspektive mit Rational-Choice-Elementen
- 2.2.l Gewaltenteilung: Präsidentialismus versus Parlamentarismus
- 2.2.2 Die Trennung des Zwecks: Formale Institutionen in Frage stellen
- 2.2.3 Entscheidungsfähigkeit versus Entschlossenheit - Schnelle versus nachhaltige Politikgestaltung
- 2.2.4 Öffentliche versus private Zielsetzung
- 2.2.5 Endogene Institutionen und die koalitionäre Natur der Politikgestaltung
- a. Von politischen Spotmärkten zu langfristigen Verträgen
- b. Der Begriff des Pivotal Players
- c. Dekonstitutionalisierung und Rekonstitutionalisierung: Flexibilität gewinnen und aufgeben?
- 2.2.6 Vorläufige Schlussfolgerung
- 2.2.7 Thesen und Bedingungen
- 3. Endogene Institutionen und das politische System: Entscheidungsfähigkeit und Reformfähigkeit steigern
- 3.l Politik und Polity verschwimmen - Die brasilianische Verfassung
- 3.l.l Tödlich fehlerhaft oder historische Second-best-Lösung - Die Entstehung der Verfassung
- 3.l.2 Die potenziellen Auswirkungen der Verfassung auf die Politikgestaltung und Reform
- 3.2 Zwischen Stillstand und Wahlerfolg - Brasilianische Politik nach der Verabschiedung der Verfassung von 1988
- 3.2.l Entscheidungsunfähigkeit und Fragmentierung als Last des Amtsinhabers
- a. Das Erbe der Dezentralisierung
- b. Mängel des Wahlsystems - Schwache Parteien und starke lokale Akteure
- c. Überrepräsentation im Kongress
- d. Coattail-Effekte und Wahlinterdependenzen
- e. Dezentralisierung und bikamerale Inkongruenzen
- f. Schlussfolgerung:
- 3.2.2 Elemente der Entscheidungsfähigkeit und Kohärenz
- a. Die verfassungsmäßigen Befugnisse der Exekutive
- b. Die Verhandlungsmacht der Exekutive - Mehrheiten bilden und Pork Barrel Trade
- Das College of Leaders -
- Die Rolle individueller Budgetemendungen -
- Die Rentenreform als Beweis für die Möglichkeiten und Grenzen des Patronages -
- c. Die fehlenden Befugnisse der Legislative - Stabilität und Abhängigkeit durch Unterwerfung und Dominanz der Exekutive
- Empirische Evidenz -
- 3.3 Die wachsende Entscheidungsfreiheit der Exekutive in den 1990er Jahren: Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsunfähigkeit in einer dynamischen Perspektive
- 3.3.l Exekutiv-Enttäuschung: Die Befugnisse und Verhandlungsmöglichkeiten der Exekutive einschränken
- 3.3.2 Die Stärkung der Exekutive: Re-Zentralisierung und die Neugestaltung der Beziehungen zwischen den Bundesstaaten
- a. Interjurisdiktionaler Wettbewerb und staatliche Einheit
- 3.4 Entscheidungsfähigkeit steigern und den Bundeshaushalt durch Rekonstitutionalisierung straffen
- 3.4.l Der verfassungsmäßige Status quo der Finanzbeziehungen
- a. Den Bundeshaushalt betonen I: Finanztransfers und Umsatzteilung
- b. Den Bundeshaushalt betonen II: Die Verfestigung der Sozialausgaben
- c. Den Bundeshaushalt betonen III: Die Kreditautonomie der Bundesstaaten
- d. Parametrische Bedingungen - Der "fiskalische Zwang"
- e. Vorläufige Schlussfolgerung: Die zweckgebundene Verwendung von Einnahmen und Haushaltsrigiditäten
- 3.4.2 Die Kunst der Re-Zentralisierung - Entkopplung und der Sozialnotstandsfonds
- a. Die Erhöhung der Sozialbeiträge
- b. Der Sozialnotstandsfonds - Den Weg für die fiskalische Re-Zentralisierung ebnen
- Die Bedeutung der
- c. Das Gesetz der fiskalischen Verantwortung - Glorreicher Höhepunkt der Re-Zentralisierung?
- Hauptinhalte und die Auswirkungen des Gesetzes
- Der FSE und die LRF im Vergleich - Die Phasen der Entwicklung
- 4. Stillstand, Verzögerung und Erfolg besonderer Reformprojekte
- 4.l Erfolg der Privatisierung - Wenige Vetoakteure, starker Konsens und Rekonstitutionalisierung
- 4.l.l Die Privatisierung der CVRD - Von der vorherigen Rekonstitutionalisierung profitieren
- 4.l.2 Privatisierung des Telekommunikationssektors
- 4.2 Verzögerung der Sozialversicherungsreform - Zahlreiche Vetoakteure, schwacher Konsens und verfassungsmäßige Status-quo-Orientierung
- 4.2.l Die Phasen der Sozialversicherungsreform
- 4.2.2 Die Dynamik der Sozialversicherungsreformverhandlungen: Ungünstige Bedingungen und strategische Fehler
- 4.3.l Der Verlauf der Steuerreform
- 4.3.2 Die Dynamik der Steuerreform: Fehlende Kompensation und fehlender politischer Wille
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation analysiert die Auswirkungen von Politik und politischem System auf Wirtschaftsreformen in Brasilien. Sie untersucht, warum einige Reformen erfolgreich waren, während andere verzögert wurden oder gescheitert sind, und wie die Entscheidungsfähigkeit des politischen Systems die Reformdynamik beeinflusst. Die Arbeit konzentriert sich auf die brasilianische Erfahrung der 1990er Jahre, eine Zeit intensiver Reformbemühungen, die von der Stabilisierung des Real Plans bis hin zur Privatisierung und der fiskalischen Konsolidierung reichten.
- Die Rolle der Institutionen in der Reformdynamik
- Die Bedeutung der Entscheidungsfähigkeit und der Entschlossenheit des politischen Systems
- Die Auswirkungen von Veto-Akteuren und der Koalitionsbildung
- Die Herausforderungen der Rekonstitutionalisierung und die Notwendigkeit von Konsens
- Die Analyse von drei wichtigen Reformprojekten: Privatisierung, Sozialversicherungsreform und Steuerreform
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Herausforderungen des "Verlorenen Jahrzehnts" in Brasilien vor und erläutert die Relevanz der brasilianischen Wirtschaftsreformen als empirische Grundlage für die Dissertation. Die Krise des Importsubstitutionsmodells und die Hyperinflation führten zu einem dringenden Bedarf an Reformen. Die Dissertation untersucht, wie die brasilianische Politik mit den verschiedenen Reformen umging, sowohl in Bezug auf die Stabilisierung als auch auf die strukturellen Veränderungen.
Kapitel 2 analysiert die theoretischen Bedingungen der Reformfähigkeit. Es werden verschiedene Ansätze zur Erklärung von Reformfortschritt und -verzögerung vorgestellt, darunter die Rational-Choice-Theorie, die institutionelle Theorie und die Theorie der endogenen Institutionen. Die Dissertation argumentiert, dass die konventionelle Trennung der Gewalten nicht ausreicht, um die Reformdynamik zu erklären. Stattdessen werden die Trennung des Zwecks, die Entscheidungsfähigkeit versus Entschlossenheit und die endogene Natur der Institutionen hervorgehoben.
Kapitel 3 untersucht die Entscheidungsfähigkeit des brasilianischen politischen Systems. Die Dissertation zeigt, wie die Verfassung von 1988 sowohl Elemente der Entscheidungsunfähigkeit (z. B. Fragmentierung, Dezentralisierung) als auch Elemente der Entscheidungsfähigkeit (z. B. starke Exekutivbefugnisse) enthält. Die Arbeit argumentiert, dass die Exekutive in den 1990er Jahren ihre Entscheidungsfreiheit durch die Re-Zentralisierung des Bundeshaushalts und die Stärkung ihrer Koalitionsmacht steigerte. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die Verabschiedung des Gesetzes der fiskalischen Verantwortung (LRF) im Jahr 2000.
Kapitel 4 analysiert drei wichtige Reformprojekte: die Privatisierung, die Sozialversicherungsreform und die Steuerreform. Es werden sechs Schlüsselfaktoren identifiziert, die den Erfolg oder die Verzögerung von Reformen beeinflussen: die Sichtbarkeit von Kosten und Nutzen, die Möglichkeit von Patronage und Kompensation, die Anzahl und Bedeutung von Vetoakteuren, das Engagement und die Kohärenz der Exekutive, die koalitionäre Disziplin und die verfassungsmäßige Verfestigung. Die Dissertation zeigt, dass die Privatisierung aufgrund des starken Konsenses und der geringen Anzahl von Vetoakteuren erfolgreich war. Die Sozialversicherungsreform hingegen wurde aufgrund der zahlreichen Vetoakteure und der starken verfassungsmäßigen Status-quo-Orientierung verzögert. Die Steuerreform scheiterte schließlich aufgrund des fehlenden politischen Willens und der Schwierigkeiten, die Bundesstaaten angemessen zu kompensieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wirtschaftsreformen, politische Institutionen, Entscheidungsfähigkeit, Veto-Spieler, Koalitionsbildung, Rekonstitutionalisierung, Privatisierung, Sozialversicherungsreform, Steuerreform, Brasilien, 1990er Jahre.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das politische System auf die Wirtschaftsreformen in Brasilien?
Das politische System Brasiliens, insbesondere die Verfassung von 1988, enthält sowohl Elemente der Entscheidungsunfähigkeit als auch starke Exekutivbefugnisse, die den Erfolg oder das Scheitern von Reformen maßgeblich beeinflussen.
Warum war die Privatisierung in Brasilien in den 1990er Jahren erfolgreich?
Der Erfolg der Privatisierung lag an einem starken Konsens innerhalb der Regierung, einer geringen Anzahl von Veto-Akteuren und der strategischen Nutzung von Rekonstitutionalisierung.
Welche Rolle spielen Veto-Akteure bei brasilianischen Reformprojekten?
Veto-Akteure können Reformen verzögern oder verhindern. Bei der Sozialversicherungsreform führten zahlreiche Veto-Akteure und eine starke Orientierung am Status quo zu erheblichen Verzögerungen.
Was ist das Gesetz der fiskalischen Verantwortung (LRF)?
Das im Jahr 2000 verabschiedete Gesetz stellt den Höhepunkt der fiskalischen Re-Zentralisierung dar und dient der Disziplinierung des Staatshaushalts in Brasilien.
Warum scheiterte die Steuerreform in Brasilien?
Die Steuerreform scheiterte primär am fehlenden politischen Willen und an der Schwierigkeit, die Bundesstaaten für ihre Einnahmeverluste angemessen zu kompensieren.
Wie steigerte die brasilianische Exekutive ihre Entscheidungsfähigkeit?
In den 1990er Jahren steigerte die Exekutive ihre Macht durch die Re-Zentralisierung des Bundeshaushalts und die Stärkung ihrer Koalitionsdisziplin im Kongress.
- Arbeit zitieren
- Dr. rer. pol. Andreas Hahn (Autor:in), 2013, Between Presidential Power and Legislative Veto: The Impact of Polity and Politics on Economic Reforms in Brazil, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231847