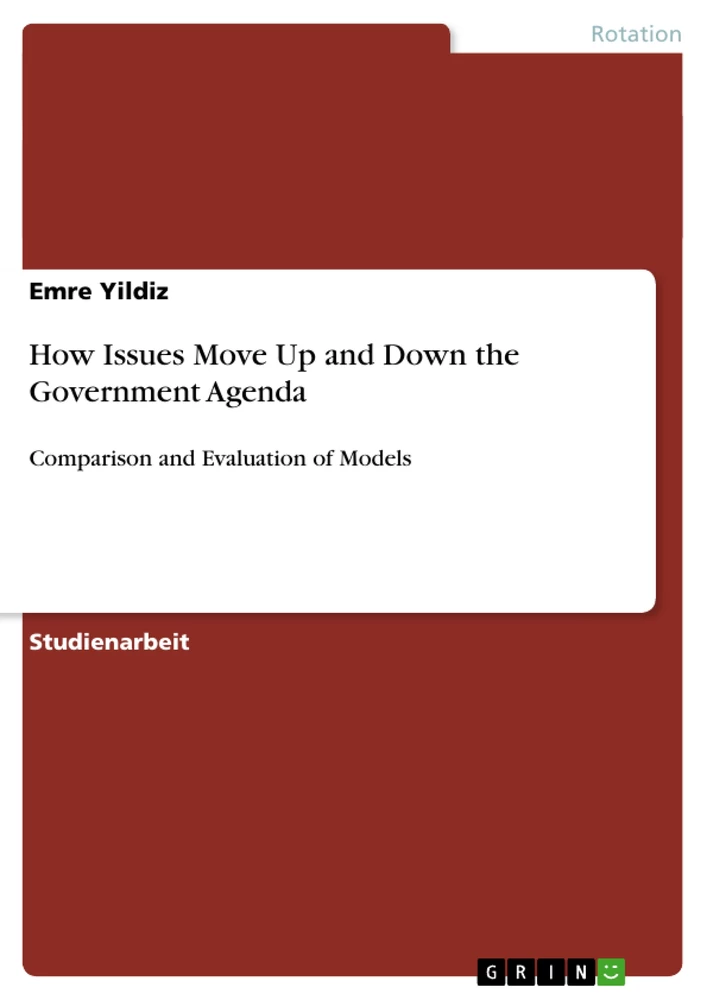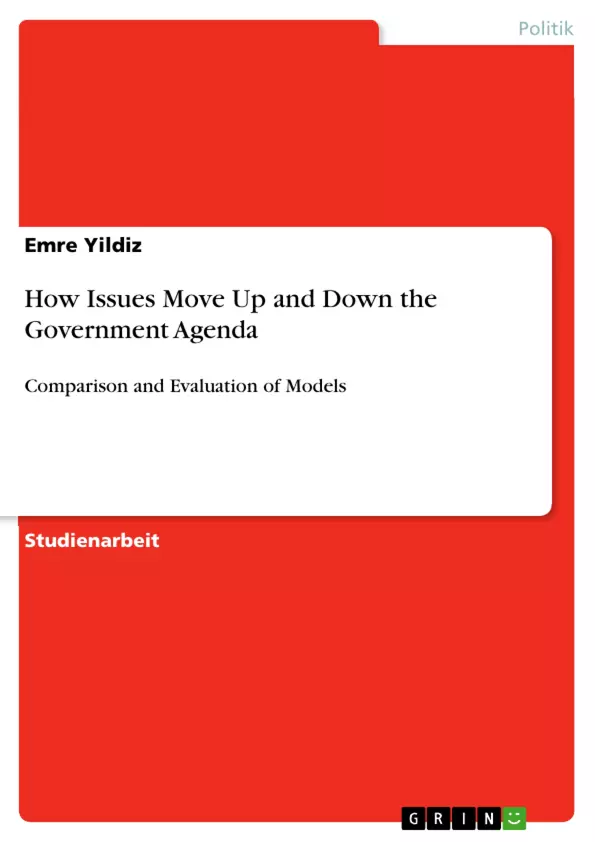(...) If policies are reactions to social problems, prior to action policymakers must determine what the most pressing issues are that deserve government attention. Policymakers are not only pushed by various interest groups, think tanks, and other organized constituents to pay attention to different issues, but are also in disagreement among each other regarding which issues merit space on the agenda (Dery, 2000, p. 39). The question therefore is: Who decides what a problem is and if it deserves government attention? And more importantly, how does policy agenda change and what role do policy actors play in this context?
This essay attempts to find an answer to these questions. It aims to explain why, for instance, child care in the US suddenly moved from relative obscurity to the government agenda (Nelson, 1984). Further, what was decisive for education to become a highly important agenda item in the same period when child care became high-profile? This essay will show that neither the pluralist, nor the iron triangle framework is able to provide a convincing explanation. It will argue that agenda setting is a political power struggle in a highly complex and dynamic process where the way an issue is defined and perceived by the public matters most for agenda changes. It will show that the subsystem theory, the advocacy coalition framework, and the punctuated equilibrium model do all contribute to our understanding of how issues move up and down the agenda. However, it is, as the paper argues, Kingdon's policy window and three streams building up on the other theories that has the most explanatory power and is the most rigorous theoretical framework.
The essay will first show in what way agenda setting is about political power. Secondly, it will turn to the early agenda-literature, the pluralist and the iron triangle frameworks. Thirdly, the essay will introduce Heclo's subsystems theory. In the fourth step, it will present Sabatier's Advocacy Coalition framework. After examining what Baumgartner and Jones put forward as "punctuated equilibrium", it will discuss Kingdon's policy window model and how it incorporates theoretical elements of the previous frameworks. In the end, the paper will give a conclusion.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Agenda Setting and Indirect Power
- Early literature on Agenda Setting: Pluralism and Iron Triangle Theory
- Subsystems Theory
- Advocacy Coalition
- Punctuated Equilibrium
- Garbage Can Model, and Policy Windows
- Conclusion
- Bibliography
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, wie Themen auf und von der politischen Agenda gelangen und welche Rolle verschiedene Akteure in diesem Prozess spielen. Dabei wird untersucht, wie die Definition und Wahrnehmung eines Themas durch die Öffentlichkeit seine Relevanz für die Politik beeinflusst. Der Essay analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Agenda-Setting, darunter den Pluralismus, die Iron-Triangle-Theorie, die Subsystems-Theorie, die Advocacy-Koalitions-Theorie, das Modell des punktuierten Gleichgewichts und das Policy-Window-Modell.
- Die Macht der Agenda-Setting und indirekte Macht
- Die Rolle von Akteuren und Interessengruppen
- Die Bedeutung der Definition und Wahrnehmung von Themen
- Stabilität und Wandel in der Agenda-Setting
- Die Bedeutung von Policy-Windows und der Konvergenz von Problem-, Politik- und Politikströmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Introduction: Der Essay stellt die Frage, wie Themen auf die politische Agenda gelangen und welche Rolle verschiedene Akteure dabei spielen. Er zeigt, dass die Definition und Wahrnehmung eines Themas durch die Öffentlichkeit entscheidend für seine Relevanz für die Politik ist.
- Agenda Setting and Indirect Power: Cobb und Elder definieren Agenda-Setting als einen Prozess, bei dem Themen zur aktiven und ernsthaften Betrachtung durch Entscheidungsträger gelangen. Sie erkennen an, dass die Aufmerksamkeit der Regierung auf bestimmte Probleme zu lenken, ein Akt der Machtausübung ist. Die Macht, die Agenda von Entscheidungsträgern zu beeinflussen, ist gleichbedeutend mit der Macht, zu bestimmen, was entschieden wird.
- Early literature on Agenda Setting: Pluralism and Iron Triangle Theory: Der pluralistische Ansatz betrachtet die Agenda-Setting als Ergebnis eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und Ideen. Die Iron-Triangle-Theorie argumentiert hingegen, dass ein unzerbrechliches Dreieck aus Kongress, Bürokratie und Interessengruppen die Agenda dominiert und Entscheidungen zum Nachteil des öffentlichen Interesses trifft.
- Subsystems Theory: Heclo kritisiert die Iron-Triangle-Theorie als unvollständig, da sie keine Erklärung für Veränderungen im politischen Prozess liefert. Er argumentiert, dass die Agenda-Setting durch fragmentierte Strukturen im politischen System geprägt ist, die es verschiedenen Akteuren ermöglichen, Einfluss auszuüben. Heclo führt die Begriffe "Issue Networks" und "Technopols" ein, um die komplexen Beziehungen zwischen Akteuren und Experten zu beschreiben.
- Advocacy Coalition: Sabatier erweitert Heclos Subsystems-Theorie und stellt das Konzept der Advocacy-Koalitionen vor. Diese bestehen aus Gruppen, die sich um ein bestimmtes Problem kümmern und gemeinsame Grundüberzeugungen teilen. Sabatier argumentiert, dass Veränderungen in der Agenda durch Prozesse des "policy-oriented learning" entstehen, bei denen Akteure ihre Ideen und Überzeugungen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse revidieren.
- Punctuated Equilibrium: Baumgartner und Jones argumentieren, dass die Agenda-Setting durch Phasen der Stabilität und des schnellen Wandels gekennzeichnet ist. Sie führen das Konzept des "punctuated equilibrium" ein, um diese Abläufe zu beschreiben. Sie argumentieren, dass Veränderungen in der Agenda durch die Redefinition von Themen und die Entstehung neuer Akteure in den politischen Subsystemen ausgelöst werden.
- Garbage Can Model, and Policy Windows: Kingdon baut auf den vorherigen Theorien auf und erweitert sie durch das Garbage-Can-Modell und das Policy-Window-Modell. Er argumentiert, dass die Agenda-Setting durch drei separate Ströme geprägt ist: Problem-, Politik- und Politikströme. Die Konvergenz dieser Ströme führt zu Policy-Windows, die es Akteuren ermöglichen, die Agenda zu beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Agenda-Setting, politische Macht, Interessengruppen, Policy-Prozesse, Subsysteme, Advocacy-Koalitionen, punktuiertes Gleichgewicht, Policy-Windows, Problem-, Politik- und Politikströme, sowie die Bedeutung der Definition und Wahrnehmung von Themen für die politische Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Agenda Setting"?
Agenda Setting ist der Prozess, durch den bestimmte Themen die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern gewinnen und zur aktiven politischen Bearbeitung gelangen.
Was ist das "Policy Window"-Modell von Kingdon?
Es beschreibt Gelegenheitsfenster, die entstehen, wenn Problem-, Politik- und Politikströme konvergieren, wodurch radikale Agenda-Änderungen möglich werden.
Was besagt die "Iron Triangle"-Theorie?
Sie geht davon aus, dass ein stabiles Dreieck aus Bürokratie, Kongressausschüssen und Interessengruppen die politische Agenda in bestimmten Bereichen dominiert.
Wie unterscheiden sich Advocacy-Koalitionen von anderen Gruppen?
Advocacy-Koalitionen bestehen aus Akteuren, die tief verwurzelte gemeinsame Überzeugungen teilen und über lange Zeiträume zusammenarbeiten, um Policies zu beeinflussen.
Was bedeutet "Punctuated Equilibrium" in der Politikwissenschaft?
Dieses Modell beschreibt Phasen langer politischer Stabilität, die durch kurze, heftige Phasen des Wandels unterbrochen werden.
- Arbeit zitieren
- Emre Yildiz (Autor:in), 2013, How Issues Move Up and Down the Government Agenda, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231992