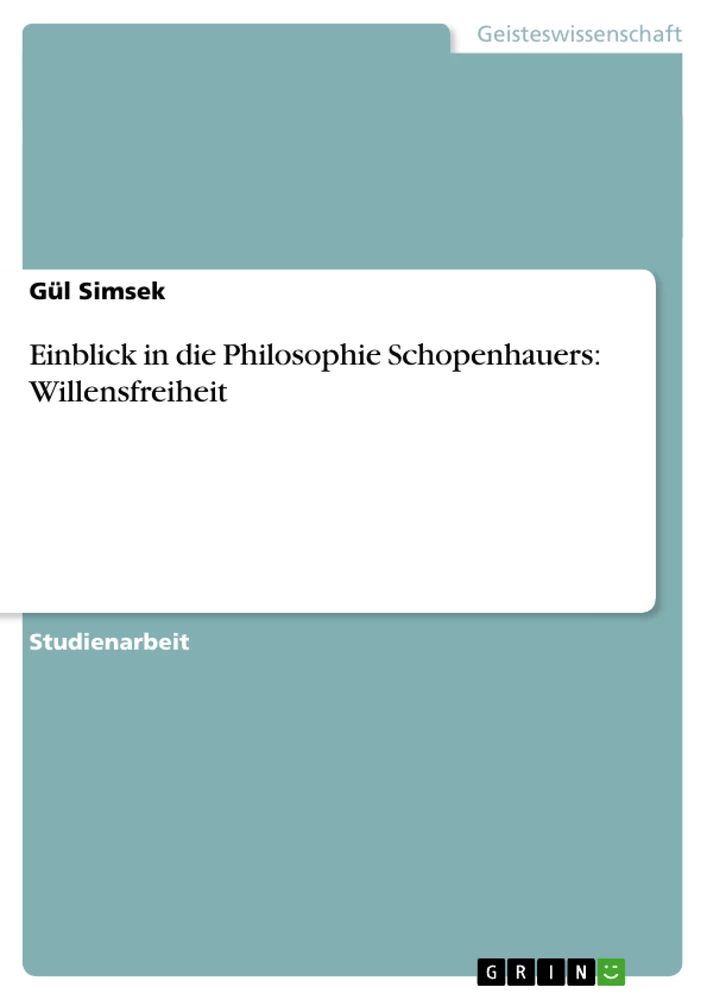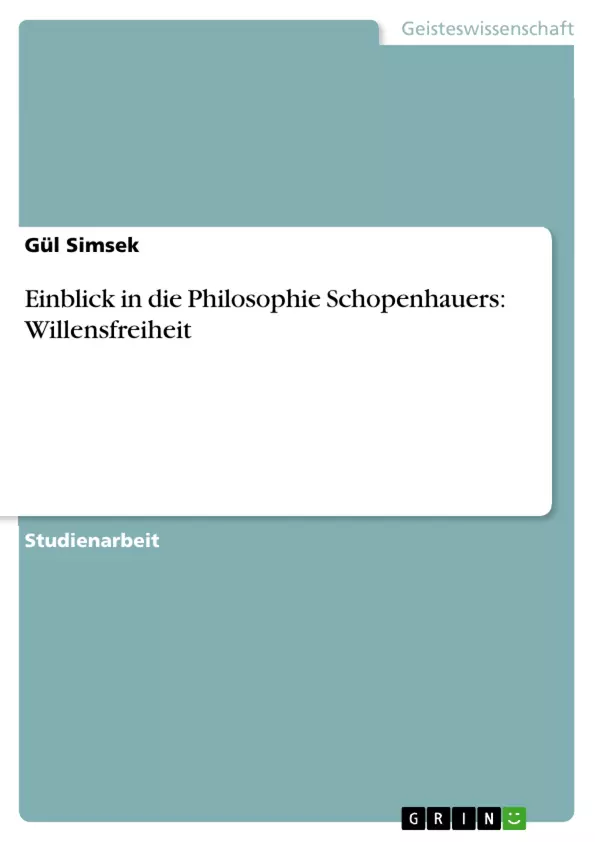Diese Arbeit soll einen Einblick in die Philosophie Schopenhauers geben. Dabei wird vor allem die Willensfreiheit betrachtet und die Frage untersucht, ob es im freien Willen des Menschen steht, seinen Charakter zu ändern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Freiheits- und Handlungsbegriff
- 3. Der freie Wille und der Charakter des Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Schopenhauers Philosophie im Hinblick auf die Willensfreiheit und die Möglichkeit der Charakteränderung. Sie beleuchtet Schopenhauers Leben und Werk, um seine Argumentation besser zu verstehen.
- Schopenhauers Freiheitsbegriff und seine drei Arten von Freiheit (physisch, intellektuell, moralisch)
- Der Zusammenhang zwischen Handlung, Wollen und Charakter bei Schopenhauer
- Die Rolle des Willens und des Selbstbewusstseins in Schopenhauers Philosophie
- Die Frage nach der Determiniertheit menschlichen Handelns
- Schopenhauers Auffassung von Kausalität und Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Kontext des Proseminars, in dem sie entstanden ist. Sie stellt Schopenhauers Philosophie im Allgemeinen vor, mit besonderem Fokus auf die Willensfreiheit und die Frage nach der Veränderbarkeit des Charakters. Die Einleitung betont die anfängliche Ablehnung und den späteren Einfluss Schopenhauers auf die Philosophie und verweist auf aktuelle hirnforschungsbasierte Erkenntnisse, die seine Position scheinbar stützen. Schließlich wird der Aufbau der Arbeit skizziert, der zunächst Schopenhauers Persönlichkeit beleuchtet, bevor er seine Philosophie zum Thema Willensfreiheit und Charakter behandelt.
2. Freiheits- und Handlungsbegriff: Dieses Kapitel analysiert Schopenhauers Verständnis von Freiheit als Abwesenheit von Hindernissen und unterscheidet zwischen physischer, intellektueller und moralischer Freiheit. Es diskutiert Missverständnisse bezüglich des Freiheitsbegriffs, indem es Kants Position kontrastiert und Schopenhauers Ansicht hervorhebt, dass der Mensch zwar nicht absolut frei ist, aber dennoch verantwortlich für seine Handlungen. Das Kapitel erklärt Schopenhauers Definition von Handlung als beobachtbare äußere Aktion und seine Auffassung von Kausalität, Motivation und Leiden als treibende Kräfte des menschlichen Handelns. Besonders wird auf die Unvereinbarkeit der moralischen Freiheit mit dem Kausalprinzip eingegangen und die Bedeutung des Mitleids als Grundlage von moralischem Handeln betont.
3. Der freie Wille und der Charakter des Menschen: Dieses Kapitel erörtert Schopenhauers These, dass der Mensch sich erst durch das Handeln für eine Handlung entscheidet. Es erläutert seine Unterscheidung zwischen Wille und Wollen, wobei der Wille als das „Ding an sich“ verstanden wird. Schopenhauers Auffassung vom Selbstbewusstsein als „Anschauungsvermögen“ wird vorgestellt und dessen Rolle bei der Beurteilung der Willensfreiheit. Der Unterschied zwischen Wünschen und Wollen wird herausgearbeitet, ebenso wie die Unterscheidung zwischen intelligentem und empirischem Charakter. Schlussendlich wird die Unveränderlichkeit des Charakters und die daraus resultierende moralische Verantwortlichkeit für die Handlungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Arthur Schopenhauer, Charakter, Handlung, Freiheit, Determinismus, Kausalität, Moral, Selbstbewusstsein, Wille, Mitleid, intelligibler Charakter, empirischer Charakter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schopenhauer: Willensfreiheit und Charakter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Schopenhauers Philosophie im Hinblick auf die Willensfreiheit und die Möglichkeit der Charakteränderung. Sie beleuchtet Schopenhauers Leben und Werk, um seine Argumentation besser zu verstehen und untersucht seine drei Arten von Freiheit (physisch, intellektuell, moralisch), den Zusammenhang zwischen Handlung, Wollen und Charakter, die Rolle des Willens und Selbstbewusstseins, Determiniertheit menschlichen Handelns, sowie Schopenhauers Auffassung von Kausalität und Motivation.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Vorstellung von Schopenhauers Philosophie mit Fokus auf Willensfreiheit und Charakterveränderung, Einordnung in den Kontext des Proseminars, aktuelle hirnforschungsbasierte Erkenntnisse und Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 (Freiheits- und Handlungsbegriff): Analyse von Schopenhauers Freiheitsbegriff (Abwesenheit von Hindernissen), Unterscheidung physischer, intellektueller und moralischer Freiheit, Kontrastierung mit Kants Position, Schopenhauers Definition von Handlung, Kausalität, Motivation und Leiden als Handlungsantriebe, Unvereinbarkeit moralischer Freiheit mit dem Kausalprinzip und die Rolle des Mitleids.
Kapitel 3 (Der freie Wille und der Charakter des Menschen): Schopenhauers These zur Handlungsentscheidung, Unterscheidung zwischen Wille und Wollen, Selbstbewusstsein als „Anschauungsvermögen“, Unterschied zwischen Wünschen und Wollen, intelligenter und empirischer Charakter, Unveränderlichkeit des Charakters und moralische Verantwortlichkeit.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind Willensfreiheit, Arthur Schopenhauer, Charakter, Handlung, Freiheit, Determinismus, Kausalität, Moral, Selbstbewusstsein, Wille, Mitleid, intelligibler Charakter und empirischer Charakter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Schopenhauers Philosophie hinsichtlich der Willensfreiheit und der Möglichkeit der Charakteränderung. Sie zielt darauf ab, Schopenhauers Argumentation durch die Beleuchtung seines Lebens und Werkes besser verständlich zu machen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den Kontext erläutert. Anschließend werden Schopenhauers Freiheits- und Handlungsbegriff analysiert. Das dritte Kapitel behandelt den freien Willen und den Charakter des Menschen im Kontext von Schopenhauers Philosophie. Schlüsselwörter werden abschließend zusammengefasst.
- Citar trabajo
- Gül Simsek (Autor), 2010, Einblick in die Philosophie Schopenhauers: Willensfreiheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231995