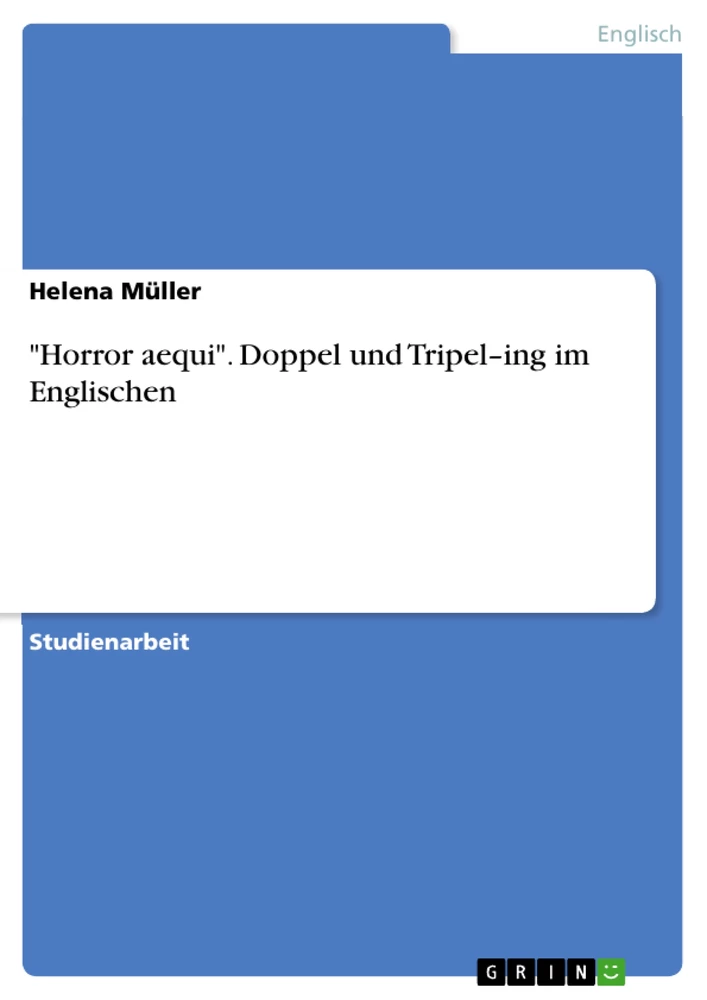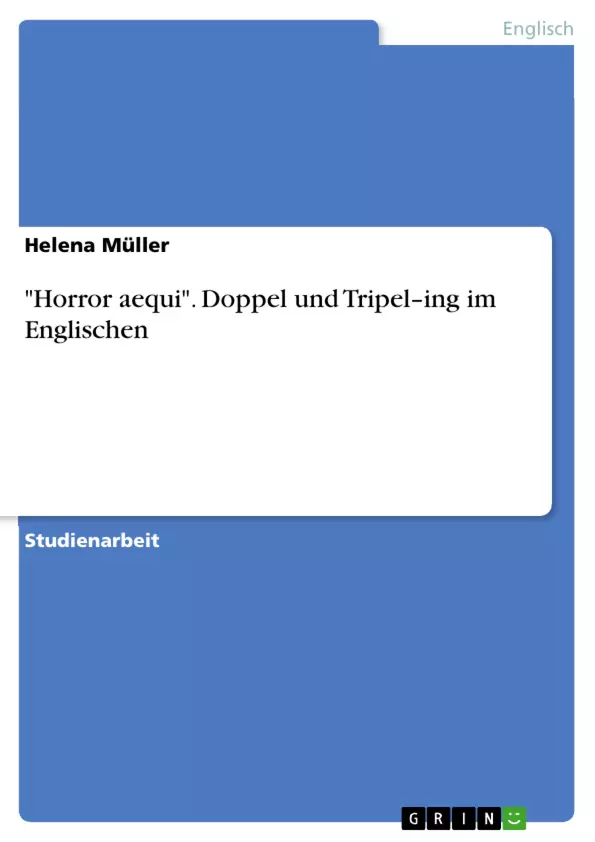Inhalt
1. Einführung 3
2. Die große Komplementverschiebung 4
3. Gerundien und Partizipien 5
4. Horror aequi als universelle Regel? – Die Entwicklung der Forschung 6
4.1 Ross 1972 7
4.2 Milsark 1972 10
4.3 Emonds 1973 11
4.4 Pullum 1974 12
4.5 Bolinger 1979 13
4.6 Milsark 1988 14
4.7 Pullum & Zwicky 1999 15
4.8 Rhodenburg 2003 15
4.9 Vosberg 2006 16
5. Zwischenfazit 16
6. Tripl-ing 17
7. Doubl-ing in der neuseeländischen Presse 18
7.1 Getrennte –ing Doppelungen 19
7.2 Non-verbale –ing Formen 20
7.3 Doubl-ing 20
7.3.1 Doubl-ing im Fernsehen 21
8. Fazit 21
9. Literaturverzeichnis 23
Horror aequi ist ein übereinzelsprachlicher Faktor, der die Aufteilung der Komplemente festlegt und die morpho-syntaktische Form des nachgeordneten (unterworfenen) Elements beeinflusst (Vosberg 2003: 315).
Im Deutschen wird die Aufeinanderfolge zweier identischer Formen durch eine veränderte Satzgliedstellung vermieden, wie an Satz (2) gesehen werden kann (Vosberg, 2006: 51).
(1) …it was thus pointless to attempt to analyse it. (ebd.)
(2) … es war daher zwecklos zu versuchen, es zu analysieren. (ebd.)
Horror aequi Effekte sind in Standard- sowie in Nichtstandard gleichermaßen anzutreffen (ebd.: 49). Tritt eine Doppelung von –ing Formen auf, so wird im Folgenden der Begriff Doubl-ing verwendet. Dieser geht auf Ross zurück, der 1972 erstmals eine Regel zur Einschränkung der –ing Doppelung auf einer rein formalen Grundlage entworfen hat.
In der englischen Sprache beeinflusst horror aequi nicht nur die in dieser Arbeit untersuchte Doppelung von –ing Formen, sondern zeigt auch eine Abneigung gegenüber nicht-koordinierten to-Infinitiven (Vosberg, 2006, 41) und der Wiederholung gleichartiger Wörter aus verschiedenen Klassen. Letzteres wird intuitiv durch synonyme Ausdrücke behoben (ebd.), wie in (3) zu sehen ist.
(3) You didn’t have to assert it so positively /*assertively. (ebd.)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die große Komplementverschiebung
- 3. Gerundien und Partizipien
- 4. Horror aequi als universelle Regel? – Die Entwicklung der Forschung
- 4.1 Ross 1972
- 4.2 Milsark 1972
- 4.3 Emonds 1973
- 4.4 Pullum 1974
- 4.5 Bolinger 1979
- 4.6 Milsark 1988
- 4.7 Pullum & Zwicky 1999
- 4.8 Rhodenburg 2003
- 4.9 Vosberg 2006
- 5. Zwischenfazit
- 6. Tripl-ing
- 7. Doubl-ing in der neuseeländischen Presse
- 7.1 Getrennte -ing Doppelungen
- 7.2 Non-verbale -ing Formen
- 7.3 Doubl-ing
- 7.3.1 Doubl-ing im Fernsehen
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Prinzip des „horror aequi“ im Englischen, insbesondere im Bezug auf die Vermeidung von -ing-Doppelungen. Ziel ist es, die Entwicklung der Forschung zu diesem Phänomen darzustellen und die Anwendung von „Doubl-ing“ in konkreten Beispielen aus der neuseeländischen Presse zu analysieren.
- Entwicklung des Horror-aequi-Prinzips in der linguistischen Forschung
- Die „Große Komplementverschiebung“ und ihre Auswirkungen auf die -ing-Form
- Unterscheidung zwischen Gerundien und Partizipien
- Analyse von -ing-Doppelungen (Doubl-ing) in der neuseeländischen Presse
- Verwendung von Doubl-ing im Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema „horror aequi“ ein, beschreibt es als eine Abneigung gegen die Wiederholung gleicher oder ähnlicher grammatischer Formen und erläutert seine Anwendung auf die Vermeidung von -ing-Doppelungen im Englischen. Der Begriff „horror aequi“, zu Deutsch „Angst vor dem Gleichen“, wird in seinen historischen Kontext eingeordnet und seine Bedeutung für die morpho-syntaktische Gestaltung von Sätzen verdeutlicht. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und ihre Zielsetzung: die Beschreibung des horror-aequi-Prinzips im Zusammenhang mit -ing-Formen und die Analyse von -ing-Doppelungen in der neuseeländischen Presse sowie im Fernsehen.
2. Die große Komplementverschiebung: Dieses Kapitel beschreibt die „Große Komplementverschiebung“ (The Great Complement Shift), einen diachronen Wandel in der Verwendung von Komplementen im Englischen. Es wird die graduelle Veränderung der Grundsätze der Komplementauswahl über die letzten 300 Jahre dargestellt, wobei die Entwicklung von der Bevorzugung von to-Infinitiven hin zur -ing-Form im Fokus steht. Die Bedeutung des horror-aequi-Prinzips als außersemantischer Faktor, der die Verteilung struktureller Varianten beeinflusst, wird hervorgehoben. Das Kapitel erläutert, wie das Prinzip in verschiedenen Umgebungen wirkt, indem es die Auswahl zwischen to-Infinitiv und -ing-Form in Abhängigkeit vom Kontext erklärt. Trotz der Verschiebung wird die Möglichkeit von Doppelungen von to-Infinitiven oder -ing-Formen angesprochen, was den Übergang zum nächsten Kapitel vorbereitet.
3. Gerundien und Partizipien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Gerundien und Partizipien als zwei mögliche Realisierungen der -ing-Form. Es legt die Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Funktionen und syntaktischen Eigenschaften dieser Formen im Kontext des horror aequi. Obwohl der Text hier abrupt endet, ist klar, dass dieser Abschnitt die grammatikalischen Grundlagen für die Analyse der -ing-Doppelungen in den folgenden Kapiteln liefern soll.
Schlüsselwörter
Horror aequi, -ing-Formen, Gerundium, Partizip, Komplementverschiebung, Doubl-ing, neuseeländische Presse, englische Grammatik, morpho-syntaktische Strukturen.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Horror aequi und -ing-Doppelungen"
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich mit dem linguistischen Prinzip des „horror aequi“ im Englischen, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von -ing-Doppelungen. Er untersucht die Entwicklung der Forschung zu diesem Thema und analysiert die Anwendung von „Doubl-ing“ (Doppelungen von -ing-Formen) in Beispielen aus der neuseeländischen Presse und dem Fernsehen.
Welche Aspekte werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Aspekte: Die „Große Komplementverschiebung“ und ihren Einfluss auf die Verwendung von -ing-Formen, die Unterscheidung zwischen Gerundien und Partizipien, die Entwicklung des „horror aequi“-Prinzips in der linguistischen Forschung (mit Bezug auf verschiedene Linguisten wie Ross, Milsark, Emonds, Pullum, Bolinger, und andere), sowie die detaillierte Analyse von -ing-Doppelungen in der neuseeländischen Presse und im Fernsehen.
Welche Linguisten werden im Text erwähnt und was sind ihre Beiträge?
Der Text erwähnt mehrere Linguisten und deren Beiträge zur Erforschung des „horror aequi“-Prinzips und der -ing-Formen. Genannt werden unter anderem Ross (1972), Milsark (1972, 1988), Emonds (1973), Pullum (1974), Bolinger (1979), Pullum & Zwicky (1999), Rhodenburg (2003) und Vosberg (2006). Ihre Arbeiten werden in Kapitel 4 chronologisch dargestellt und beleuchten die Entwicklung des Verständnisses von „horror aequi“ im Laufe der Zeit.
Was ist die „Große Komplementverschiebung“?
Die „Große Komplementverschiebung“ (The Great Complement Shift) beschreibt einen diachronen Wandel in der Verwendung von Komplementen im Englischen. Sie beinhaltet die graduelle Veränderung der Grundsätze der Komplementauswahl über die letzten 300 Jahre, wobei die Entwicklung von der Bevorzugung von to-Infinitiven hin zur -ing-Form im Fokus steht. Dieser Wandel wird im Text im Kontext des „horror aequi“ erläutert.
Wie werden Gerundien und Partizipien im Text unterschieden?
Kapitel 3 befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Gerundien und Partizipien als zwei mögliche Realisierungen der -ing-Form. Es legt die grammatikalischen Grundlagen für das Verständnis der unterschiedlichen Funktionen und syntaktischen Eigenschaften dieser Formen im Kontext des „horror aequi“, was für die Analyse der -ing-Doppelungen in den folgenden Kapiteln unerlässlich ist. Leider ist dieser Abschnitt unvollständig im vorliegenden Auszug.
Was ist „Doubl-ing“ und wo wird es analysiert?
„Doubl-ing“ bezeichnet die Verwendung von -ing-Doppelungen im Englischen. Der Text analysiert „Doubl-ing“ insbesondere in Beispielen aus der neuseeländischen Presse (Kapitel 7) und bezieht auch die Anwendung im Fernsehen mit ein (Kapitel 7.3.1).
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Schlüsselwörter des Textes sind: Horror aequi, -ing-Formen, Gerundium, Partizip, Komplementverschiebung, Doubl-ing, neuseeländische Presse, englische Grammatik, morpho-syntaktische Strukturen.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die Entwicklung der Forschung zum „horror aequi“-Prinzip darzustellen und die Anwendung von „Doubl-ing“ in konkreten Beispielen aus der neuseeländischen Presse zu analysieren. Es soll ein umfassendes Verständnis des „horror aequi“ im Zusammenhang mit -ing-Formen vermittelt werden.
- Citar trabajo
- Helena Müller (Autor), 2012, "Horror aequi". Doppel und Tripel–ing im Englischen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232054