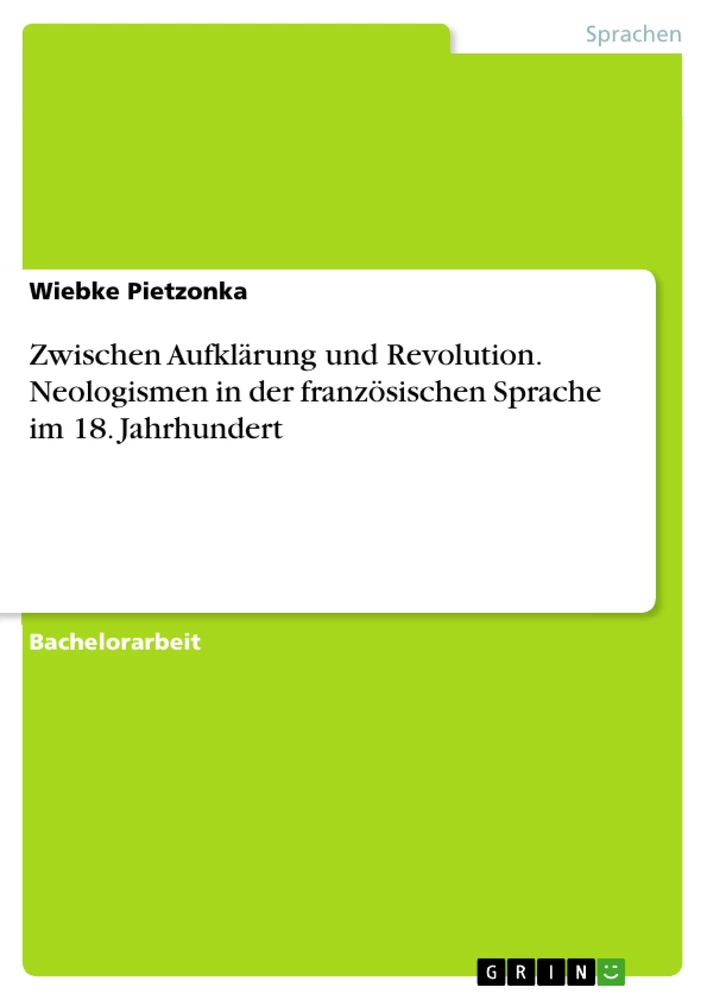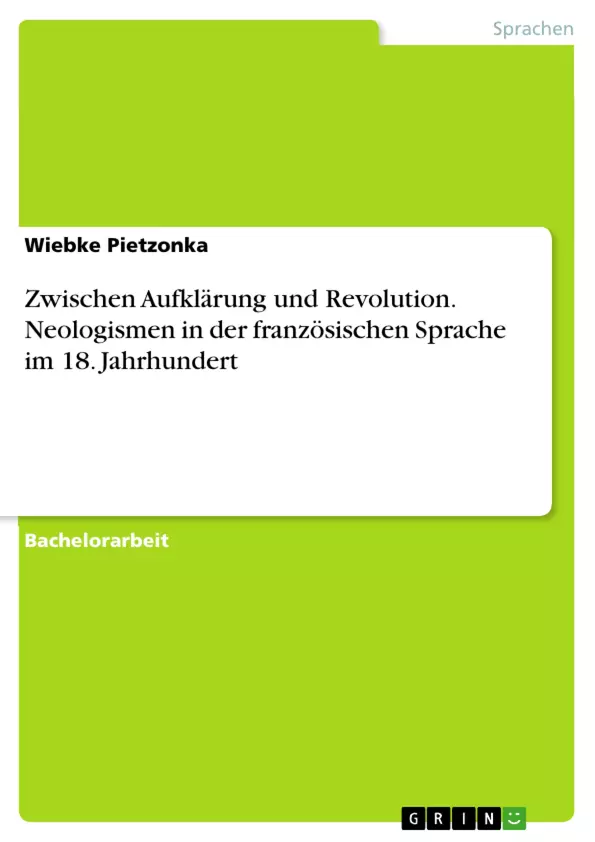Welcher Zusammenhang besteht zwischen den zeithistorischen Ereignissen und geistigen Strömungen im 18. Jahrhundert in Frankreich und den Neologismen, die in diesem Zeitraum entstanden beziehungsweise in die französische Sprache aufgenommen wurden? Inwiefern spiegeln diese den damaligen Zeitgeist wider? Welche neuen Inhalte kamen in jenem Jahrhundert auf, die durch neue Wörter bezeichnet wurden? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit geklärt werden.
Im ersten Teil soll die Basis für die Untersuchung der Neologismen in der französischen Sprache im 18. Jahrhundert, die den Hauptteil dieser Arbeit darstellt, geschaffen werden. Dazu werden die bedeutendsten Aspekte und Einflüsse dargestellt, die für das Französische in diesem Zeitraum kennzeichnend sind. Hier soll zunächst auf seinerzeitige sprachtheoretische Hintergründe und Entwicklungen eingegangen und diese in Bezug zum Thema dieser Arbeit gesetzt werden.
Ausgehend davon wird dann die Thematik der seinerzeitigen Normdebatten besprochen. Hierbei wird der Fokus vor allem auf der Neologien- und Wortmissbrauchskontroverse liegen, da diese von besonderer Relevanz für das zentrale Thema dieser Arbeit sind.
An die Betrachtung der Verbreitung und allgemeinen Bedeutung der französischen Sprache im 18. Jahrhundert in Europa schließt sich dann der Hauptteil an. Neben der Klärung des Begriffs Neologismen ist dieser in zwei große Thematiken gegliedert.
Zunächst wird die externe Bereicherung des französischen Wortschatzes durch Lehnwörter im Zuge der Aufklärung beleuchtet, wobei hier die Anglizismen ob ihrer besonderen Bedeutung hervorgehoben werden sollen. Des Weiteren wird die interne Wortschatzbereicherung während der Französischen Revolution besprochen.
In welchen Bereichen des politischen und gesellschaftlichen Lebens wurden in diesem Zeitraum neue Wörter eingeführt und warum? Was waren die produktivsten Wortbildungsprozesse hierfür?
Im abschließenden Fazit sollen die eingangs formulierten Fragen beantwortet sowie der Charakter und die Bedeutung von Neologismen in der französischen Sprache im 18. Jahrhundert noch einmal herausgestellt werden.
Inhalt
I. Einleitung
II. Die französische Sprache im 18. Jahrhundert
1. Sprachtheoretische Hintergründe und Entwicklungen
2. Neologienstreit und abus des mots – Normdebatten im 18. Jahrhundert
3. Die französische Sprache im europäischen Kontext
III. Neologismen in der französischen Sprache im 18. Jahrhundert
1. Neologismen – eine Begriffsklärung
2. Neologismen in der Sprache der französischen Aufklärung
2.1 Einflüsse der Aufklärungsbewegung auf die französische Sprache
2.2 Entlehnungen als charakteristische Neologismen während der Aufklärungsbewegung
2.2.1 Anglizismen
2.2.2 Entlehnungen aus weiteren Sprachen
3. Zwischenfazit
4. Neologismen in der Sprache der Französischen Revolution
4.1 Sprache und Sprachpolitik während der Revolution
4.2 Sprachinterne Neubildungen als charakteristische Neologismen der Französischen Revolution
4.2.1 Neologismen für politische Strömungen und deren Anhänger
4.2.2 Neologismen für politische Extreme und Gegenbewegungen
4.2.3 Neologismen im staatlich-parlamentarischen Bereich
4.2.4 Neologismen für Verwaltungs- und Maßeinheiten
4.2.5 Neologismen des Revolutionskalenders
IV. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die Aufklärung auf die französische Sprache?
Die Aufklärung führte zu einer massiven Erweiterung des Wortschatzes, insbesondere durch Entlehnungen aus dem Englischen (Anglizismen) in den Bereichen Politik, Philosophie und Wissenschaft.
Was war der "Neologienstreit" im 18. Jahrhundert?
Es war eine Debatte zwischen Sprachpuristen, die die Reinheit des Französischen bewahren wollten, und Befürwortern neuer Wörter (Neologismen), die die Sprache an neue gesellschaftliche Realitäten anpassen wollten.
Wie veränderte die Französische Revolution den Wortschatz?
Die Revolution schuf Begriffe für neue politische Institutionen, Maßeinheiten (metrisches System) und den Revolutionskalender, um sich radikal von der Sprache des Ancien Régime abzugrenzen.
Was versteht man unter "abus des mots" (Wortmissbrauch)?
Dieser Begriff aus der Aufklärung bezeichnete die Kritik an unpräzisen oder ideologisch aufgeladenen Begriffen, die das klare Denken und die gesellschaftliche Vernunft behinderten.
Welche Rolle spielten Anglizismen im 18. Jahrhundert in Frankreich?
Aufgrund der Bewunderung für das britische parlamentarische System wurden viele Begriffe wie "budget", "club" oder "vote" ins Französische übernommen.
- Quote paper
- Wiebke Pietzonka (Author), 2012, Zwischen Aufklärung und Revolution. Neologismen in der französischen Sprache im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232082