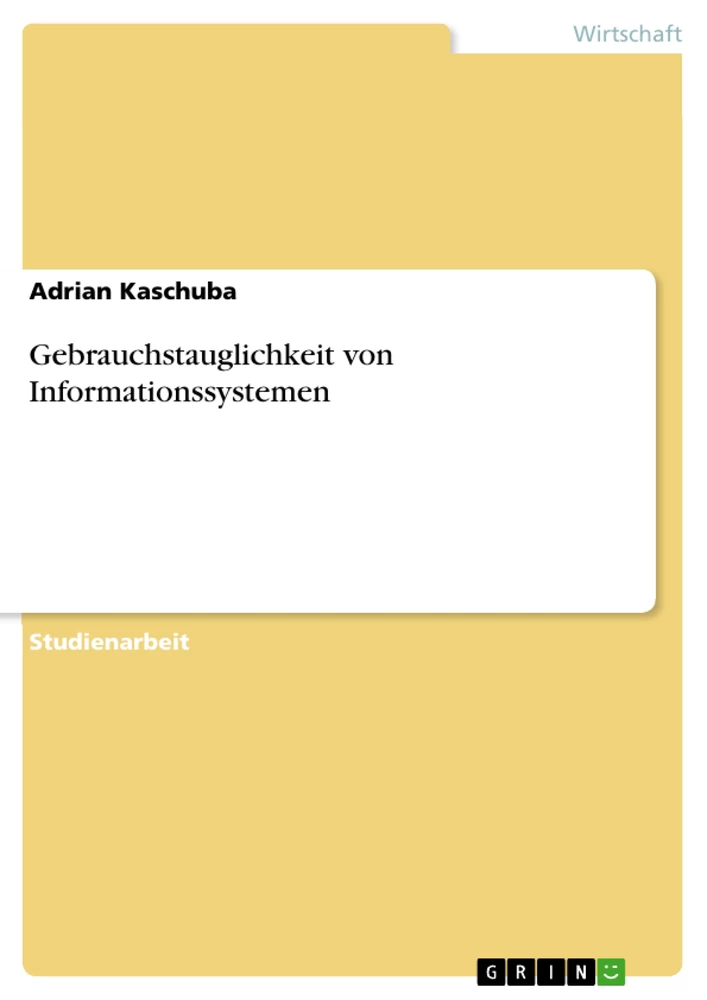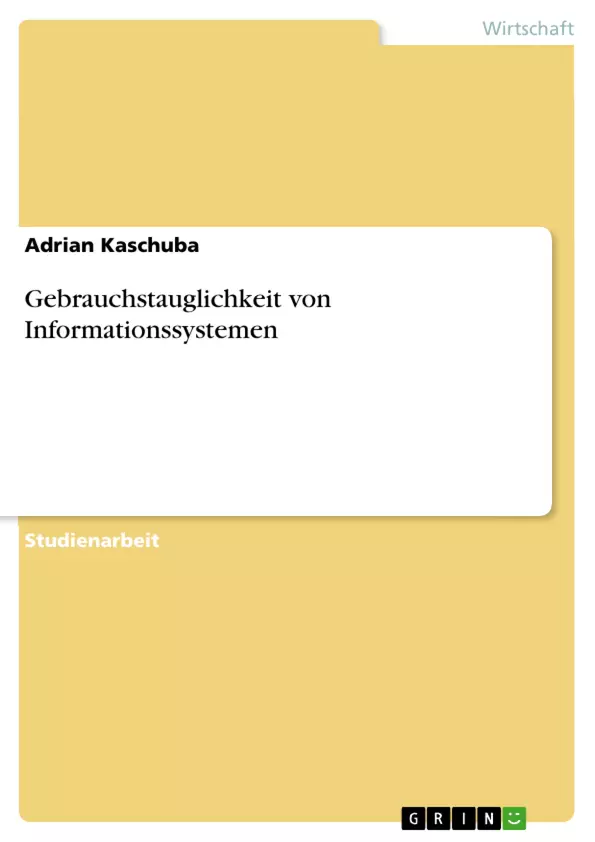Für die ersten Entwicklungen von Programmen und Computern, spielte die Gebrauchstauglichkeit absolut keine Rolle. Damals war der Nutzer meist auch der Entwickler der Programme, oder bediente diese mit Hilfe seines vorhandenen Fachwissens. Das Hauptaugenmerk bei der Programmentwicklung lag, bis in die 60er Jahre hinein, in der Systemfunktionalität und Rechenzeit. Denn diese war deutlich teurer als die Arbeitszeit der Anwender.
Licklider beschrieb in seinem berühmten Artikel von 1960 „Man-Computer symbiosis“ die unterschiedlichen Datenverarbeitungsarten von Menschen und Maschinen und versuchte Lösungen zu finden, um die Zusammenarbeit enger und leichter zu gestalten. Sein Ziel war es, die Arbeit mit dem Computer auch Menschen zu ermöglichen, die weder Entwickler der Maschine oder Programmierer mit Fachwissen sind. Jedoch wurde damals die Notwendigkeit zur einfachen Nutzung, beispielsweise über grafische Oberflächen, nur von wenigen gesehen, sodass es noch bis in die 80er Jahre dauern sollte, bis die Programme von jedem Benutzer bedient werden konnten.
Heutzutage ist beinahe jeder täglich mit einem Computer in Interaktion. Sei es privat oder beruflich. Firmen achten daher beim Kauf von Software auf eine intuitive Oberfläche um dadurch die Fehleranfälligkeit oder notwendige Schulungen zu verringern. Im privaten Bereich kommt es auf eine einfache Bedienung von Internetseiten, beispielsweise beim Kauf von Produkten an, sowie auf einen simplen Aufbau des gesamten Systems. Der Laiennutzer möchte sich nicht mit den Eigenheiten seines Computers auseinandersetzten, sondern diesen bloß benutzen und leicht die gewünschten Ergebnisse erzielen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorgehensweise
- 2 Grundlagen
- 2.1 Definition Gebrauchstauglichkeit nach Teil 10 und 110 der ISO-Norm
- 2.2 Die acht goldenen Regeln nach Ben Shneiderman
- 2.2.1 Überschneidungen und Abweichungen zur ISO-Norm
- 2.3 Fünf Punkte von Gebrauchstauglichkeit nach Jakob Nielsen
- 2.3.1 Überschneidungen und Abweichungen zur ISO-Norm
- 3 Entwicklung
- 3.1 Anforderungsanalyse
- 3.2 Produktivitätssteigerung durch Usability Management
- 3.3 Schulungen
- 3.4 Optimierungen im Echtbetrieb
- 4 Fazit
- 5 Literaturverzeichnis
- 5.1 Normen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Gebrauchstauglichkeit von Informationssystemen. Das Hauptziel ist es, die Grundlagen der Gebrauchstauglichkeit zu erläutern und deren Bedeutung für die Entwicklung ergonomischer Software aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts und die damit verbundene Produktivitätssteigerung.
- Definition und Entwicklung des Begriffs "Gebrauchstauglichkeit"
- ISO-Normen und etablierte Regeln zur Usability (Shneiderman, Nielsen)
- Einfluss von Gebrauchstauglichkeit auf die Produktivität
- Methoden zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit in der Softwareentwicklung
- Zusammenhang zwischen Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die historische Entwicklung der Bedeutung von Gebrauchstauglichkeit in der Softwareentwicklung. Anfangs spielte die Benutzerfreundlichkeit eine untergeordnete Rolle, da Entwickler und Nutzer oft identisch waren. Erst mit Lickliders Arbeit "Man-Computer symbiosis" (1960) wurde die Notwendigkeit einer einfacheren Bedienung für Nicht-Fachleute erkannt. Die heutige Bedeutung von intuitiven Oberflächen für Unternehmen und Privatnutzer wird hervorgehoben. Die Arbeit selbst wird kurz skizziert.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Gebrauchstauglichkeit dar. Es werden Definitionen und Standards aus der ISO-Norm sowie die "acht goldenen Regeln" von Ben Shneiderman und die "fünf Punkte" von Jakob Nielsen vorgestellt und miteinander verglichen. Die Überschneidungen und Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen werden analysiert, um ein umfassendes Verständnis der Grundlagen der Gebrauchstauglichkeit zu schaffen.
3 Entwicklung: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Entwicklungsprozess ergonomischer Software. Es wird die Anforderungsanalyse, die Produktivitätssteigerung durch Usability Management, die Bedeutung von Schulungen und die Optimierung im Echtbetrieb beleuchtet. Die verschiedenen Aspekte des Entwicklungsprozesses werden detailliert erklärt und ihr Beitrag zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Phasen wird aufgezeigt und deren Bedeutung für das Endprodukt erläutert.
Schlüsselwörter
Gebrauchstauglichkeit, Usability, Informationssysteme, ISO-Normen, Ben Shneiderman, Jakob Nielsen, Produktivitätssteigerung, Ergonomie, Softwareentwicklung, Benutzerfreundlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Gebrauchstauglichkeit von Informationssystemen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Gebrauchstauglichkeit (Usability) von Informationssystemen. Sie untersucht die Grundlagen der Usability, deren Bedeutung für die Entwicklung ergonomischer Software und den Einfluss auf die Produktivitätssteigerung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die theoretischen Grundlagen mit Definitionen und Standards (ISO-Normen, Shneiderman's acht goldene Regeln, Nielsens fünf Punkte), einen Überblick über den Entwicklungsprozess ergonomischer Software und ein Fazit. Ein Literaturverzeichnis mit Normen ist ebenfalls enthalten.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Entwicklung des Begriffs "Gebrauchstauglichkeit", ISO-Normen und etablierte Regeln zur Usability (Shneiderman, Nielsen), den Einfluss von Gebrauchstauglichkeit auf die Produktivität, Methoden zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit in der Softwareentwicklung und den Zusammenhang zwischen Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (historische Entwicklung der Usability), Grundlagen (Definitionen und Standards), Entwicklung (Anforderungsanalyse, Produktivitätssteigerung durch Usability Management, Schulungen, Optimierungen im Echtbetrieb), Fazit und Literaturverzeichnis (inkl. Normen).
Welche Definitionen und Standards zur Gebrauchstauglichkeit werden behandelt?
Die Arbeit erläutert Definitionen und Standards aus der ISO-Norm, vergleicht und analysiert die "acht goldenen Regeln" von Ben Shneiderman und die "fünf Punkte" von Jakob Nielsen, wobei Überschneidungen und Unterschiede herausgearbeitet werden.
Wie wird der Entwicklungsprozess ergonomischer Software beschrieben?
Das Kapitel "Entwicklung" beleuchtet detailliert die Anforderungsanalyse, die Produktivitätssteigerung durch Usability Management, die Bedeutung von Schulungen und die Optimierung im Echtbetrieb. Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Phasen und deren Bedeutung für das Endprodukt wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Gebrauchstauglichkeit, Usability, Informationssysteme, ISO-Normen, Ben Shneiderman, Jakob Nielsen, Produktivitätssteigerung, Ergonomie, Softwareentwicklung, Benutzerfreundlichkeit.
Was ist das Hauptziel der Seminararbeit?
Das Hauptziel ist die Erläuterung der Grundlagen der Gebrauchstauglichkeit und die Darstellung ihrer Bedeutung für die Entwicklung ergonomischer Software sowie die Aufzeigen der damit verbundenen Produktivitätssteigerung.
Welche Bedeutung hat die historische Entwicklung der Usability?
Die Einleitung beschreibt die historische Entwicklung, beginnend mit der geringen Bedeutung der Benutzerfreundlichkeit, da Entwickler und Nutzer oft identisch waren, bis hin zur heutigen Bedeutung intuitiver Oberflächen durch Lickliders Arbeit "Man-Computer symbiosis" (1960).
- Arbeit zitieren
- Adrian Kaschuba (Autor:in), 2012, Gebrauchstauglichkeit von Informationssystemen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232144