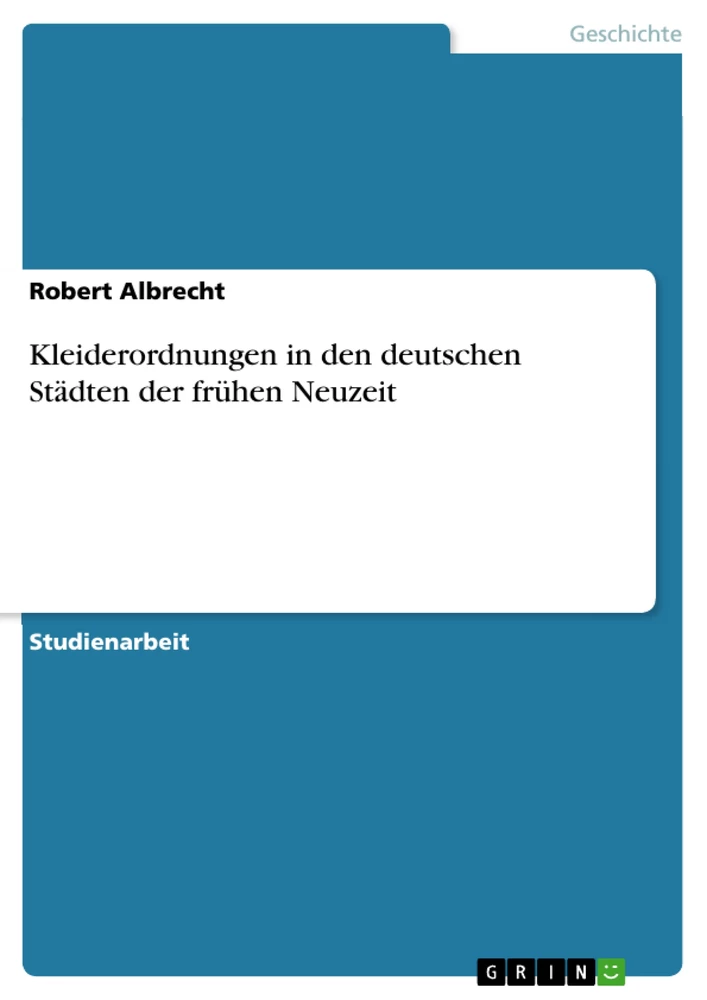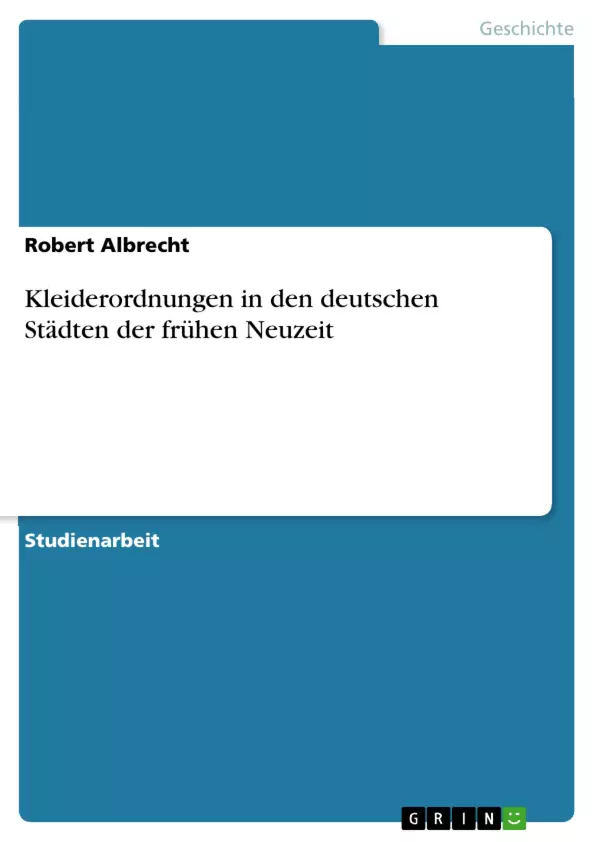Thema der vorliegenden Hausarbeit sind die deutschen Kleiderordnungen im 16. und 17. Jahrhundert. „Kleiderordnungen sind Verfügungen einer Obrigkeit über die Kleidungen ihrer Untertanen. Sie wollen auf die Kleidung Einfluß nehmen, weil diese nicht nur Geschmack oder Reichtum eines Menschen anzeigen kann, sondern auch seinen sozialen Standort repräsentiert und manchmal sein sittliches
Wesen offenbart.“(1) Die Hausarbeit bemüht sich die Kleiderordnungen als Instrument und Ausdruck der Denkweisen dieser Obrigkeiten in der frühen Neuzeit zu sehen. Kleiderordnungen tauchen mit der Durchsetzung der Herrschaft der Territorialherren ab dem Ende des 15. Jahrhunderts vermehrt auf. Zunächst sind sie Teil von Polizeiordnungen, später auch selbstständig doch stets im Zusammenhang mit dem Begriff der „Polizei.“ „Unter Policey verstand der frühmoderne Staat noch nicht die Institution, die für innere Sicherheit zuständig war, sondern den ganzen Komplex der Verwaltung, Ökonomie und Ordnung einer Herrschaft.“(2)
Angelegenheiten der Polizei sind alle Dinge, die zur Ordnung des Gemeinwesens gehören und damit auch die Ordnung der Kleidung. Das Wohl des Einzelnen wird dem Wohl der Gemeinschaft untergeordnet.
[...]
______
1 Eisenbart, Liselotte Constanze: Kleiderordnungen der deutschen Städte zwis chen 1350 und 1700. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen Bürgertums. Göttingen/ Berlin/ Frankfurt 1962.
2 Van Dülmen, Richard: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Bd. 2: Dorf und Stadt im 16. bis 18. Jahrhundert. München 1992. S. 223.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchung der deutschen Kleiderordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts nach formalen Gesichtspunkten
- Verbreitung und Überlieferung
- Innere und äußere Gliederung
- Äußere Gliederung
- Innere Gliederung
- Rechtssatz und Rechtsverständnis in den Kleiderordnungen
- Abfassung, Publikation und Durchsetzung der Kleiderordnungen
- Betrachtung der Kleiderordnungen unter Berücksichtigung von Motivation und Intention der Gesetzgeber
- Kleiderordnungen als Ausdruck und Instrument ständischen Denkens
- Kleiderordnungen als Ausdruck wirtschaftlichen Denkens
- Kleiderordnungen als Ausdruck von Sittlichkeitsgefühl
- Weitere Motive
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht deutsche Kleiderordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie analysiert die Kleiderordnungen als Ausdruck und Instrument der Denkweise der damaligen Obrigkeiten in der frühen Neuzeit. Die Arbeit analysiert die Kleiderordnungen nach formalen Kriterien und untersucht die Motive und Intentionen der erlassenden Instanzen.
- Analyse der Kleiderordnungen nach formalen Gesichtspunkten, wie Verbreitung, Überlieferung, Aufbau und Rechtssatz
- Untersuchung der Motive und Intentionen der Gesetzgeber, wie ständisches Denken, wirtschaftliches Denken und Sittlichkeitsgefühl
- Beleuchtung der Rolle von Kleiderordnungen als Instrument und Ausdruck der damaligen Machtverhältnisse
- Vermittlung eines umfassenden Einblicks in die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe der Kleiderordnungen
- Bedeutung von Kleiderordnungen für die soziale Ordnung und die Kontrolle von Verhaltensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und definiert den Begriff der Kleiderordnungen im Kontext der frühen Neuzeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Kleiderordnungen und ihren Bezug zur "Polizei" im Sinne der damaligen Verwaltung.
Das erste Kapitel analysiert Kleiderordnungen nach formalen Gesichtspunkten, wie Verbreitung, Überlieferung, Aufbau und Rechtssatz. Es beleuchtet die Entwicklung der Kleiderordnungen von ihren Anfängen im 13. Jahrhundert bis zur Verbreitung im 16. und 17. Jahrhundert.
Das zweite Kapitel betrachtet die Kleiderordnungen unter Berücksichtigung der Motivationen und Intentionen der Gesetzgeber. Es untersucht, wie Kleiderordnungen als Ausdruck von ständischem Denken, wirtschaftlichem Denken und Sittlichkeitsgefühl eingesetzt wurden.
Schlüsselwörter
Kleiderordnungen, frühmoderne Gesellschaft, ständische Gesellschaft, Polizei, Verwaltung, Recht, Mode, soziale Kontrolle, Wirtschaft, Sittlichkeit, Moral, Deutschland, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert
- Quote paper
- Robert Albrecht (Author), 2000, Kleiderordnungen in den deutschen Städten der frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2322