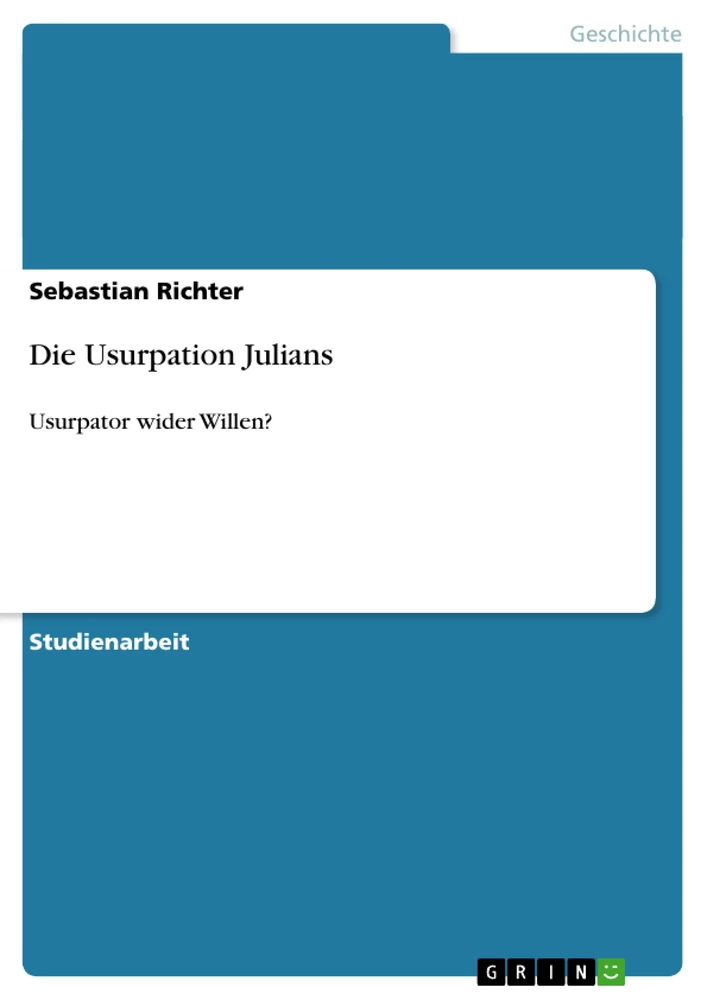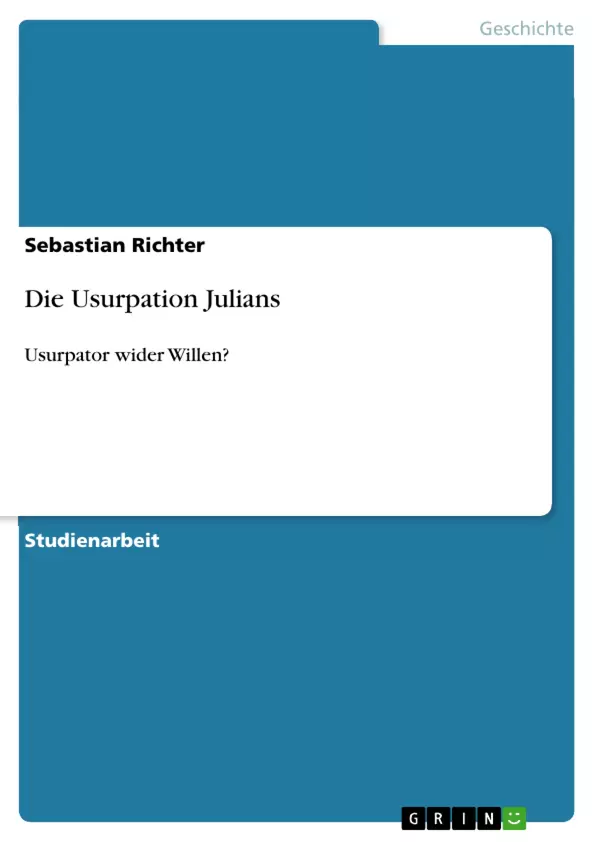Anfang Februar des Jahres 360 n. Chr. wurde der von Kaiser Constantius II. nach Gallien
entsendete Caesar Julian von seinen Truppen in Paris zum Augustus ausgerufen. In diesem
Zusammenhang spricht man gemeinhin von der Usurpation Julians. Die Meinungen
hinsichtlich des Vorgangs dieser Machtergreifung sind dabei kontrovers. Julian selbst und der
römische Historiker Ammianus Marcellinus weisen die Initiative zur Machtergreifung den
Soldaten zu und versuchen den Eindruck einer Usurpation zu vermeiden. Dagegen steht die in
der Forschung weit verbreitete Meinung, dass die Erhebung Julians von ihm selbst angestrebt
wurde und als Usurpation angesehen werden muss.
Die Frage, welche sich daraus für diese Arbeit ergibt ist die Folgende: War die
Machtergreifung Julians von ihm selbst geplant und angestrebt oder war es eine
Machterhebung wider Willen? Es wird also zu klären sein, inwieweit Julian den Augustustitel
selbst anstrebte oder aber inwiefern die Lage in Paris eine durch die Soldaten bedingte
Notsituation bzw. lebensgefährliche Bedrohung für ihn darstellte, welche keinen anderen
Ausweg bot.
Um sich dieser Frage zu nähern wird sich der hieran anschließende Teil dieser Arbeit
zunächst mit dem Begriff der Usurpation an sich beschäftigen. Hierbei soll der Vorgang einer
Usurpation sowie die Forschungskontroverse zu diesem Thema näher beleuchtet werden.
Daran schließt sich zum besseren Verständnis eine Art historischer Abriss an, welcher
aufzeigen soll wie die Erhebung Julians zum Augustus im Einzelnen ablief. Im vierten Punkt
dieser Arbeit soll geklärt werden weshalb im Zusammenhang mit der Machterhebung Julians
von einer Usurpation gesprochen werden muss. Um dies zu bewerten sollen die in
Gliederungspunkt zwei angeführten Definitionen und Erkenntnisse zur Usurpation
herangezogen werden. Der fünfte Gliederungspunkt setzt sich direkt mit der Eingangs
gestellten Leitfrage auseinander. Hierbei sollen Indizien herausgearbeitet werden, welche die
Frage nach einer geplanten bzw. nicht geplanten Machtergreifung Julians abschließend klären
können. Am Schluss dieser Arbeit stehen eine abschließende Betrachtung sowie ein fundiertes
Urteil zu dieser Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Usurpation im Spätrömischen Reich
- 3. Historischer Abriss zu Julians Erhebung zum Augustus
- 4. Julian – Rechtmäßiger Augustus oder Usurpator?
- 5. Die Machtergreifung Julians – Geplant oder Ungeplant?
- 5.1. Die Vorbereitung
- 5.2. Die Machtergreifung
- 5.3. Die Verhandlungen mit Constantius II
- 5.4. Die Offensive Julians
- 6. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Machtergreifung Julians im Jahr 360 n. Chr. und die Frage, ob es sich dabei um eine geplante Usurpation oder eine wider Willen erfolgte Machterhebung handelte. Es wird analysiert, inwieweit Julian den Augustustitel selbst anstrebte oder ob die Umstände in Paris ihn zu dieser Handlung zwangen.
- Der Begriff der Usurpation im spätrömischen Reich
- Die historische Entwicklung der Ereignisse um Julians Erhebung
- Die Bewertung von Julians Handlungen im Kontext der Usurpationstheorie
- Analyse der Indizien für eine geplante oder ungeplante Machtergreifung
- Die politische Situation und die Rolle der Soldaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Planmäßigkeit von Julians Machtergreifung. Es skizziert die gegensätzlichen Interpretationen des Ereignisses – die Darstellung Julians und Ammianus Marcellinus, die die Initiative den Soldaten zuschreiben, im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht einer geplanten Usurpation. Das Kapitel umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Definition von Usurpation, den historischen Ablauf und die Bewertung der Indizien umfasst, um letztendlich die Leitfrage zu beantworten.
2. Die Usurpation im Spätrömischen Reich: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Usurpation und beleuchtet die Kontroversen in der Forschung. Es werden die Ansichten verschiedener Historiker wie Flaig und Szidat vorgestellt, die den Begriff der Usurpation über Akzeptanzsysteme und Legitimität definieren. Es wird erläutert, dass eine Usurpation die widerrechtliche Aneignung staatlicher Macht darstellt und häufig in Zeiten politischer Instabilität auftritt. Der Kapitel beschreibt die möglichen Gründe für Usurpationen (allgemeine Missstände, Unzufriedenheit mit dem Kaiser, militärische Erfolge des Herausforderers etc.) und die oft angestrebte Teilherrschaft anstelle der vollständigen Absetzung des amtierenden Kaisers.
Schlüsselwörter
Usurpation, Kaiser Julian, Spätrömisches Reich, Constantius II., Machtergreifung, Legitimität, Ammianus Marcellinus, Flaig, Szidat, Paris, Soldaten, Politik, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Die Machtergreifung Julians im Jahr 360 n. Chr.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Machtergreifung des Kaisers Julian im Jahr 360 n. Chr. und analysiert, ob es sich dabei um eine geplante Usurpation oder eine ungeplante Machterhebung handelte. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Julian den Augustustitel selbst anstrebte oder ob die Umstände ihn dazu zwangen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Den Begriff der Usurpation im spätrömischen Reich, die historische Entwicklung der Ereignisse um Julians Erhebung, die Bewertung von Julians Handlungen im Kontext der Usurpationstheorie, die Analyse von Indizien für eine geplante oder ungeplante Machtergreifung, die politische Situation und die Rolle der Soldaten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Usurpation im Spätrömischen Reich, Historischer Abriss zu Julians Erhebung zum Augustus, Julian – Rechtmäßiger Augustus oder Usurpator?, Die Machtergreifung Julians – Geplant oder Ungeplant? (unterteilt in Unterkapitel zur Vorbereitung, Machtergreifung, Verhandlungen mit Constantius II. und Julians Offensive), Abschließende Betrachtung.
Wie wird der Begriff der Usurpation definiert?
Die Arbeit analysiert den Begriff der Usurpation und beleuchtet die Kontroversen in der Forschung. Es werden verschiedene Perspektiven von Historikern wie Flaig und Szidat vorgestellt, die den Begriff über Akzeptanzsysteme und Legitimität definieren. Eine Usurpation wird als widerrechtliche Aneignung staatlicher Macht beschrieben, die oft in Zeiten politischer Instabilität auftritt.
Welche Quellen werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die Darstellung Julians und Ammianus Marcellinus, die unterschiedliche Perspektiven auf die Initiative der Soldaten bieten. Zusätzlich werden die Ansichten verschiedener Historiker, insbesondere Flaig und Szidat, zur Definition und zum Verständnis von Usurpation berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Indizien für eine geplante oder ungeplante Machtergreifung und versucht, die zentrale Forschungsfrage nach der Planmäßigkeit von Julians Machtergreifung zu beantworten. Die detaillierte Antwort findet sich in der abschliessenden Betrachtung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Usurpation, Kaiser Julian, Spätrömisches Reich, Constantius II., Machtergreifung, Legitimität, Ammianus Marcellinus, Flaig, Szidat, Paris, Soldaten, Politik, Geschichte.
- Quote paper
- Sebastian Richter (Author), 2009, Die Usurpation Julians, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232272