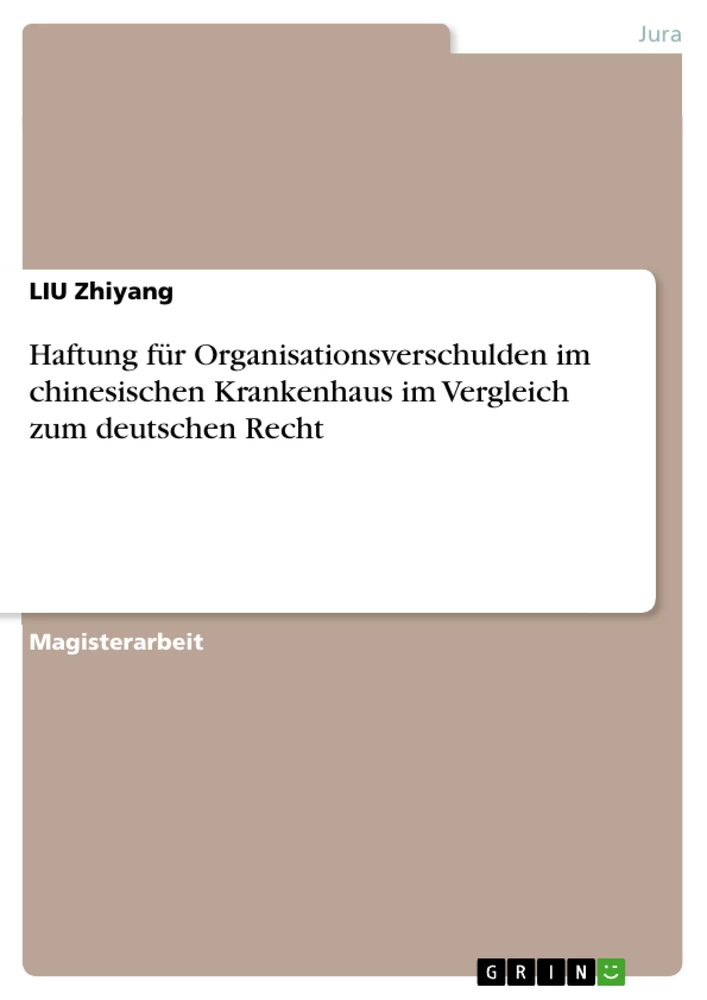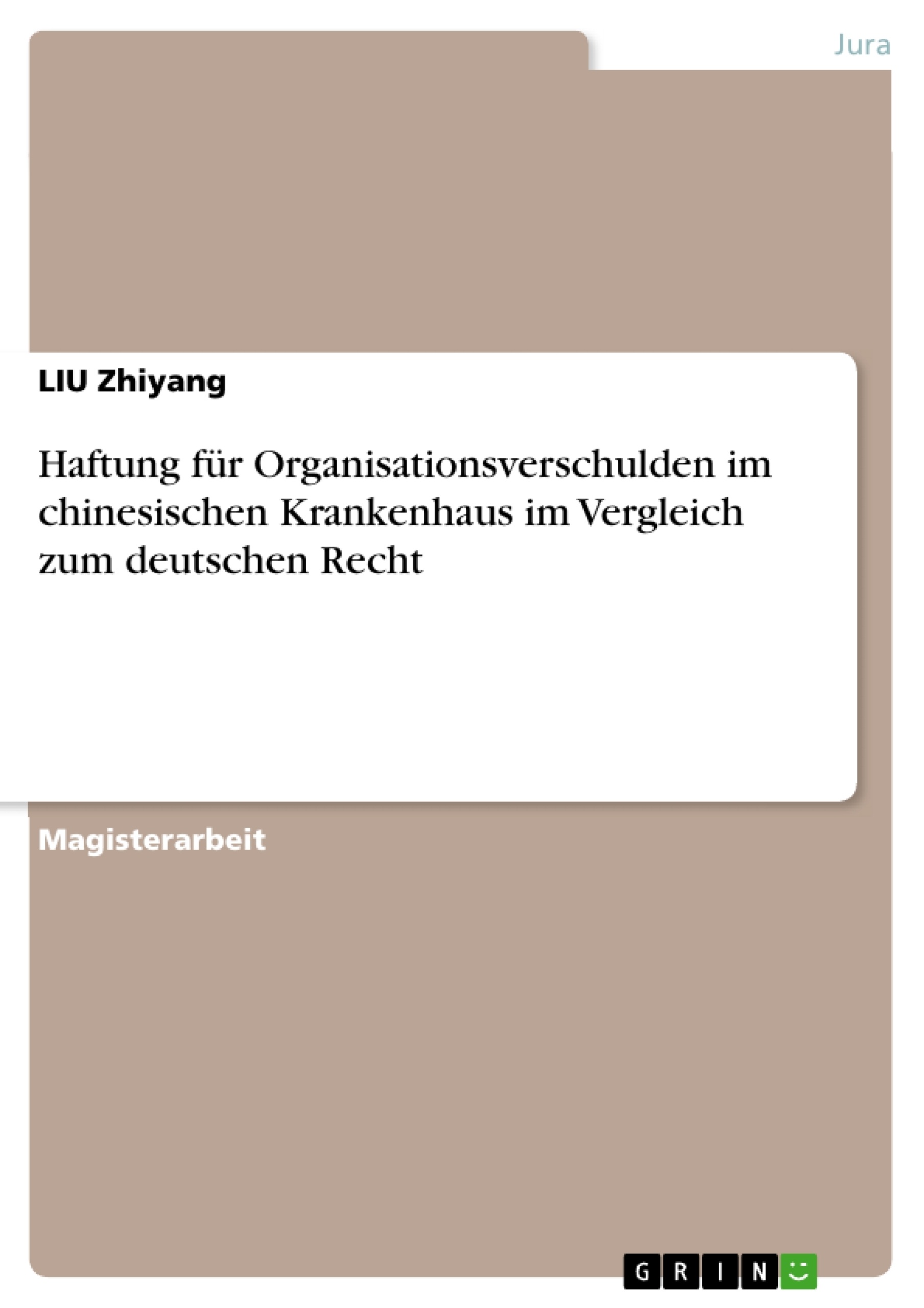Das neue Gesetz für deliktische Haftung (GdH) wurde am 26. 12. 2009 verabschiedet und ist am 1. 7. 2010 in Kraft getreten1. Nach diesem Gesetz ist bei der Verschuldenshaftung das Verschulden des Schädigers anzuerkennen2. Aber es ist nicht einfach das Verschulden des Schädigers in einem konkreten Fall festzustellen, da der Patient besonders im Krankenhaus in der Regel wenig Einblick in die organisatorischen Abläufe hat. Wenn ein Gericht das Verschulden jedoch nicht richtig beurteilen kann, könnte dies zu ungerechten Urteilen führen3. Daher ist es essentiell, die Art des Verschuldens entsprechend der gesetzlichen Voraussetzungen im konkreten Fall
genau zu bestimmen.
[...]
1 Bollweg/Doukoff/Jansen, Das neue chinesische Haftpflichtgesetz, ZChinR 2011, S. 91.
2 RdsA, S. 20ff, 224ff.
3 DOGC, S. 410 f.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Verschulden und Rechtslücke in China
- II. Organisationsverschulden und Rechtsweg in Deutschland
- B. Begriffe
- I. Der Begriff der Verkehrspflicht
- II. Der Begriff der Organisationspflicht
- III. Der Begriff des Organisationsverschuldens
- C. Systematische Stellung im BGB
- I. Allgemein
- II. Aufbaubildung gemäß § 823 Abs. 1 BGB
- 1. Überblick
- 2. Tatbestand
- 3. Rechtswidrigkeit
- 4. Verschulden (§ 276 BGB)
- 5. Kausalität und Zurechnung
- III. Das im Rahmen von §§ 831, 823 BGB relevante, sogenannte betriebliche Organisationsverschulden
- IV. Das im Rahmen von §§ 31, 823 BGB relevante, sogenannte körperschaftliche Organisationsverschulden
- D. Die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus
- I. Arten des Organisationsverschuldens im Krankenhaus
- II. Die Träger der Organisationspflicht und betreffende Organisationspflichten
- E. Zwischenergebnis
- F. Übertragung auf die Rechtslage in China
- I. Rechtslage in China
- II. Im Vergleich zum deutschen Recht
- G. Fazit
- H. Ergebnis
- I. Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus, insbesondere im Vergleich zwischen deutschem und chinesischem Recht. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der rechtlichen Rahmenbedingungen und ihrer praktischen Anwendung herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen, die verschiedenen Arten des Organisationsverschuldens und die jeweiligen Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure.
- Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus
- Vergleichende Rechtsanalyse: Deutsches Recht vs. Chinesisches Recht
- Arten des Organisationsverschuldens (primär, sekundär, abstrakt, konkret)
- Verantwortlichkeiten der Akteure (Krankenhausträger, leitender Arzt, etc.)
- Anwendbarkeit des deutschen Rechtsmodells auf die chinesische Rechtslage
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus ein und stellt den Vergleich zwischen deutschem und chinesischem Recht in den Mittelpunkt. Es skizziert die Problematik der Feststellung von Verschulden im Krankenhauskontext, insbesondere aufgrund des eingeschränkten Einblicks der Patienten in organisatorische Abläufe. Der Fall Zeng Jiajia in Chongqing dient als einführendes Beispiel für die Komplexität des Themas.
B. Begriffe: Hier werden zentrale Begriffe wie Verkehrspflicht, Organisationspflicht und Organisationsverschulden definiert und voneinander abgegrenzt. Die Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Analyse, indem es die wichtigsten juristischen Termini präzisiert und ihren Kontext im Zusammenhang mit der Krankenhaushaftung erläutert. Die klare Definition dieser Begriffe ist essentiell für die konsistente Anwendung im weiteren Verlauf der Arbeit.
C. Systematische Stellung im BGB: Dieses Kapitel beleuchtet die systematische Einordnung des Organisationsverschuldens im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Es analysiert die relevanten Paragraphen (§§ 823 Abs. 1, 831, 276 BGB) und deren Anwendung auf den Sachverhalt. Die Kapitel untersucht die Tatbestandsmerkmale (Verhalten, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Kausalität, Zurechnung) im Detail und ihre Relevanz im Kontext des Organisationsverschuldens. Die verschiedenen Rechtslehren (Erfolgsunrecht, Handlungsunrecht) werden kritisch gewürdigt und in Bezug zueinander gesetzt.
D. Die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der konkreten Anwendung der zuvor erörterten Prinzipien auf den Krankenhausbereich. Es differenziert verschiedene Arten von Organisationspflichten (primär, sekundär, abstrakt, konkret) und untersucht die jeweiligen Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure im Krankenhaus (Krankenhausträger, leitender Arzt, anderes Personal). Die Analyse der Organisationspflichten des Krankenhausträgers hinsichtlich personeller Ausstattung, Arbeitsteilung und medizinischer Geräte ist besonders detailliert. Die Verantwortlichkeiten werden differenziert nach den jeweiligen Rollen und Hierarchien im Krankenhaus analysiert.
F. Übertragung auf die Rechtslage in China: Dieses Kapitel vergleicht die Rechtslage in China mit dem deutschen Rechtssystem im Hinblick auf die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus. Es analysiert Gemeinsamkeiten (z.B. Verschuldensprinzip) und Unterschiede (theoretische und praktische Aspekte) der beiden Rechtssysteme. Besonderes Augenmerk wird auf die Voraussetzungen gelegt, unter denen eine Übertragung des deutschen Modells auf die chinesische Rechtslage sinnvoll und möglich erscheint. Dabei werden theoretische, juristische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Organisationsverschulden, Krankenhaushaftung, deutsches Recht, chinesisches Recht, BGB, § 823, Verkehrspflicht, Organisationspflicht, Verantwortlichkeit, Krankenhausträger, leitender Arzt, Vergleichende Rechtswissenschaft, medizinische Haftung, Verschuldensprinzip, Kausalität, Zurechnung.
FAQ: Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus - Vergleich Deutschland und China
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus, insbesondere im Vergleich zwischen deutschem und chinesischem Recht. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der rechtlichen Rahmenbedingungen und ihrer praktischen Anwendung herauszuarbeiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der Haftung für Organisationsverschulden, die verschiedenen Arten von Organisationsverschulden (primär, sekundär, abstrakt, konkret), die Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure (Krankenhausträger, leitender Arzt etc.) und die Anwendbarkeit des deutschen Rechtsmodells auf die chinesische Rechtslage.
Welche Begriffe werden definiert?
Zentrale Begriffe wie Verkehrspflicht, Organisationspflicht und Organisationsverschulden werden definiert und voneinander abgegrenzt. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der weiteren Analyse.
Wie wird das Organisationsverschulden im deutschen BGB systematisch eingeordnet?
Die Arbeit beleuchtet die systematische Einordnung des Organisationsverschuldens im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), analysiert relevante Paragraphen (§§ 823 Abs. 1, 831, 276 BGB) und deren Anwendung auf den Sachverhalt. Tatbestandsmerkmale (Verhalten, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Kausalität, Zurechnung) werden im Detail untersucht.
Wie wird die Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus konkret behandelt?
Die Arbeit differenziert verschiedene Arten von Organisationspflichten und untersucht die Verantwortlichkeiten verschiedener Akteure im Krankenhaus (Krankenhausträger, leitender Arzt, anderes Personal). Die Analyse der Organisationspflichten des Krankenhausträgers hinsichtlich personeller Ausstattung, Arbeitsteilung und medizinischer Geräte ist besonders detailliert.
Wie wird der Vergleich zwischen deutschem und chinesischem Recht durchgeführt?
Die Arbeit vergleicht die Rechtslage in China mit dem deutschen Rechtssystem hinsichtlich der Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus. Sie analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Rechtssysteme und untersucht die Voraussetzungen für eine Übertragung des deutschen Modells auf die chinesische Rechtslage.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Organisationsverschulden, Krankenhaushaftung, deutsches Recht, chinesisches Recht, BGB, § 823, Verkehrspflicht, Organisationspflicht, Verantwortlichkeit, Krankenhausträger, leitender Arzt, Vergleichende Rechtswissenschaft, medizinische Haftung, Verschuldensprinzip, Kausalität, Zurechnung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in Kapitel A (Einleitung), B (Begriffe), C (Systematische Stellung im BGB), D (Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus), E (Zwischenergebnis), F (Übertragung auf die Rechtslage in China), G (Fazit), H (Ergebnis) und I (Aussicht).
Welches einführende Beispiel wird verwendet?
Der Fall Zeng Jiajia in Chongqing dient als einführendes Beispiel für die Komplexität des Themas der Haftung für Organisationsverschulden im Krankenhaus.
- Quote paper
- LIU Zhiyang (Author), 2013, Haftung für Organisationsverschulden im chinesischen Krankenhaus im Vergleich zum deutschen Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232306