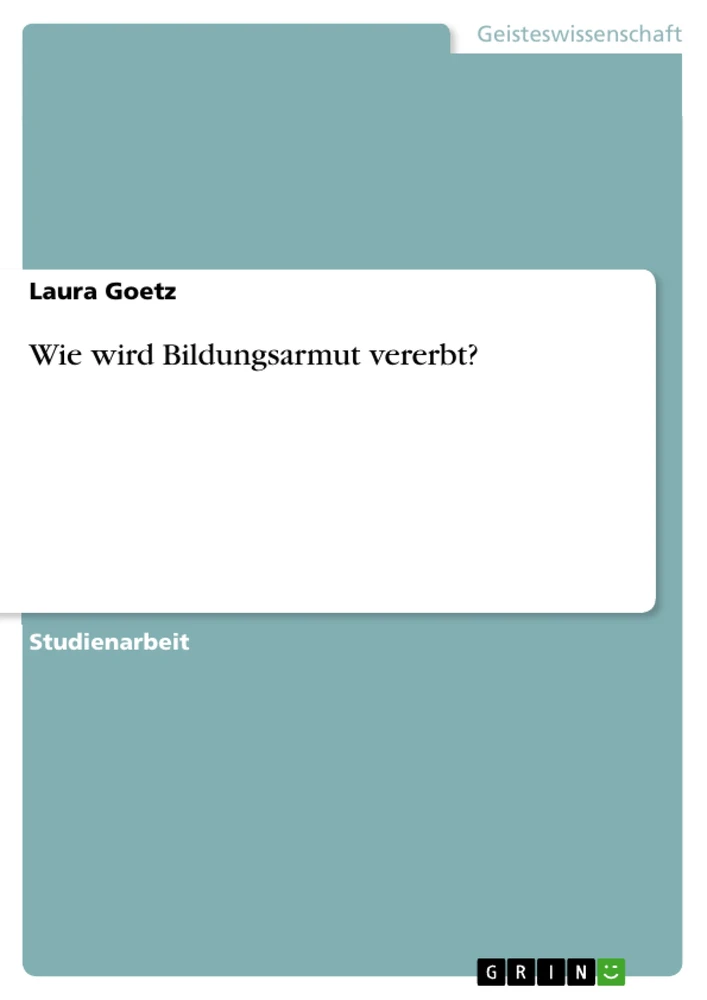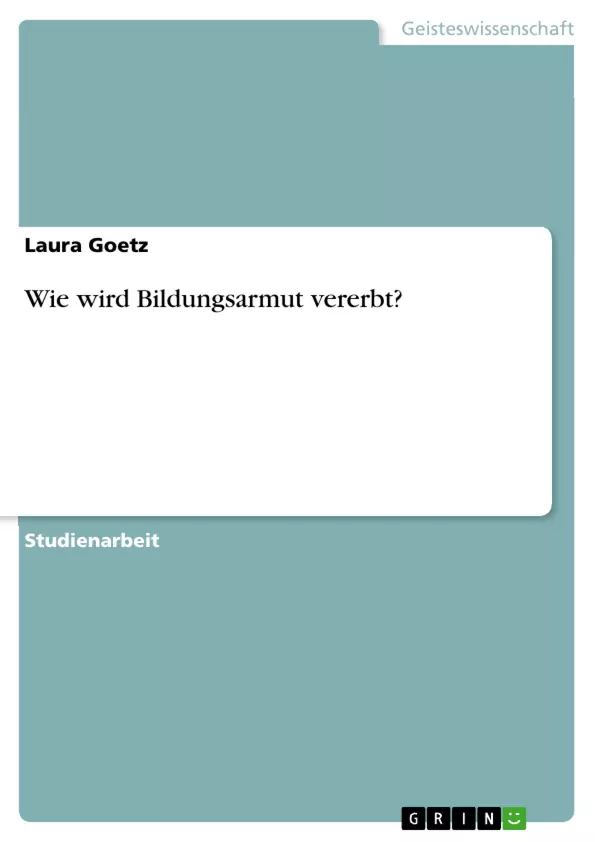Bildung gewinnt in modernen Gesellschaften eine immer größere Bedeutung. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, in der unser Bildungstand maßgeblich unsere individuellen Lebens-chancen und Möglichkeiten auf soziale und kulturelle Teilhabe und Wohlstand bestimmt. Demzufolge ermöglicht ein guter Bildungsabschluss nicht nur individuellen ökonomischen Erfolg, sondern bildet auch die Grundlage der Existenzsicherung. Die Deutschland in den letz-ten 50 Jahren prägende Bildungsexpansion wurde jedoch fast ausschließlich mit dem Blick nach oben betrachtet. Der Begriff Bildungsarmut wurde erst Ende der 90er Jahre von Jutta Allmendinger (1999) in Deutschland in die wissenschaftliche und öffentliche Debatte mit ein-geführt und stellt seit dem mit einen Schwerpunkt in der Sozialforschung dar (Groh-Samberg: 263). Empirische Analysen zeigen, dass Bildungsarmut vererbt wird und es mit der Bildungs-expansion hinsichtlich der familialen Situation eindeutig zu einer zunehmenden sozialen Ver-armung dieser Gruppe und Verfestigung der Bildungsarmut gekommen ist (z.B. Solga/Wagner 2004; Wagner 2006). Es stellt sich folglich die Frage durch welche Mechanismen Bildungs-armut in einem wirtschaftlich so prosperierenden und hoch entwickelten Land wie Deutsch-land intergenerational weitergegeben werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen der schichtspezifischen Bildungschancen
- Bildungsarmut
- Zertifikatsarmut
- Kompetenzarmut
- Die Verfestigung von Bildungsarmut durch das soziale Umfeld
- Das ökonomische Kapital als materielle Grundversorgung
- Der Einfluss des familialen kulturellen Kapitals auf die Rekonstruktion von Bildungsarmut
- Die Wirkung des sozialen Kapitals auf den Bildungsstand
- Die Reproduktion der Klassenstrukturen
- Der Beitrag des Schulsystems zur Vererbung von Bildungsarmut
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Phänomen der Bildungsarmut in Deutschland und analysiert die Ursachen und Mechanismen, die zur Verfestigung dieser Problematik beitragen. Im Zentrum stehen die Analyse der sozialen Herkunft, die Auswirkungen des sozialen Umfelds und die Rolle des Schulsystems.
- Definition und Ausprägungen von Bildungsarmut (Zertifikatsarmut, Kompetenzarmut)
- Der Einfluss sozialer Herkunft und Kapitalformen auf den Bildungserfolg
- Die Rolle des Schulsystems bei der Vererbung von Bildungsarmut
- Die Problematik der Ungleichheit von Bildungschancen in Deutschland
- Die Bedeutung von Bildung für die soziale Teilhabe und den ökonomischen Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Bildung und die Herausforderungen durch Bildungsarmut in den Vordergrund. Sie skizziert die Entwicklung des Begriffs und die zentrale Frage nach den Mechanismen der intergenerationalen Weitergabe von Bildungsarmut.
Im zweiten Kapitel werden die Ursachen der schichtspezifischen Bildungschancen beleuchtet, die zu ungleichen Bildungsergebnissen führen. Dabei wird die Bedeutung der sozialen Schicht und ihrer Prägung auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder hervorgehoben.
Das dritte Kapitel definiert Bildungsarmut und unterscheidet zwischen Zertifikatsarmut und Kompetenzarmut. Es zeigt, wie diese Formen von Bildungsarmut im deutschen Kontext gemessen werden und inwieweit sie sich von einem internationalen Vergleich abheben.
Das vierte Kapitel fokussiert auf die Verfestigung von Bildungsarmut durch das soziale Umfeld. Hier werden die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) und ihre Auswirkungen auf den Bildungserfolg analysiert.
Das fünfte Kapitel beleuchtet den Beitrag des Schulsystems zur Vererbung von Bildungsarmut. Es wird untersucht, inwiefern das Schulsystem in der Lage ist, die ökonomischen, kulturellen und sozialen Defizite im Elternhaus auszugleichen.
Schlüsselwörter
Bildungsarmut, soziale Ungleichheit, Bildungsexpansion, Kompetenzarmut, Zertifikatsarmut, soziales Kapital, kulturelles Kapital, ökonomisches Kapital, Schulsystem, Bildungschancen, intergenerationale Transmission, Sozialisation, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Bildungsarmut in Deutschland „vererbt“?
Bildungsarmut wird intergenerational weitergegeben, da der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland stark von der sozialen Herkunft und den Ressourcen des Elternhauses abhängt.
Was ist der Unterschied zwischen Zertifikatsarmut und Kompetenzarmut?
Zertifikatsarmut bezieht sich auf das Fehlen formaler Schulabschlüsse, während Kompetenzarmut das Unterschreiten von Mindeststandards in Bereichen wie Lesen oder Rechnen beschreibt.
Welchen Einfluss hat das kulturelle Kapital auf den Bildungserfolg?
Kulturelles Kapital (z.B. Bücher im Haushalt, Bildungsnähe der Eltern) prägt die Sprache und das Verhalten von Kindern, was im Schulsystem oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Welche Rolle spielt das soziale Kapital?
Soziales Kapital umfasst Netzwerke und Beziehungen. Kinder aus bildungsfernen Schichten haben oft weniger Zugang zu unterstützenden Netzwerken, die den Bildungsweg fördern.
Kann das Schulsystem die Bildungsarmut ausgleichen?
Aktuelle Analysen zeigen, dass das deutsche Schulsystem soziale Defizite des Elternhauses oft nicht ausreichend kompensiert, sondern bestehende Ungleichheiten teilweise sogar verfestigt.
- Arbeit zitieren
- Laura Goetz (Autor:in), 2013, Wie wird Bildungsarmut vererbt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232343