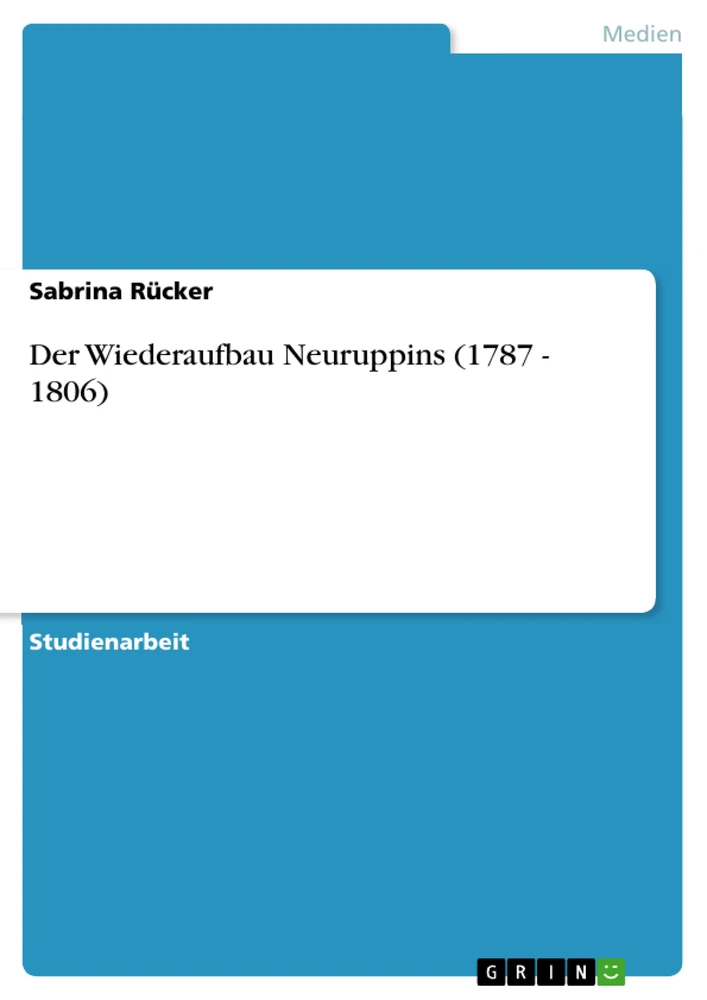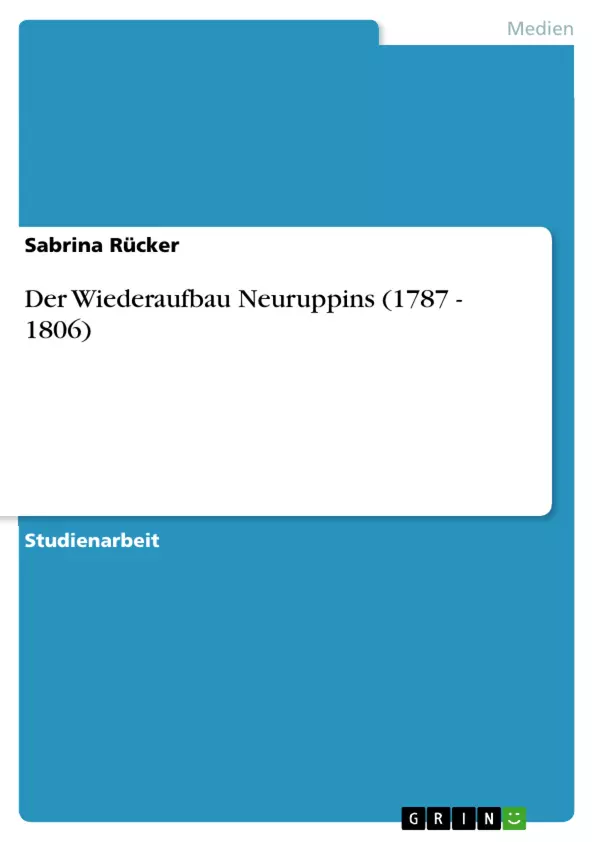Die verheerendste Katastrophe, die die Stadt Neuruppin bis dahin kennt, beginnt am 26. August 1787 am frühen Nachmittag: In den Scheunen bricht ein Feuer aus, schnell brennt es in der ganzen Stadt und am Abend ist beinahe 2/3 von Neuruppin zerstört. Als "Musterprojekt der gemäßigten Aufklärung in Preußen" will König Friedrich Wilhelm II. die Stadt wieder aufbauen. Im Rahmen der Retablissements-Commission tragen Freiherr v. Voß, genauso wie Bernhard Matthias Brasch als Bauinspektor und Oberbaurat Philipp Bernhard François Berson maßgeblich zum Wiederaufbau Neuruppins bei und geben der bald neuentstehenden Stadt ihr Gesicht. Etwa sieben Jahre werden für den Neubau eingeplant, am Ende wird er 18 Jahre dauern und die Stadt entwickelt sich zum Aufführungsort für Gesellschafts- und Reformkonzepte, die durch den Neubau visualisiert werden sollen. Auseinandergesetzt mit der Stadtplanung, den Bürgerhäusern, dem Schulgebäude sowie Rathaus und Marienkirche wird sich zeigen, ob mit Neuruppin über Konzepte hinaus wirklich ein Muster geschaffen wird, mit dem sich alle künftigen Retablissementprojekte messen lassen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Brandkatastrophe
- Der Wiederaufbau ab 1787
- Stadtplanung
- Die Bürgerhäuser
- Das Schulgebäude
- Rathaus und Marienkirche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Wiederaufbau der Stadt Neuruppin nach dem verheerenden Stadtbrand von 1787. Die Arbeit analysiert die städtebaulichen und architektonischen Veränderungen, die im Zuge des Wiederaufbaus stattfanden, und setzt diese in den Kontext der preussischen Politik und Verwaltung des späten 18. Jahrhunderts.
- Die Auswirkungen des Stadtbrandes von 1787 auf Neuruppin
- Die Rolle der preussischen Verwaltung und Bürokratie beim Wiederaufbau
- Städtebauliche Planung und Umsetzung im Kontext des "Preußischen Stils"
- Architektur und Gestaltung der wiederaufgebauten Gebäude
- Sozioökonomische Aspekte des Wiederaufbaus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des Wiederaufbaus Neuruppins nach dem großen Brand von 1787, indem sie den Zustand Preußens nach den Schlesischen Kriegen und die soziale Politik Friedrichs II. beleuchtet. Sie führt die wichtigsten Akteure des Wiederaufbaus ein, darunter Freiherr von Voß, Brasch und Berson, und beschreibt die Struktur des Oberbaudepartements. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse des Wiederaufbaus als Beispiel preussischer Regierungsführung und städtebaulicher Planung. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen Friedrich dem Großen und seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. und deren unterschiedlichen Ansätzen zur Staatsführung.
Die Brandkatastrophe: Dieses Kapitel schildert detailliert den verheerenden Stadtbrand von 1787 in Neuruppin. Es beschreibt den Ausbruch des Feuers, die schnelle Ausbreitung aufgrund des starken Windes und die immense Zerstörung, die 2/3 der Stadt, darunter hunderte Häuser, Kirchen und öffentliche Gebäude, betroffen hat. Der Verlust von Menschenleben wird hervorgehoben, und das Kapitel setzt die Szene für die nachfolgenden Kapitel, die sich mit dem Wiederaufbau befassen. Die Beschreibung der Katastrophe dient als Ausgangspunkt für die Analyse der Notwendigkeit und des Umfangs der nachfolgenden Baumaßnahmen.
Der Wiederaufbau ab 1787: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Beginn und die frühen Phasen des Wiederaufbaus. Es beschreibt die Entscheidungen von Otto Carl Friedrich von Voß, Präsident der Kurmärkischen Kammer, zunächst provisorische Unterkünfte zu schaffen und anschließend ein umfassendes städtebauliches Projekt in Angriff zu nehmen. Die enormen Kosten des Wiederaufbaus werden erläutert, ebenso wie die Begründung von Voß für den kompletten Neubau der Stadt anstelle einer Reparatur der bestehenden Strukturen. Die Kapitel diskutiert auch die übergreifende preussische Politik, die die Notwendigkeit des Wiederaufbaus und die damit verbundenen Kosten rechtfertigt. Der Fokus liegt auf der preussischen Staatsräson und den sozioökonomischen Gründen für den umfassenden Wiederaufbau.
Stadtplanung: Dieses Kapitel analysiert die Stadtplanung des neuen Neuruppin. Es beschreibt den alten Stadtgrundriss und den Kontrast zum neuen, rechtwinkligen Plan mit breiten Straßen und einem zentralen Kirchplatz. Die Einflüsse des Militärwesens auf die Planung werden diskutiert, und das Kapitel verortet den Wiederaufbau im Kontext der europaweiten städtebaulichen Modernisierung des 18. Jahrhunderts. Die Analyse vergleicht den alten und neuen Stadtplan, um die grundlegenden Veränderungen in der Stadtstruktur zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Rationalisierung und der durchgreifenden Veränderung im Vergleich zu Barockstadtplanung.
Schlüsselwörter
Neuruppin, Stadtbrand 1787, Wiederaufbau, Preußischer Stil, Stadtplanung, Architektur, Friedrich Wilhelm II., Oberbaudepartement, Kurmärkische Kammer, Brasch, Voß, Berson.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Wiederaufbau Neuruppins nach dem Stadtbrand von 1787
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Wiederaufbau der Stadt Neuruppin nach dem verheerenden Stadtbrand von 1787. Sie analysiert die städtebaulichen und architektonischen Veränderungen und setzt diese in den Kontext der preußischen Politik und Verwaltung des späten 18. Jahrhunderts.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des Stadtbrandes, die Rolle der preußischen Verwaltung, die städtebauliche Planung im Kontext des „Preußischen Stils“, die Architektur der wiederaufgebauten Gebäude und sozioökonomische Aspekte des Wiederaufbaus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, der Brandkatastrophe, dem Wiederaufbau ab 1787, der Stadtplanung, den Bürgerhäusern, dem Schulgebäude, dem Rathaus und der Marienkirche sowie einem Fazit. Die Einleitung beleuchtet den Zustand Preußens nach den Schlesischen Kriegen und die soziale Politik Friedrichs II. Die Kapitel zum Wiederaufbau konzentrieren sich auf die Entscheidungen der Verantwortlichen, die Kosten, die städtebauliche Planung und die Architektur der neuen Gebäude.
Wie wird der Stadtbrand von 1787 beschrieben?
Das Kapitel zur Brandkatastrophe schildert detailliert den Ausbruch, die schnelle Ausbreitung und die immense Zerstörung von 2/3 der Stadt, inklusive hunderter Häuser, Kirchen und öffentlicher Gebäude. Der Verlust von Menschenleben wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielte die preußische Verwaltung beim Wiederaufbau?
Die Arbeit analysiert die Rolle der preußischen Verwaltung und Bürokratie, insbesondere von Personen wie Freiherr von Voß, Brasch und Berson, sowie des Oberbaudepartements und der Kurmärkischen Kammer. Der Fokus liegt auf den Entscheidungen über den Umfang des Wiederaufbaus (kompletter Neubau statt Reparatur) und die Finanzierung.
Wie wurde die Stadt Neuruppin nach dem Brand neu geplant?
Das Kapitel zur Stadtplanung vergleicht den alten und neuen Stadtgrundriss. Der neue Plan ist rechtwinklig mit breiten Straßen und einem zentralen Kirchplatz, im Gegensatz zum alten Grundriss. Der Einfluss des Militärwesens und die Einordnung in den Kontext der europaweiten städtebaulichen Modernisierung werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neuruppin, Stadtbrand 1787, Wiederaufbau, Preußischer Stil, Stadtplanung, Architektur, Friedrich Wilhelm II., Oberbaudepartement, Kurmärkische Kammer, Brasch, Voß, Berson.
Welche Personen spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit?
Wichtige Personen sind Freiherr von Voß (Präsident der Kurmärkischen Kammer), Brasch und Berson, die am Wiederaufbau beteiligt waren. Die Arbeit vergleicht auch die Regierungsansätze von Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II.
Wie wird der „Preußische Stil“ in der Arbeit behandelt?
Der „Preußische Stil“ wird im Kontext der städtebaulichen Planung und Architektur des wiederaufgebauten Neuruppin analysiert. Die Arbeit untersucht, wie sich dieser Stil in der Gestaltung der Gebäude und der Stadtplanung manifestiert.
Welche sozioökonomischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die enormen Kosten des Wiederaufbaus, die Notwendigkeit des Neubaus und die damit verbundenen sozioökonomischen Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner.
- Arbeit zitieren
- Sabrina Rücker (Autor:in), 2010, Der Wiederaufbau Neuruppins (1787 - 1806), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232519