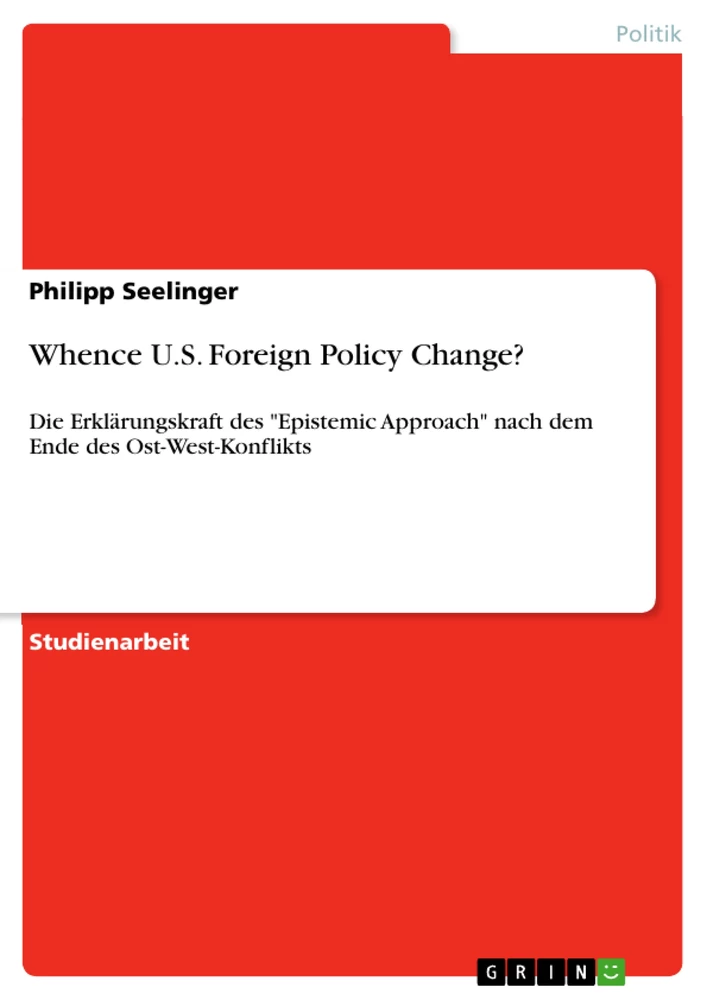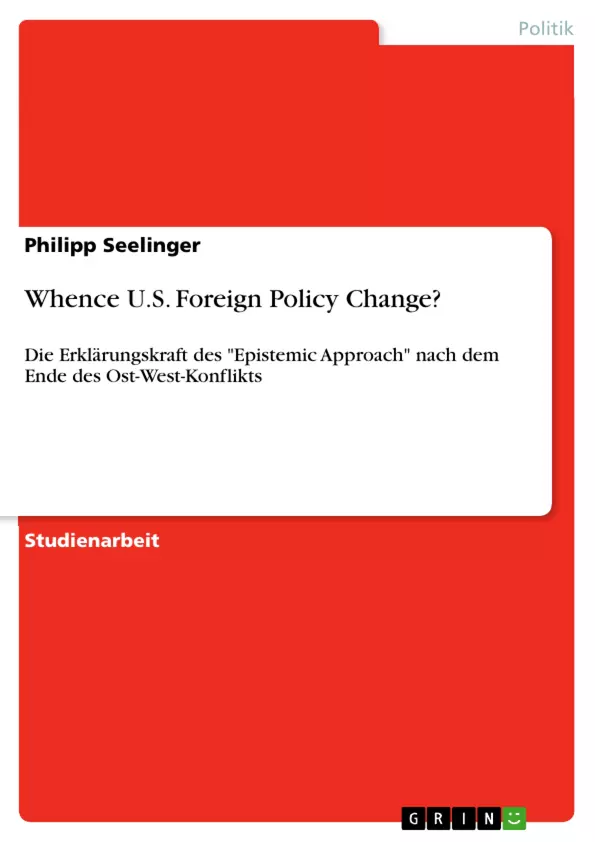Das politische System der USA gilt als verhältnismäßig durchlässig für gesellschaftliche Ideen und Präferenzen zu den politischen Entscheidungsträgern. Im Bereich der Außenpolitik gehen die Meinungen über den tatsächlichen sowie den wünschenswerten Einfluss der Gesellschaft weit auseinander. Während die einen im Sinne der Demokratie einen solchen Einfluss gutheißen, argumentieren andere, darunter Hans Morgenthau, die zu große Emotionalität der Gesellschaft sei eine Gefährdung für stabile und effektive Außenpolitik. Während die „mood theory“ der Öffentlichkeit unterstellt über keine stabile und konsistente Ansicht zu internationalen Belangen zu verfügen und lediglich auf Krisen und Bedrohungen zu reagieren, misst Jeffrey W. Legro gesellschaftlichen Einstellungsmustern große Bedeutung zu. Die ideational structure hat demzufolge nicht nur einen großen Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger, sondern ist geradezu handlungsleitend und substantiell für die generelle Orientierung der Außenpolitik eines Staates.
Legro erprobt seine Theorie anhand des Wechsels von der isolationistischen Außenpolitik, die lange Zeit charakteristisch für die Vereinigten Staaten von Amerika war, hin zu einer internationalistischen Ausrichtung nach dem zweiten Weltkrieg. Der Kern seiner Argumentation ist die Frage, weshalb sich dieser Wandel nicht schon nach dem ersten Weltkrieg vollzogen hat, da die Ereignisse und Konsequenzen in beiden Fällen sehr ähnlich waren. Die Antwort findet Legro in der Rolle der ideellen Struktur in der Gesellschaft, die maßgeblich verantwortlich war für die isolationistische Kontinuität nach dem ersten und den Wandel zum Internationalismus nach dem zweiten Weltkrieg.
Nach dem Ende des Kalten Kriegs sind die USA die letzte verbliebene Supermacht. Ihre Außenpolitik unterliegt nicht mehr den Zwängen des bipolaren Systems, die zuvor den Handlungsspielraum begrenzten. Dennoch ist durch die zunehmende Globalisierung und wirtschaftliche Interdependenz eine Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Isolationismus undenkbar. Der Handlungsspielraum der Supermacht liegt nun mehr in einer unilateralen, internationale Verpflichtungen meidenden, oder einer multilateral orientierten, die Interessen der anderen Staaten wahrenden, Außenpolitik auf der einen und einer idealistischen, das heißt westliche Werte fördernden und verbreitenden, oder realistischen, also an nationalen Interessen ausgerichteten, Außenpolitik auf der anderen Seite.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Aufbau der Arbeit
- Literaturbericht
- JEFFREY W. LEGROS „EPISTEMIC APPROACH"
- Theoretische Verortung des Ansatzes
- Legros „Epistemic Approach"
- Methoden und Operationalisierung
- Kritik am „Epistemic Approach"
- IDEATIONAL STRUCTURE UND US-AUßENPOLITIK NACH DEM KALTEN KRIEG
- DIE GESCHEITERTE HUMANITÄRE INTERVENTION IN SOMALIA
- Ideational structure vor Somalia
- Kollaps und Änderung der Außenpolitik?
- DIE TERRORANGRIFFE VOM 11. SEPTEMBER 2001
- Ideelle Struktur vor 9/11
- Kollaps der ideational structure nach 9/11?
- FAZIT: EINGESCHRÄNKTE ERKLARUNGSKRAFT, ZUSATZLICHER FAKTOR
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich Veränderungen in der US-amerikanischen Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges mithilfe des „Epistemic Approach" von Jeffrey W. Legro erklären lassen. Der Fokus liegt dabei auf zwei Ereignissen: der gescheiterten humanitären Intervention in Somalia und den Terrorangriffen vom 11. September 2001.
- Die Rolle von ideellen Strukturen in der US-Außenpolitik
- Der Einfluss von Ereignissen auf die Veränderung von ideellen Strukturen
- Die Erklärungskraft des „Epistemic Approach" für die US-Außenpolitik nach dem Kalten Krieg
- Die Bedeutung von Unilateralismus und Multilateralismus in der US-Außenpolitik
- Die Rolle von Idealismus und Realismus in der US-Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Fragestellung der Arbeit und stellt den Aufbau dar. Der Literaturbericht beschreibt die Quellen, die für die Bearbeitung der Fragestellung herangezogen wurden. Das zweite Kapitel widmet sich dem „Epistemic Approach" von Jeffrey W. Legro, der die Grundlage der empirisch-interpretativen Studie bildet. Es werden die theoretischen Grundlagen des Ansatzes, seine Methoden und Messverfahren sowie Kritikpunkte an Legros Ansatz vorgestellt.
Das dritte Kapitel untersucht die ideelle Struktur in den Vereinigten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges und deren Einfluss auf die US-Außenpolitik. Es werden die dominanten Ideen, die Erwartungen an eine Politik im Einklang mit diesen Vorstellungen, deren Konsequenzen und die Auswirkungen auf die Ideen analysiert. Als Ereignisse, welche die ideational structure beeinflussen könnten, werden der Somalia-Einsatz mit der Schlacht von Mogadischu im Oktober 1993 sowie die terroristischen Angriffe auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 untersucht.
Das vierte Kapitel zieht ein Fazit und bewertet die Erklärungskraft des „Epistemic Approach" für die Veränderungen in der US-amerikanischen Außenpolitik. Es wird argumentiert, dass die Theorie in einigen Fällen zwar hilfreich ist, aber nicht alle Veränderungen erklären kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Epistemic Approach", die ideational structure, die US-Außenpolitik, den Kalten Krieg, Somalia, die Terrorangriffe vom 11. September 2001, Unilateralismus, Multilateralismus, Idealismus, Realismus, sowie die Rolle der Öffentlichkeit in der US-Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Epistemic Approach“ von Jeffrey W. Legro?
Dieser Ansatz besagt, dass ideelle Strukturen (Ideational Structure) in der Gesellschaft maßgeblich bestimmen, wie die Außenpolitik eines Staates ausgerichtet wird.
Warum änderten die USA ihre Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht nach dem Ersten?
Legro argumentiert, dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg die ideelle Struktur des Isolationismus kollabierte und Platz für den Internationalismus machte.
Welchen Einfluss hatte der Somalia-Einsatz auf die US-Außenpolitik?
Die gescheiterte Intervention in Somalia (Schlacht von Mogadischu) führte zu einer kritischen Hinterfragung multilateraler Friedenseinsätze.
Wie veränderten die Anschläge vom 11. September die ideelle Struktur der USA?
Die Arbeit untersucht, ob 9/11 zu einem Kollaps der bestehenden außenpolitischen Ideen führte und eine neue Ära des Unilateralismus einleitete.
Was ist der Unterschied zwischen Unilateralismus und Multilateralismus?
Unilateralismus beschreibt ein eigenmächtiges Handeln ohne Rücksicht auf internationale Partner, während Multilateralismus auf Kooperation und internationale Verpflichtungen setzt.
- Quote paper
- Philipp Seelinger (Author), 2009, Whence U.S. Foreign Policy Change?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232600