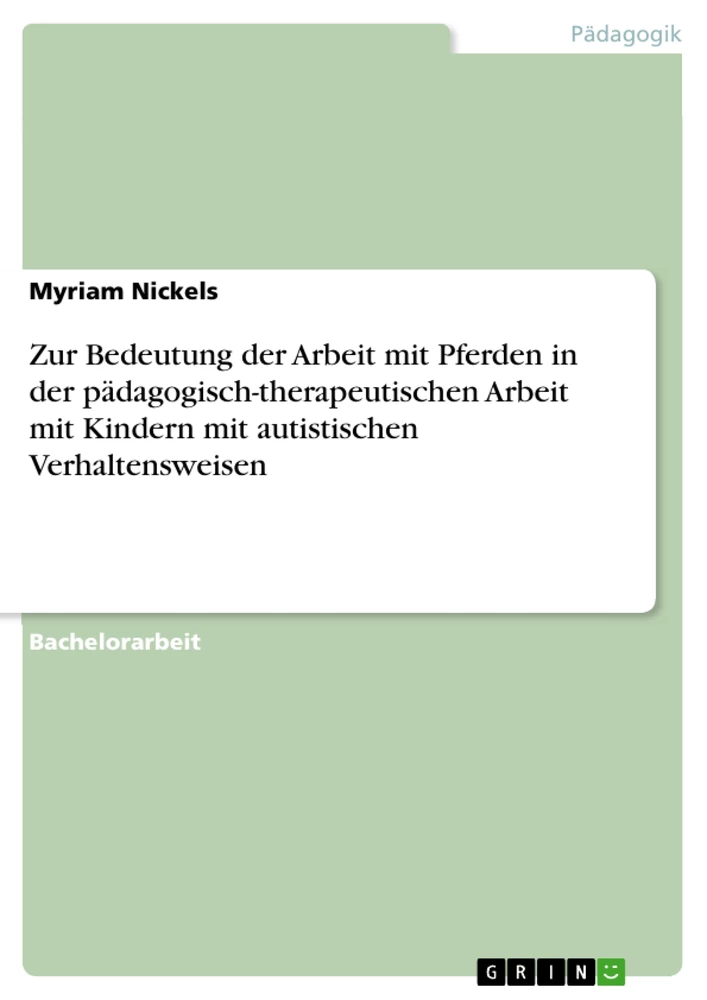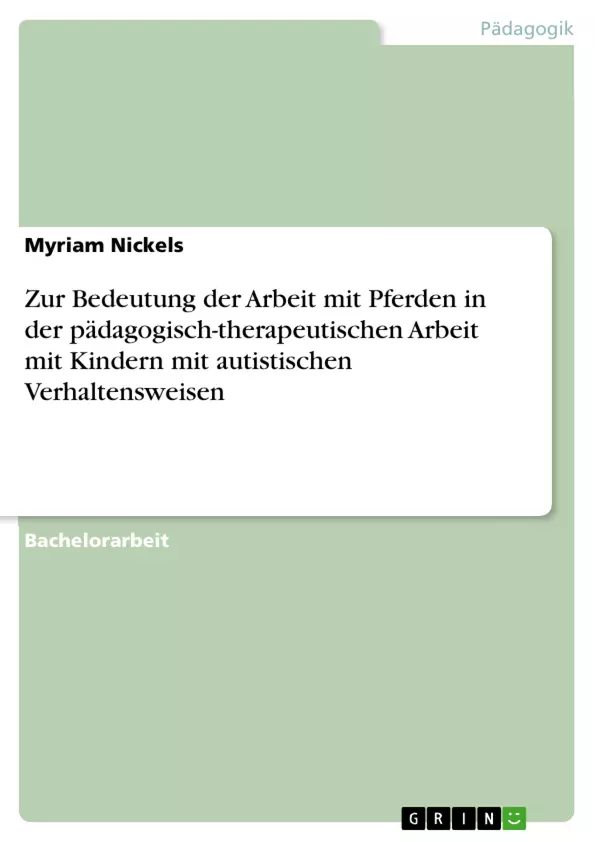Mit schwerem Gepäck kehrten 2012 die deutschen Reiter von den Sommer-Paralympics in London zurück. Sie gewannen zweimal Gold, dreimal Silber (davon einmal Silber in der Mannschaftswertung) und zweimal Bronze. Dies sind Belege dafür, dass Menschen mit Behinderungen in der Einheit Mensch-Pferd erfolgreich sein können und große Ziele erreichen können.
Darüber hinaus findet das Pferd häufig Einsatz in der Therapie vor allem von Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die medizinische Wirksamkeit des Reitens bei Kindern und Erwachsenen mit körperlichen Behinderungen wurde schon oft belegt. Die Einsatzmöglichkeiten der Arbeit mit Pferden in der Therapie und Pädagogik gehen aber weit über die medizinische und motorische Förderung hinaus. Bereits in der Antike wurden die emotionalen und sozialen Fördermöglichkeiten durch den Einsatz von Pferden erkannt und diese Therapie-Ansätze finden heutzutage immer mehr Beachtung.
Der Einsatz von Tieren wurde im Laufe der Zeit ausgeweitet und zu einem generellen...
Inhalt
1. Einleitung
2. Tiergestützte Interventionen
2.1. Theorien über die Grundlagen der positiven Wirkweise der Mensch-Tier-Beziehung
2.1.1. Die Biophilie-Hypothese
2.1.2. Die Du-Evidenz
2.1.3. Die Bindungstheorie
2.2. Fazit
3. Die Mensch-Pferd-Beziehung
3.1. Mensch und Pferd – eine folgenreiche gemeinsame Entwicklungsgeschichte
3.2. Die artspezifischen Besonderheiten des Pferdes
3.3. Therapeutisches Reiten
3.4. Die Besonderheiten des Einsatzes von Pferden in der Heilpädagogischen Förderung
3.4.1. Kommunikation
3.4.2. Interaktion
3.4.3. Der besondere Bewegungsdialog
3.4.4. Ganzheitlichkeit
3.4.5. Wirksame Besonderheiten des therapeutischen Settings bei der HFP
3.5. Fazit
4. Die Autismus-Spektrum-Störung
4.1. Autismus - Der Wandel vom Begriff zum Spektrum
4.2. Die beiden „klassischen“ Autismus-Theorien
4.2.1. Leo Kanner: Frühkindlicher Autismus
4.2.2 Hans Asperger: Autistische Psychopathie im Kindesalter
4.3. Aktuelle Autismus-Theorien
4.3.1. Die gestörte Theory of Mind
4.3.2. Die schwache zentrale Kohärenz
4.3.3. Störungen der exekutiven Dysfunktion
4.3.4. Fazit
4.4. Symptomatik
4.5. Klassifikation
4.6. Zur Therapie und Pädagogik von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen
4.6.1. Grundlagen der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern mit autistischen Verhaltensweisen
5. Fazit zur Bedeutung der Arbeit mit Pferden in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern mit autistischen Verhaltensweisen
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Pferde besonders für die Therapie von Kindern mit Autismus?
Pferde kommunizieren klar und wertfrei über Körpersprache. Dies hilft Kindern mit Autismus, soziale Interaktion und Kommunikation in einem geschützten Rahmen zu erleben.
Was ist die Biophilie-Hypothese?
Diese Hypothese besagt, dass Menschen eine angeborene, emotionale Bindung an die Natur und andere Lebewesen haben, was die positive Wirkung von Tieren erklärt.
Was versteht man unter Heilpädagogischer Förderung mit dem Pferd (HFP)?
HFP nutzt die Beziehung zum Pferd, um psychosoziale Probleme anzugehen, die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und Verhaltensweisen positiv zu beeinflussen.
Was ist der „Bewegungsdialog“ in der Pferdetherapie?
Es ist die physische Interaktion zwischen dem Rhythmus des Pferdes und dem Körper des Reiters, die entspannend wirkt und die Körperwahrnehmung schult.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie bei tiergestützten Interventionen?
Tiere können als sichere Basis dienen, die es den Kindern ermöglicht, Vertrauen aufzubauen und emotionale Blockaden zu lösen.
- Quote paper
- Myriam Nickels (Author), 2013, Zur Bedeutung der Arbeit mit Pferden in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern mit autistischen Verhaltensweisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232714