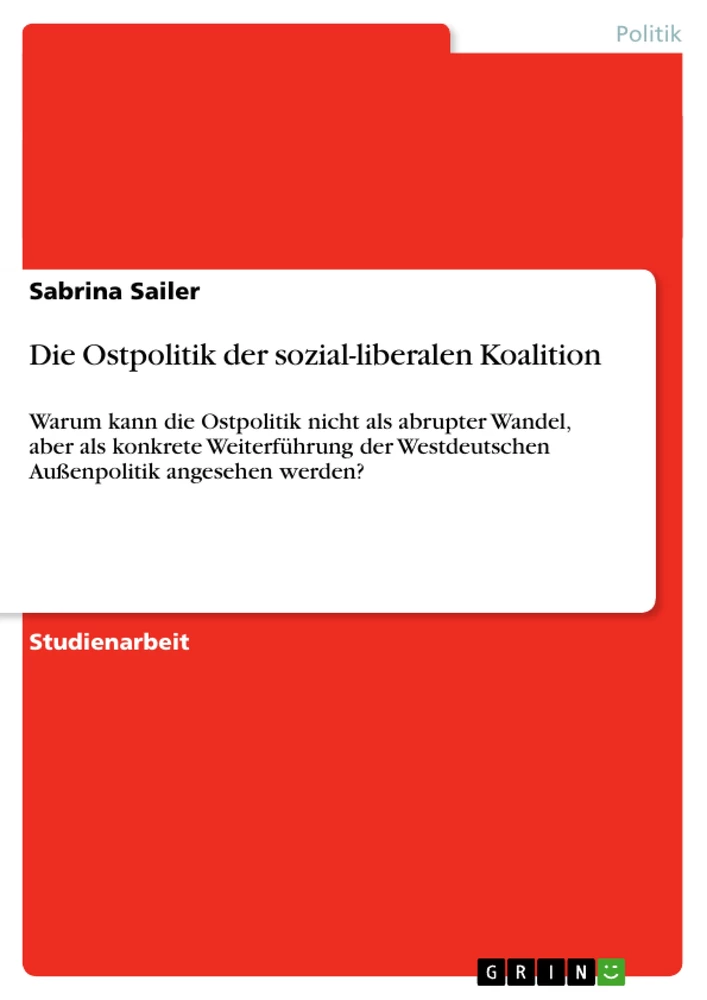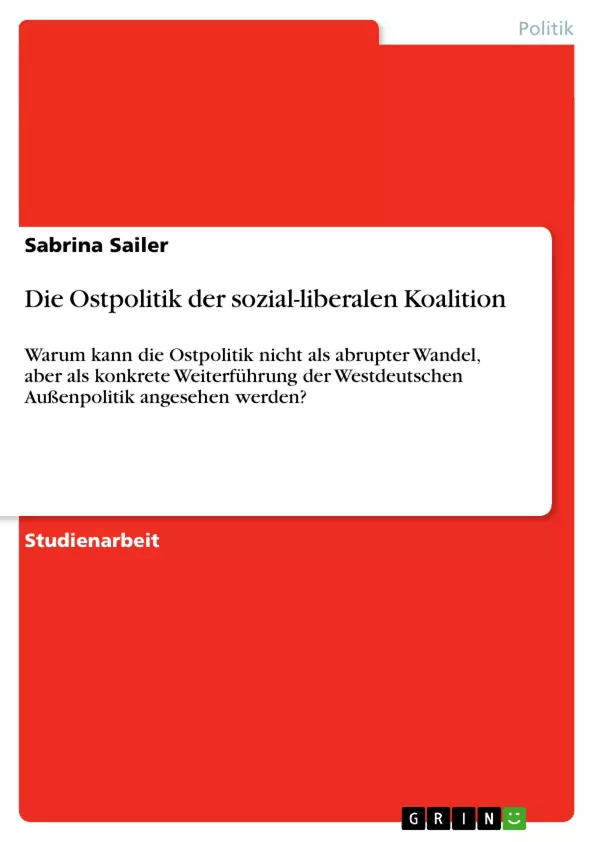In der hier vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, warum die östliche Ausrichtung der sozial-liberalen Koalition unter Brandt und Scheel keinen Bruch mit der Westpolitik unter Adenauer, sondern vielmehr eine kontinuierliche Weiterentwicklung des außenpolitischen Profils darstellte. Dabei ist besonders zu klären, was die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zu Adenauers Politik darstellten und in wie fern dieser Wandel der politischen Ausrichtung sich auf Europa und die beiden Supermächte auswirkte. Dies soll in dem hier angestrebtem Umfang exemplarisch mittels der beiden grundsätzlich konträren Theorien des Neorealismus nach Kenneth Waltz sowie der Interdependenztheorie entwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Situation vor Beginn der sozial-liberalen Koalition
3. Die Ostpolitik – Wandel oder Bruch in der außenpolitischen Orientierung Westdeutschlands?
3.1 Beziehungen zu der Sowjetunion und den Warschauer- Pakt- Staaten
3.1.1 Die Sowjetunion als stärkerer Bündnispartner? Die neorealistische Betrachtung
3.1.2 Die Verflechtung der Beziehungen: die interdependente Theoriensicht
3.2 Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika
3.2.1 Die neorealistische Sichtweise der Beziehungen zur USA
3.2.2 Interdependenztheorie
4. Das Verhältnis von Ost- und Westpolitik zueinander
5. Fazit: Wandel oder Bruch?
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der hier vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, warum die östliche Ausrichtung der sozial-liberalen Koalition unter Brandt und Scheel keinen Bruch mit der Westpolitik unter Adenauer, sondern vielmehr eine kontinuierliche Weiterentwicklung des außenpolitischen Profils darstellte. Dabei ist besonders zu klären, was die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zu Adenauers Politik darstellten und in wie fern dieser Wandel der politischen Ausrichtung sich auf Europa und die beiden Supermächte auswirkte. Dies soll in dem hier angestrebten Umfang exemplarischen mittels der beiden grundsätzlich konträren Theorien des Neorealismus nach Kenneth Waltz sowie der Interdependenz-theorie entwickelt werden.
An diese Einführung anschließend soll ein kurzer Blick auf die Situation bei Konstituierung der sozial-liberalen Koalition geworfen werden, um die Ausgangslage genauer zu konkretisieren. Danach folgt eine genaue Analyse der „Ostpolitik“ sowie deren Auswirkungen auf die westliche und östliche Supermacht mittels der oben benannten Theoriekonstrukte. Zum Abschluss wird ein Fazit zur Situation Westdeutschland am Ende der Sozial- Liberalen Koalition folgen.
Grundlage für die hier vorliegende Arbeit sollen vor allem folgende Autoren sein: für die Theorie des Neorealismus ihr bedeutendster Vertreter, Kenneth Waltz. Zu den Beziehungen der USA zur Ostpolitik der Bundesregierung siehe im besonderen Manfred Knapp in seinen Darstellungen zur Ostpolitik sowie Wilfred von Bredow zur Bedeutung des KSZE- Prozesses. Für die Handlungsmotivation der sozial liberalen Koalition steht im besonderen die Regierungserklärung von Willy Brandt.
2. Die Situation vor Beginn der sozial-liberalen Koalition
Das Ende des Dritten Reichs der Nationalsozialisten in Deutschland brachte eine neue Ära hervor: die alliierten Besatzungsmächte mussten sich über die Frage einig werden, wie mit Deutschland zu verfahren wäre, wie die Grenzen neu ziehen und wie zudem eine neuere, politisch stabilere Konstruktion zu erschaffen wäre, als sie es zur Machtergreifung Hitlers war. Durch die ideologischen Unterschiede zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion war diesem Unternehmen kaum Glück beschieden. Sobald der gemeinsame Gegner besiegt war, konnte man sich nur auf wenige gemeinsame Nenner einigen. Deutschland blieb geteiltes Besatzungsgebiet, über die Frage der Aufteilung entbrannten Konflikte. Die Berlin Blockade 1948 bildete den Höhepunkt der Auseinandersetzungen um Deutschland, und machte den Alliierten eines klar: man hatte keine Lösung für die „Deutschland-Frage“. Es blieb bei der Aufspaltung des deutschen Nationalstaatsgebietes in zwei ‚unabhängige’ deutsche Teilstaaten, wobei der eine den westlichen Alliierten, der andere der Sowjetunion zugeordnet blieb.
Deutschland selbst war in sich selbst gespalten: äußerlich und innerlich – der ostdeutsche Teil war mehr oder minder freiwillig unter der ‚schützenden Hand’ der Sowjetunion gefangen, der westdeutsche Teil strebte nach der durch den Krieg verloren gegangenen Souveränität. Adenauers Strategie der Westbindung zeitigte dabei große Erfolge: Westdeutschland konnte sich mittels seines Eintritts in das NATO[1] -Bündnis wieder im europäischen Umfeld bewegen, die Alliierten ließen verstärkte Eigeninitiativen auf dem Gebiet von wirtschaftlicher und staatlicher Souveränität zu. Die Deutsch-Deutsche Frage wurde dabei ausgeklammert: die Fronten zwischen Ost und West verhärten sich zusehends. Zudem „(...) war die Bonner Außenpolitik im Verhältnis zur Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten allgemein durch ein ‚Normalisierungsdefizit’ gekennzeichnet und stand im Verruf, den sich anbahnenden Entspannungsprozess zwischen den antagonistischen Lagern zu behindern.“[2] Westdeutschlands Integration in den Westen mittels des NATO- Bündnisses stand die Integration der inzwischen gegründeten DDR in den Warschauer Pakt entgegen. Eine Rüstungsspirale lief an, an deren Ende ein militärisches Patt stand, dass in der Kuba- Krise gipfelte: „Hier stießen die beiden Weltmächte zum bisher einzigen Mal so unmittelbar aufeinander, dass mit einer nuklearen gerechnet werden musste.“ Beide Supermächte, die USA und die Sowjetunion, verfügten über eine breite Palette von atomaren Sprengköpfen, über ein Bündnissystem, dass das bestehende politische Gefüge polarisierte: Ost oder West. USA oder Sowjetunion.
In dieser Konstellation tritt 1969 die sozial- liberale Koalition unter Brandt und Scheel ihre Regierungszeit in Westdeutschland an. Bereits unter Adenauer hat man versucht, die deutsch-deutsche Frage verstärkt in die Außenpolitik einzubinden, doch hatte man in der Rolle der Opposition nicht die Macht dazu, und die Regierung versteifte sich auf die Wiederherstellung der Souveränität zumindest ‚ihres’ Teilstaates. Nun sollte sich die Prämisse der Außenpolitik von einer reiner Orientierung auf den Westen hin zu einer Orientierung auf den Osten verschieben. Die bisherig erfolgte „(...) ’Politik der Bewegung’ brach zumindest der Erkenntnis Bahn, dass allein mit der seither verfolgten, faktisch exklusiven Westpolitik einigen zentralen außenpolitischen Interessen und Anliegen der BRD nicht mehr länger zu dienen war.“[3] Dies bot zumindest eine gute Basis für den Start der Ostpolitik der neuen Regierung.
3. Die Ostpolitik – Wandel oder Bruch in der außenpolitischen Orientierung Westdeutschlands?
Warum nun an dieser Stelle eine Änderung der außenpolitischen Ausrichtung? Die Westbindung Adenauers war sehr erfolgreich: Deutschlands Souveränität war weitgehend wiederhergestellt. Ihr Ansehen im internationalen Staatengefüge war gestiegen, das Wirtschaftswunder brachte die notwendigen ökonomischen Vorrausetzungen dafür. Aber der Stachel der Teilung blieb vorhanden – und auch das Verantwortungsgefühl gegenüber dem ‚anderen Deutschland’.
Neben vielen anderen – besonders innenpolitisch bedeutsamen - Reformen sprach der neu gewählte Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung vor allem auch von seinen außenpolitischen Vorhaben:
„Aufgabe der praktischen Politik in den jetzt vor uns liegenden Jahren ist es, die Einheit der Nation dadurch zu wahren, dass das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird.
(...) 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern, also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse, denn es hat seine Bedeutung auch für den Frieden in Europa und für das Ost-West-Verhältnis. (...)
Die Bundesregierung wird sich gemeinsam mit ihren Verbündeten konsequent für den Abbau der militärischen Konfrontation in Europa einsetzen. (...) In Fortsetzung der Politik ihrer Vorgängerin erstrebt die Bundesregierung gleichmäßig verbindliche Abkommen über den gegenseitigen Verzicht auf Anwendung von oder Drohung mit Gewalt. Die Bereitschaft dazu gilt (..) auch gegenüber der DDR.“[4]
[...]
[1] North Atlantic Treaty Organization
[2] Siehe dazu Manfred Knapp: „Zusammenhänge zwischen der Ostpolitik der BRD und den deutsch-amerikanischen Beziehungen“ in: Jahn, Egbert/Rittberger, Volker (Hrsg.): Die Ostpolitik der Bundesrepublik. Triebkräfte, Widerstände, Konsequenzen.; Westdeutscher Verlag: Gütersloh 1974; 157-179, hier S. 160
[3] Knapp, Manfred: a. a. O. S. 161
[4] Regierungserklärung von Bundeskanzler Willy Brandt, am 28.10.1969 vor dem Bundestag in Bonn; abgedruckt in: Keller, Horst (Hrsg.): Bonner Texte. Das Jahrzehnt der Utopisten. Bonner Regierungskoalition 1969-1979; Bonn Aktuell GmbH: Stuttgart; 1979
Häufig gestellte Fragen
War Brandts Ostpolitik ein Bruch mit Adenauers Politik?
Die Arbeit argumentiert, dass Brandts Ostpolitik kein Bruch, sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung des außenpolitischen Profils unter Einbeziehung neuer Realitäten war.
Was bedeutet „Wandel durch Annäherung“?
Dies war das Leitmotiv der Ostpolitik, das darauf abzielte, durch Entspannung und Verträge mit dem Osten langfristig die Teilung Deutschlands zu überwinden.
Wie reagierten die USA auf Brandts Ostpolitik?
Die Beziehungen zu den USA waren geprägt von der Notwendigkeit, die Westbindung aufrechtzuerhalten, während man gleichzeitig eigenständige Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion betrieb.
Welche Rolle spielt der Neorealismus in dieser Analyse?
Die Theorie des Neorealismus nach Kenneth Waltz hilft zu erklären, wie sich die Machtverhältnisse zwischen den Supermächten auf die deutsche Außenpolitik auswirkten.
Was war das Ziel der sozial-liberalen Außenpolitik?
Ziel war die Wahrung der nationalen Einheit durch ein geregeltes Nebeneinander der beiden deutschen Staaten und den Abbau militärischer Konfrontation in Europa.
- Quote paper
- Sabrina Sailer (Author), 2006, Die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233024