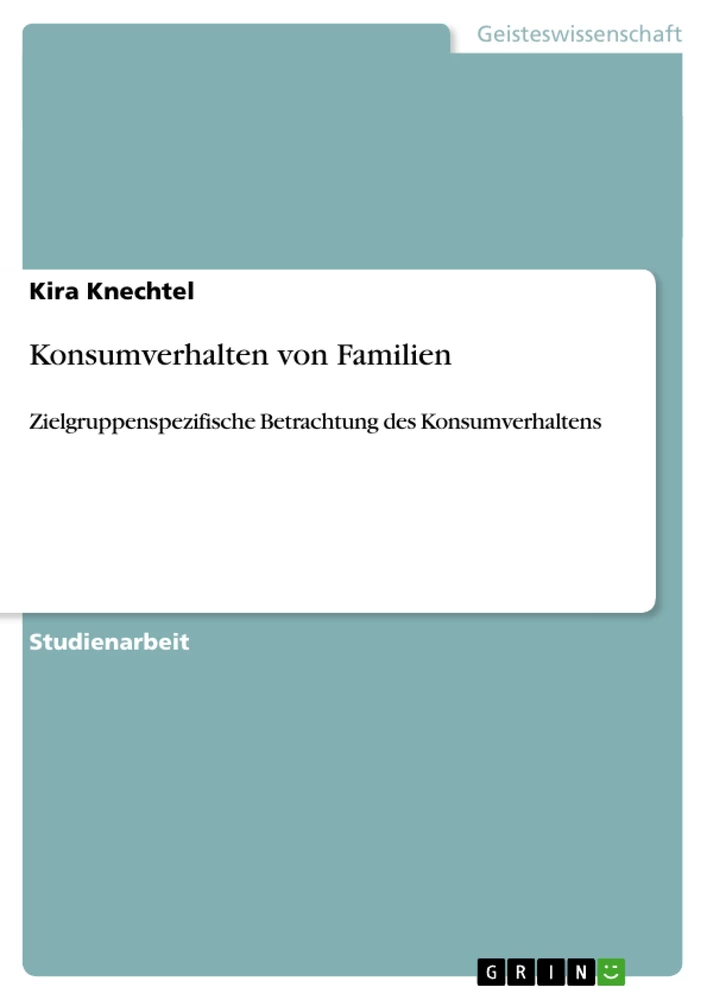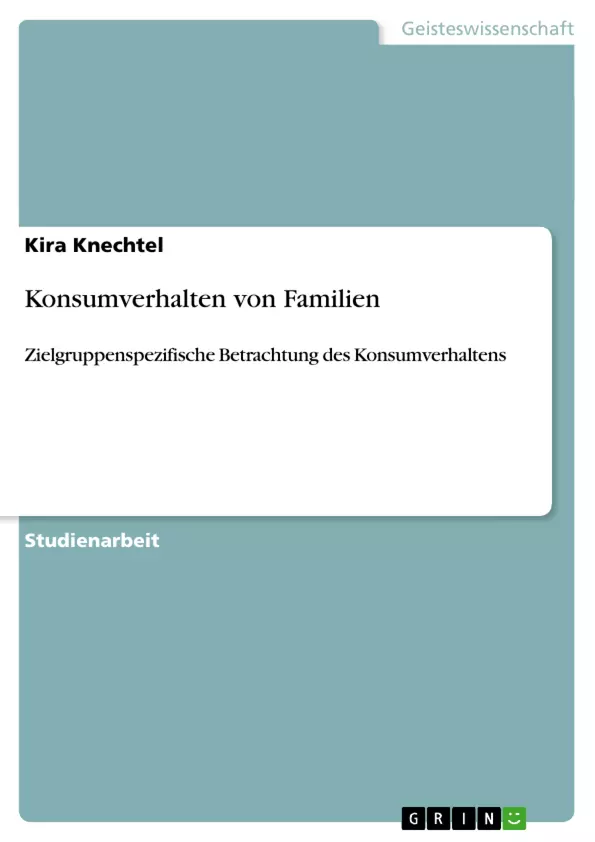Wie in anderen Industriestaaten, so herrscht auch in Deutschland eine Konsumgesellschaft.
Während Gegenstand der Konsumforschung das Konsumverhalten verschiedener Gruppen ist, um Marketingstrategien auszunutzen, so versuchen Soziologen und Sozialpädagogen, die Interaktionen der Familienmitglieder zu erklären. Dazu gibt es zahlreiche Studien, in denen die Einflussverteilung zwischen den Partnern herausgefunden werden soll.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, eine Übersicht über das Konsumverhalten von Familien zu geben und die Vernetztheit des Kaufentscheidungsprozesses aufzuzeigen.
Zunächst erfolgt die Begriffsklärung von Konsum und Familie. Danach werden die Determinanten des Konsumverhaltens, welche den Hauptteil bilden, geschildert. Hierbei findet die Erörterung der demographischen Merkmale der Akteure statt. Weiterhin wird der Entscheidungskontext dargestellt und anschließend die Interessen, Sachkenntnisse und Erfahrungen der Familienmitglieder betrachtet. Nach der Bedeutung der Einflussfaktoren wird im weiteren Verlauf auf die verschiedenen Forschungsansätze eingegangen und im Schlussteil ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Definitionen
2.1 Familienbegriff
2.2 Konsumbegriff
3 Determinanten des Konsumverhaltens
3.1 Demographie der Akteure
3.1.1 Alter und Geschlecht
3.1.2 Anzahl der Familienmitglieder:
3.1.3 Sozialer Status (Einkommen) und Kulturkreis
3.1.4 Beziehungen
3.2 Entscheidungskontext
3.3 Interessen, Sachkenntnisse und Erfahrung
4 Erklärungsansätze
5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einführung
Wie in anderen Industriestaaten, so herrscht auch in Deutschland eine Konsumgesellschaft.
Während Gegenstand der Konsumforschung das Konsumverhalten verschiedener Gruppen ist, um Marketingstrategien auszunutzen, so versuchen Soziologen und Sozialpädagogen, die Interaktionen der Familienmitglieder zu erklären (Meyer, Bohr 1988, S. 120 f.). Dazu gibt es zahlreiche Studien, in denen die Einflussverteilung zwischen den Partnern herausgefunden werden soll.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, eine Übersicht über das Konsumverhalten von Familien zu geben und die Vernetztheit des Kaufentscheidungsprozesses aufzuzeigen.
Zunächst erfolgt die Begriffsklärung von Konsum und Familie. Danach werden die Determinanten des Konsumverhaltens, welche den Hauptteil bilden, geschildert. Hierbei findet die Erörterung der demographischen Merkmale der Akteure statt. Weiterhin wird der Entscheidungskontext dargestellt und anschließend die Interessen, Sachkenntnisse und Erfahrungen der Familienmitglieder betrachtet. Nach der Bedeutung der Einflussfaktoren wird im weiteren Verlauf auf die verschiedenen Forschungsansätze eingegangen und im Schlussteil ein Fazit gezogen.
2 Definitionen
Um sich mit dem Konsumverhalten von Familien auseinandersetzen zu können, sind zunächst die mehrdimensionalen oder besser gesagt die vielschichtigen Begriffe „Familie“ und „Konsum“ zu klären.
2.1 Familienbegriff
Wenn das Wort „Familie“ fällt, hat vermutlich jeder eine gewisse Vorstellung, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Um keine falschen Assoziationen hervorzurufen, wird hier in erster Linie von der klassischen Kernfamilie ausgegangen, da nachfolgend die Rede von Partnern, engen Beziehungen und Paaren ist. Allerdings lassen sich die Ausführungen ebenso auf erweiterte Familiensysteme übertragen (Meyer, Bohr 1988, S. 120). Hierbei findet der traditionelle Familienbegriff, dies ist die „Vater-Mutter-Kind-Familie“, Anwendung. Aus den zugrundeliegenden Quellen geht jedoch nicht hervor, ob der Mann auch der Vater ist und ob mindestens ein Kind in einer Familien leben muss, um von Familie zu sprechen. Ebenso fehlen Angaben zum Alter der Kinder. Demnach liegt nicht der kindzentrierte Familienbegriff dieser Ausarbeitung zugrunde.
2.2 Konsumbegriff
Ebenso wie der Familienbegriff ist auch der Konsumbegriff Auslegungssache. Hier ist jedoch nicht der Konsumbegriff der Marktforschung im Focus, welcher sich primär mit den Trends des Konsums und den Marketingentscheidungen beschäftigt, sondern vielmehr der ökonomische, soziologische und haushaltswissenschaftliche Konsumbegriff.
In dieser Ausarbeitung wird der Konsumbegriff der verschiedenen Disziplinen berücksichtigt. Unter Anderem die Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Familienmitglieder, das soziale Handeln innerhalb der Gemeinschaft und natürlich auch die Handlungsspielräume, die durch die gegebenen Ressourcen beeinflusst werden.
3 Determinanten des Konsumverhaltens
Bevor konsumiert werden kann, müssen Entscheidungen getroffen werden. Im Folgenden wird auf die Einflussfaktoren des Kaufentscheidungsprozesses eingegangen, denn ein klares Muster zum Konsumverhalten von Familien gibt es nicht. Im Alltagsgeschehen determinieren viele Faktoren den Handlungsprozess. Teilweise wird ein Einkauf geplant und auch nach Plan, z.B. Einkaufszettel, durchgeführt. Teilweise werden aber auch beschlossene Sachen reformiert. Man kann also bei der Verhaltensanalyse einer Familie nicht nach dem klassischen Modell des Homo Oeconomicus gehen, da dieser uneingeschränkt egoistisch und rational handelt und bei diesem Modell psychische und soziale Faktoren nicht berücksichtigt werden (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 186). Um zu zeigen, wie subjektiv und partnerschaftlich dieser Geschehniskomplex abläuft, werden im Folgenden die Determinanten des Konsumverhaltens dargestellt.
3.1 Demographie der Akteure
3.1.1 Alter und Geschlecht
Mit zunehmendem Alter gewinnen Kinder und Jugendliche an Einfluss. Demzufolge haben ältere Kinder generell mehr Mitspracherecht und auch mehr Einfluss, in Bereichen, die nicht deren Angelegenheiten betreffen (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 196). Durch den Kontakt mit Massenmedien entstehen bei Kindern Markenkenntnisse. Bei der Anregungsphase von Kaufentscheidungsprozessen kommt ihnen daher eine große Bedeutung zu. Ebenfalls beeinflussen Kinder das zukünftige Kaufverhalten der Eltern, indem sie den Konsum eines Produktes verweigern (Meyer, Bohr 1988, S. 131). Ebenso ist gut vorstellbar, dass Eltern den Interessen der Kinder nachgeben, um einen potentiellen Konflikt zu vermeiden.
Untersuchungen haben ergeben, dass der Einflussbereich des Mannes stärker ist, wenn es sich um Produkte außerhalb des Haushaltes oder um technische Gegenstände handelt. Frauen hingegen dominieren eindeutig bei Entscheidungen die Güter betreffen, die im Haus benutzt werden, genauso wie sie die Ästhetik bestimmen. Weiterhin zeigte sich, dass bei Entscheidungsinhalten, die die gemeinsame Freizeit betreffen, wie z.B. Urlaub, den Kindern und Jugendlichen mehr Mitspracherecht eingeräumt wird (Meyer , Bohr 1988 , S. 128 ff .).
Allerdings ist der direkte Einfluss von Kindern allgemein nicht sehr hoch. Betrachtet man aber den Einfluss der Kinder als Koalitionspartner, so ist die Abweichung beträchtlich. In 80% der Fälle nutzen Frauen und in 90% der Mann diese Taktik (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 197).
3.1.2 Anzahl der Familienmitglieder
Je mehr Personen in einem Haushalt leben desto schwieriger wird die Entscheidungsfindung, da alle Beteiligten ihre Interessen vertreten (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 181). Demnach sind Gemeinsamkeiten in Kaufentscheidungsprozessen eher selten (Meyer, Bohr 1988, S. 130). Dagegen werden Kinder häufiger in Entscheidungen mit einbezogen, wenn sie in einer Haushaltstruktur leben, in der es nur ein Elternteil gibt (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 196).
In der Familie müssen die unterschiedlichen Haltungen, Motive und Einstellungen der Mitglieder zu einem einheitlichen Konsumverhalten führen, anderenfalls ist ein Kompromiss oder ein Kauf, mit dem alle zufrieden sind, eher unwahrscheinlich (Meyer, Bohr 1988, S. 122).
3.1.3 Sozialer Status, Einkommen und Kulturkreis
Auch der soziale Status und das Einkommen der Familie sind entscheidend. Je nachdem über welche Ressourcen die Familie verfügt und welches Familienmitglied den höchsten Beitrag zum Gesamtbudget beisteuert, variiert der Dominanzbereich.
Sowohl Familien aus der Unterschicht als auch aus der Oberschicht treffen die Entscheidungen meist autonom. Begründet wird dies damit, dass die Oberschichten einen größeren Konsumspielraum haben. Mittelschichten bevorzugen eher partnerschaftliche Entscheidungsfindungen und legen die traditionelle Wertehaltung zugunsten moderner Haltungen ab. Weiterhin ist zu verzeichnen, dass Kindern aus Familien mit niedrigem sozio-ökonomischen Status ein größeres Mitspracherecht zugebilligt bekommen, als die in hohen sozialen Schichten (Meyer, Bohr 1988, S. 133).
Kaynak und Kucukemiroglu (2001) machen darauf aufmerksam, dass nicht nur der soziale Status eine Determinante darstellt, sondern auch der Kulturkreis. So entscheiden Männer in der Türkei eher nach traditionellen Werthaltungen autonom z.B. über einen Autokauf (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 194).
3.1.4 Beziehungen
Das emotionale Verhältnis untereinander und auch das Klima in der Familie beeinflussen Konfliktsituationen. Bei harmonischen Beziehungen sind die Familienmitglieder bereit, ihre eigenen Interessen zugunsten der Partner zu vernachlässigen. Enge Beziehungen zeichnen sich durch Liebe, Gemeinsamkeiten, emotionale Abhängigkeiten, gegenseitigem Austausch, Macht aber auch Fairness aus. In den meisten Fällen versuchen sie durch vertrauensvolle und regelgeleitete Zusammenarbeit gemeinsame oder individuelle Ziele zu erreichen. Um einen gewünschten Endzustand herzustellen, bedarf es der Beschaffung von Ressourcen, wie Geld aber auch Dienstleistungen. Dabei können Teilziele Hilfsbereitschaft, Unterstützung aber auch Zuwendung sein. Demzufolge ist in harmonischen Beziehungen die Übereinstimmung von Präferenzen weitaus höher und somit das Konfliktrisiko deutlich geringer (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 182 ff.).
Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Beziehungsmerkmale und auch Gefühle bei der Analyse von Konsumverhalten nicht außer Acht gelassen werden dürfen, da sie im besonderen emotionalen Kontext mit Entscheidungen der Partner stehen (Kirchler, Walenta, Hölzl 2007, S. 183).
3.2 Entscheidungskontext
Prinzipiell wird von finanziellen bzw. ökonomischen und nicht-finanziellen Entscheidungen gesprochen. Bei finanziellen Entscheidungen geht es um Geldmanagement, wie z.B. Budgetierung des verfügbaren Geldes, Sparentscheidungen, Vermögen und Anlagemanagement und Ausgaben. Diese betreffen sowohl materielle Güter, wie z.B. ein Autokauf, als auch immaterielle Güter, wie z.B. Taxifahrten. Am konfliktträchtigsten sind dabei Geldangelegenheiten. In 88% der Fälle war dies ein Grund für eine Auseinandersetzung. Die nicht-finanziellen Entscheidungen betreffen Angelegenheiten, wie Freizeitaktivitäten, Beziehungen zwischen den Partnern, Hausarbeit und Bedürfnisse der Kinder.
Wenn es um ökonomische Überlegungen geht, hängt der Entscheidungskontext von Faktoren, wie Kaufart und Güterkategorie ab. Kotler (1982) beachtet neben der Nutzungsdauer auch die Kaufgewohnheiten der Konsumenten und teilt die Güter in 3 Kategorien ein. Er unterscheidet hierbei Dienstleistungen und Verbrauchsgüter bzw. Güter des täglichen Bedarfs. Dies sind in der Regel Güter, die häufig gekauft und kurzfristig konsumiert werden, wie z.B. Lebensmittel. Gebrauchsgüter oder auch Güter des gehobenen Bedarfs, wie beispielsweise ein Auto, können zwar häufiger verwendet werden, aber da sie teuer sind, werden sie auch seltener gekauft. Bei Verbrauchsgütern läuft die Kaufentscheidung meist verkürzt und psychisch automatisiert, also „routinemäßig“, ab. Bei Gütern, die selten benötigt werden und solchen, die relativ teuer sind, ist der Entscheidungsprozess meist langwierig. Im Gegensatz dazu wird bei preiswerten Gütern oft weniger gründlich überlegt. Außerdem sind bei teuren Gütern eher alle Beteiligten involviert, vor allem wenn diese einen hohen Zusatznutzen besitzen, wie z.B. Bedeutung für das Ansehen der Familie. Im Wesentlichen hängt der Einfluss der Kinder von der Produktkategorie ab. Das Kleinkinder nicht bei Entscheidungen über Fernsehgeräte mitreden und Teenager weniger Interesse an einer Kaufentscheidung von Waschmaschinen zeigen, dürfte verständlich sein.
[...]
- Quote paper
- M.sc Kira Knechtel (Author), 2010, Konsumverhalten von Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233044