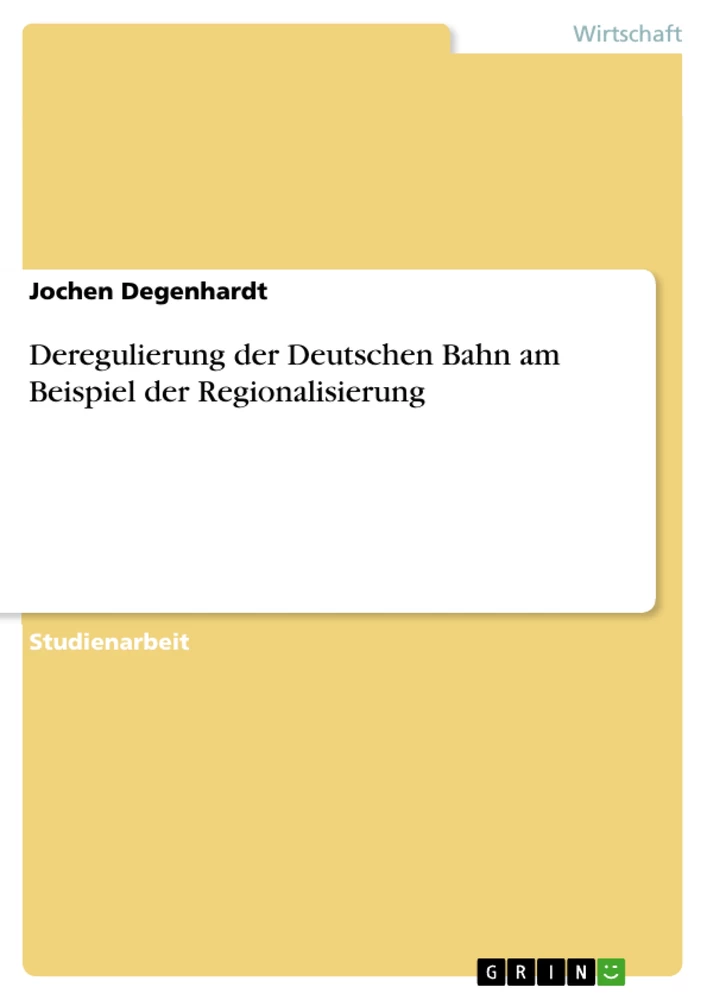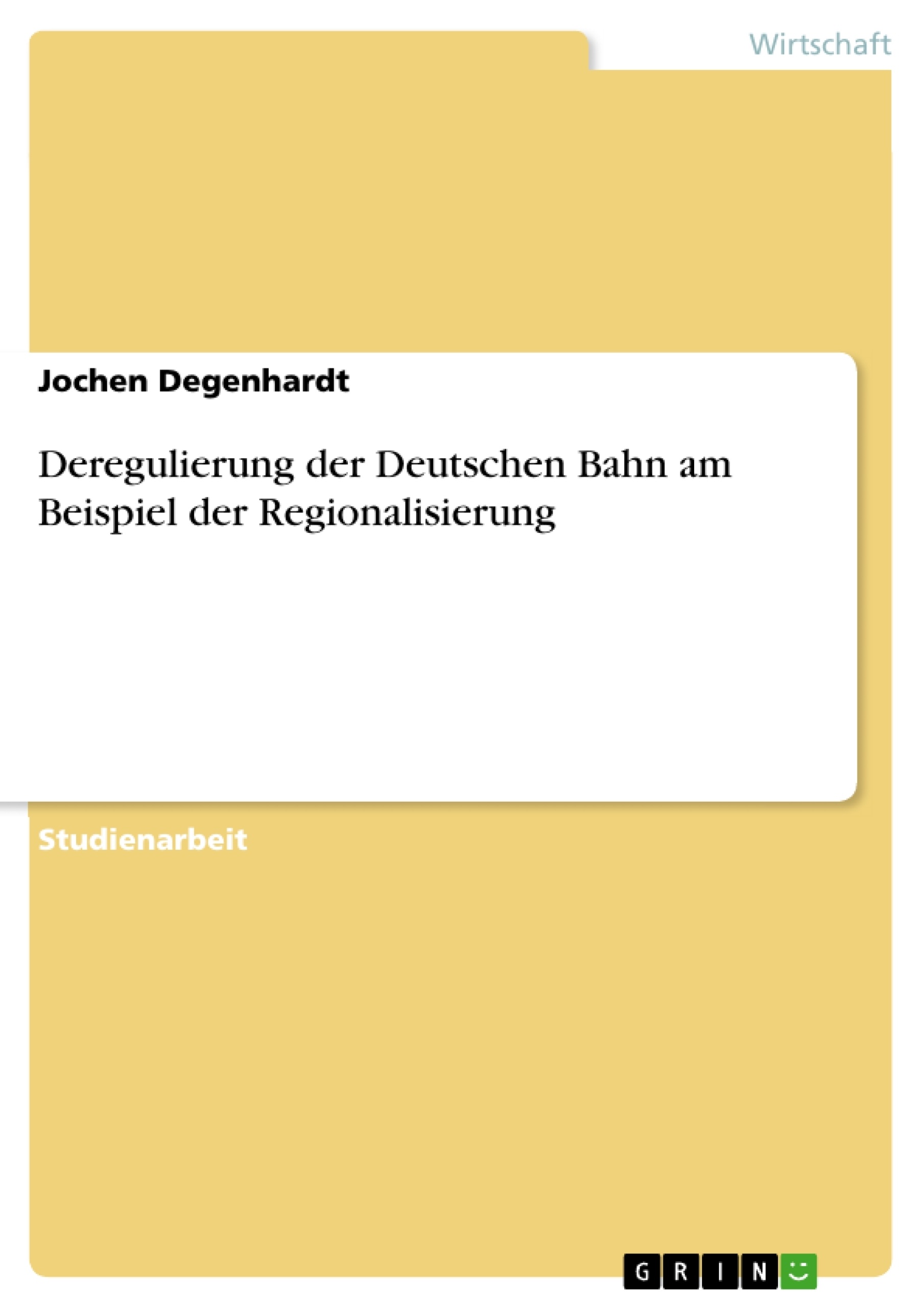Einleitung
Die Deutsche Bundesbahn kostete den Staat seit dem 2. Weltkrieg jährlich steigende Milliardenbeträge an Subventionen und Verlusten, welche zu Beginn der 90er Jahre untragbare Ausmaße angenommen hatten. Zuschuß und Verlust betrugen weit über 20 Mrd. DM, der
Schuldenstand belief sich auf über 58 Mrd. DM. Durch die Fusion mit der Deutschen Reichsbahn der ehemaligen DDR stiegen die Kreditverbindlichkeiten 1993 auf über 70 Mrd. DM.
Die Regierungskommission Bundesbahn prognostizierte im Dezember 1991 einen Finanzbedarf der Deutschen Bahnen in Höhe von 417 Mrd. DM bis zum Jahr 2000 (SAßMANNSHAUSEN, 1991, S.12). Diese Prognose führte 1994 zur Bahnreform, mit der die Bundesregierung
folgende Ziele verfolgte:
„- Stärkere Beteiligung der Schiene an dem zu erwartenden Verkehrswachstum (national und international) durch Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit
der Eisenbahnen erhöhen.
- Rückführung der durch die Eisenbahnen dem Bund erwachsenden finanziellen Belastungen.
- Umsetzung der (...) Vorgaben (der EU) hinsichtlich der unternehmerischen Unabhängigkeit der Eisenbahnen, der Trennung von Infrastruktur und Verkehr, der finanziellen Sanierung der
Unternehmen sowie der Zulassung Dritter zum Schienennetz.“ (BMVBW, 2000, S. 5)
In den letzten sieben Jahren ist hiervon vieles bereits erreicht worden, doch einige Probleme sind bisher noch nicht befriedigend gelöst. Dies soll im folgenden am Beispiel der Regionalisierung
verdeutlicht werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergründe zur Deutschen Bahn
- 2.1. Regulierte Bahn
- 2.2. Grundzüge der Bahnreform
- 3. Regionalisierung der Bahn
- 3.1. Gesetzliche Grundlagen
- 3.2. Die Regio-Bahn in Mettmann
- 3.2.1. Historie
- 3.2.2. Unternehmensstruktur
- 3.2.3. Erfolg
- 4. Interpretation
- 4.1. Staatliches Monopol
- 4.2. Regulierung
- 4.3. Gemeinwohlaufgaben
- 5. Fazit
- 6. Ökonomischer Hintergrund
- 6.1. Preissetzung des monopolistischen Anbieters
- 6.2. Das natürliche Monopol
- 6.3. X-Ineffizienz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Deregulierung der Deutschen Bahn, insbesondere im Kontext der Regionalisierung. Ziel ist es, die Hintergründe der Bahnreform, die Herausforderungen der Regionalisierung und die ökonomischen Aspekte des Übergangs von einem staatlichen Monopol zu einem stärker wettbewerbsorientierten System zu analysieren.
- Die finanzielle Schieflage der Deutschen Bahn vor der Reform
- Die Grundzüge der Bahnreform und ihre Ziele
- Die Herausforderungen der Regionalisierung des Bahnverkehrs
- Der ökonomische Hintergrund des Bahnmonopols und seine Ineffizienzen
- Die Rolle des Staates bei der Bereitstellung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben im Bahnverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die dramatische finanzielle Situation der Deutschen Bahn Anfang der 1990er Jahre, die zu hohen Subventionen und Schulden führte. Sie führt die Ziele der 1994 eingeführten Bahnreform an, die eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, eine Reduzierung der finanziellen Belastung des Bundes und die Umsetzung von EU-Vorgaben zum Ziel hatte. Die Arbeit kündigt an, die Regionalisierung als Beispiel für die noch ungelösten Probleme der Reform zu untersuchen.
2. Hintergründe zur Deutschen Bahn: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des deutschen Bahnverkehrs, beginnend mit privaten Unternehmen bis hin zur Verstaatlichung im Jahre 1920. Es werden die Gründe für die Verstaatlichung diskutiert, darunter die Schaffung eines einheitlichen Netzes und die Beseitigung der Konkurrenz. Der Abschnitt führt dann die Situation der „regulierten Bahn“ aus, die trotz kaufmännischer Grundsätze gemeinwirtschaftliche Aufgaben erfüllen musste, was zu Fehlentwicklungen und dem Verlust von Marktanteilen gegenüber anderen Verkehrsträgern führte. Die zunehmende Bedeutung des individuellen Autoverkehrs wird als ein wichtiger Faktor für den Niedergang der Bahn hervorgehoben.
3. Regionalisierung der Bahn: Dieses Kapitel behandelt die gesetzliche Grundlage und das Beispiel der Regio-Bahn in Mettmann. Es beschreibt die Historie, die Unternehmensstruktur und den Erfolg dieses regionalen Bahnprojekts. Es analysiert, wie die Regionalisierung die Verantwortung für den öffentlichen Nahverkehr auf regionale Gebietskörperschaften überträgt, und beleuchtet die Umsetzung dieser Dezentralisierung in der Praxis. Der Erfolg oder Misserfolg der Regio-Bahn in Mettmann dient als Fallstudie für die Analyse der Herausforderungen und Chancen der Regionalisierung.
4. Interpretation: Dieses Kapitel interpretiert die vorherigen Kapitel und analysiert die verschiedenen Aspekte der Deregulierung der Deutschen Bahn. Es diskutiert das staatliche Monopol, die Regulierung der Bahn und die Herausforderungen bei der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben. Der Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Interessen und Zielkonflikte, die bei der Umsetzung der Bahnreform auftraten. Es wird eine kritische Analyse der Deregulierungsmaßnahmen und ihrer Auswirkungen auf die Effizienz und den Wettbewerb im Bahnsektor vorgenommen.
6. Ökonomischer Hintergrund: Dieses Kapitel erörtert die ökonomischen Grundlagen der Bahnreform. Es beschreibt die Preissetzung eines monopolistischen Anbieters, das Konzept des natürlichen Monopols und die X-Ineffizienz. Die Analysen dieser ökonomischen Prinzipien werden auf die Situation der Deutschen Bahn angewendet und helfen, die Ursachen der vorherigen Ineffizienzen und die Notwendigkeit der Reform besser zu verstehen.
Schlüsselwörter
Deregulierung, Deutsche Bahn, Regionalisierung, Bahnreform, Monopol, Gemeinwohlaufgaben, Wettbewerbsfähigkeit, Ökonomische Effizienz, X-Ineffizienz, Natürliches Monopol, Preissetzung, Verkehrspolitik.
FAQ: Analyse der Deregulierung der Deutschen Bahn
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Deregulierung der Deutschen Bahn, insbesondere im Kontext der Regionalisierung. Sie untersucht die Hintergründe der Bahnreform, die Herausforderungen der Regionalisierung und die ökonomischen Aspekte des Übergangs von einem staatlichen Monopol zu einem stärker wettbewerbsorientierten System.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die finanzielle Schieflage der Deutschen Bahn vor der Reform, die Grundzüge der Bahnreform und ihre Ziele, die Herausforderungen der Regionalisierung des Bahnverkehrs, den ökonomischen Hintergrund des Bahnmonopols und seine Ineffizienzen sowie die Rolle des Staates bei der Bereitstellung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben im Bahnverkehr. Ein detailliertes Beispiel ist die Regio-Bahn in Mettmann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Hintergründe zur Deutschen Bahn (inklusive Regulierte Bahn und Grundzüge der Bahnreform), Regionalisierung der Bahn (mit gesetzlichen Grundlagen und dem Beispiel Regio-Bahn Mettmann: Historie, Unternehmensstruktur und Erfolg), Interpretation (Staatliches Monopol, Regulierung und Gemeinwohlaufgaben), Fazit und Ökonomischer Hintergrund (Preissetzung des monopolistischen Anbieters, natürliches Monopol und X-Ineffizienz).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse der Regio-Bahn in Mettmann?
Die Analyse der Regio-Bahn in Mettmann dient als Fallstudie, um die Herausforderungen und Chancen der Regionalisierung im Bahnverkehr zu beleuchten. Die Arbeit beschreibt die Historie, die Unternehmensstruktur und den Erfolg dieses regionalen Bahnprojekts im Detail, jedoch ohne konkrete Ergebnisse explizit zu nennen. Der Erfolg oder Misserfolg wird als Grundlage für die Bewertung der Regionalisierungsstrategie genutzt.
Welche ökonomischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Preissetzung eines monopolistischen Anbieters, das Konzept des natürlichen Monopols und die X-Ineffizienz im Kontext der Deutschen Bahn. Diese ökonomischen Prinzipien helfen, die Ursachen der Ineffizienzen vor der Reform und die Notwendigkeit der Deregulierung zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deregulierung, Deutsche Bahn, Regionalisierung, Bahnreform, Monopol, Gemeinwohlaufgaben, Wettbewerbsfähigkeit, Ökonomische Effizienz, X-Ineffizienz, Natürliches Monopol, Preissetzung, Verkehrspolitik.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Hintergründe der Bahnreform, die Herausforderungen der Regionalisierung und die ökonomischen Aspekte des Übergangs von einem staatlichen Monopol zu einem stärker wettbewerbsorientierten System zu analysieren.
Wie wird die finanzielle Situation der Deutschen Bahn vor der Reform dargestellt?
Die Einleitung beschreibt die dramatische finanzielle Situation der Deutschen Bahn Anfang der 1990er Jahre mit hohen Subventionen und Schulden als Auslöser für die Bahnreform.
Was waren die Ziele der Bahnreform von 1994?
Die Bahnreform von 1994 zielte auf eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, eine Reduzierung der finanziellen Belastung des Bundes und die Umsetzung von EU-Vorgaben ab.
Wie wird die Rolle des Staates im Bahnverkehr bewertet?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Staates bei der Bereitstellung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben im Bahnverkehr und beleuchtet die Herausforderungen und Konflikte bei der Umsetzung der Deregulierung und der Erfüllung dieser Aufgaben.
- Quote paper
- Jochen Degenhardt (Author), 2002, Deregulierung der Deutschen Bahn am Beispiel der Regionalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2333