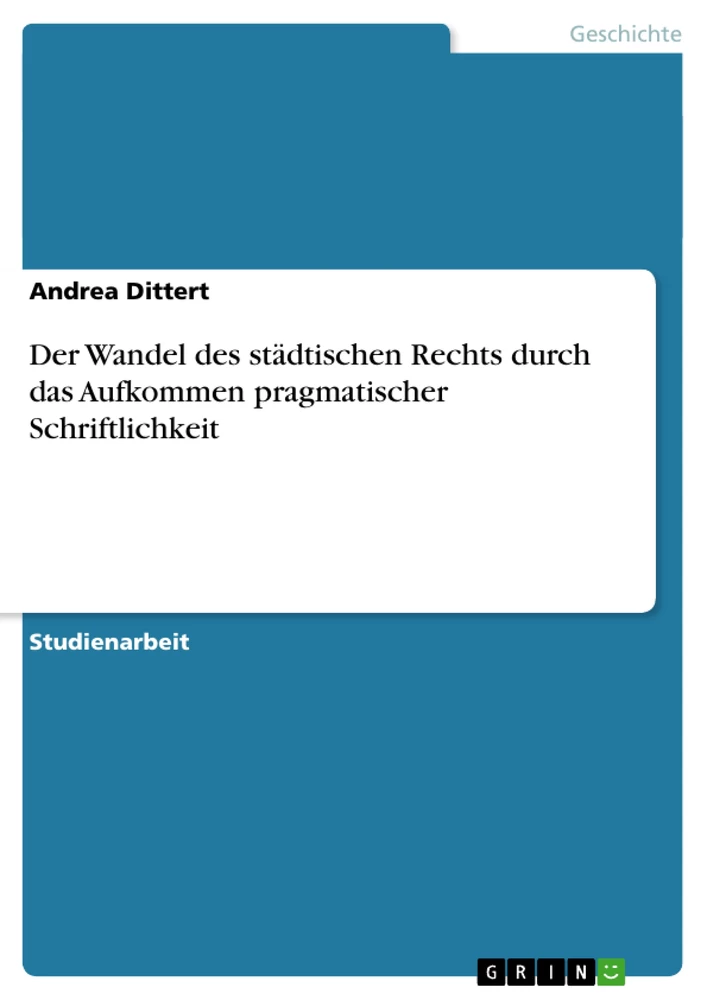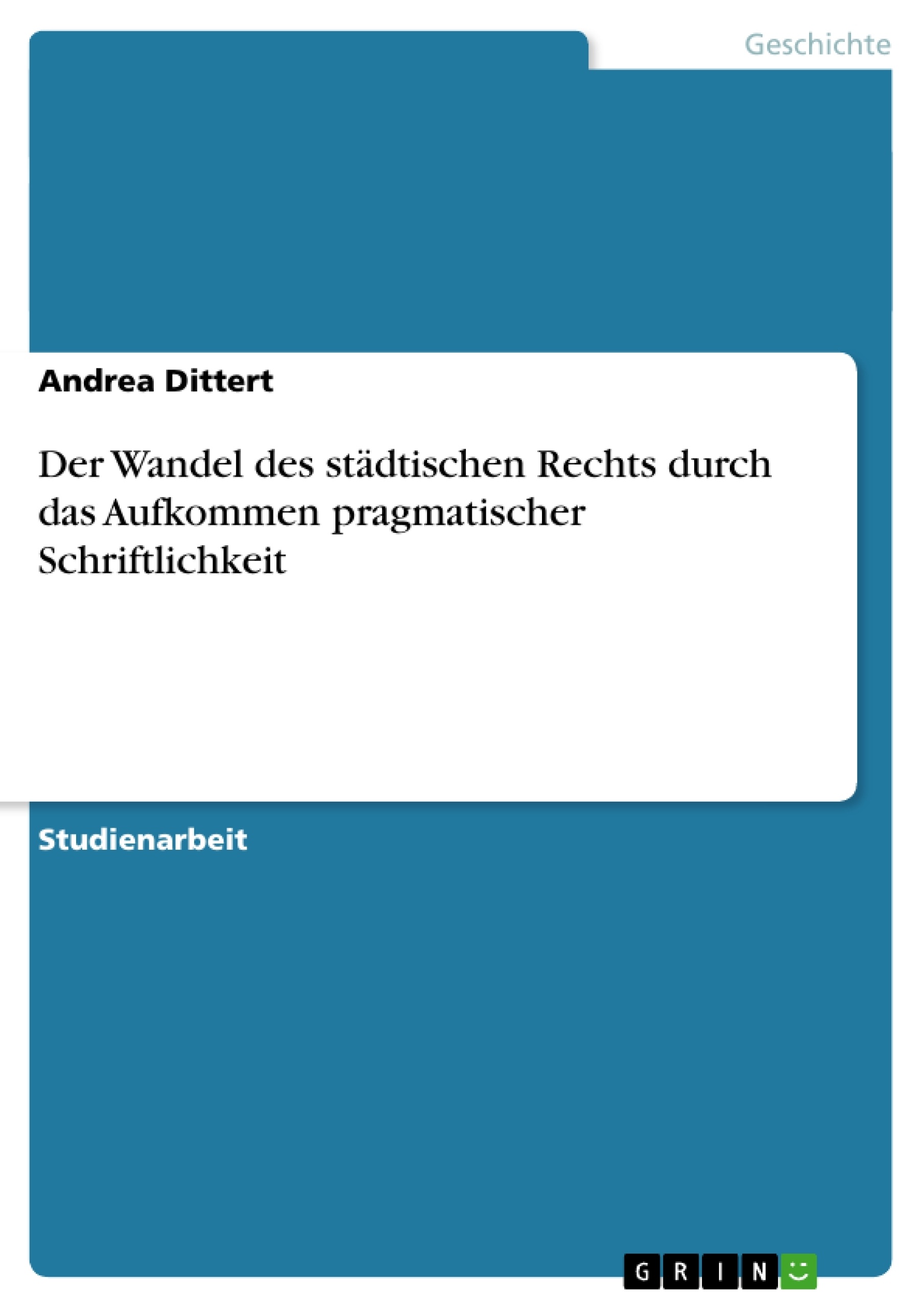[...] Der grundsätzliche Aufbau der Arbeit spiegelt die gewählte Vorgehensweise wider, die in einer
zunehmenden Verengung des Betrachtungsgebietes besteht. So wird im ersten Teil des zweiten Kapitels
zunächst allgemein auf die Frage der Auswirkungen der Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit auf eine Kultur
eingegangen, bevor im zweiten Teil dieses Kapitels der Übergang zum Mittelalter erfolgt. Anschließend
wird (in Kapitel 3) der Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Recht in den
Mittelpunkt der Untersuchung gestellt, alle anderen kulturellen Auswirkungen bleiben ausgeblendet. Im
letzten Kapitel findet eine Verengung auf den städtischen Bereich statt. Die Wahl und die Reihenfolge
der zu untersuchenden Aspekte muß zum einen der grundsätzlichen Vorgehensweise entsprechen, zum
anderen den darzustellenden Zusammenhängen und verwendeten Methoden gerecht werden.
So wird als Methode der Untersuchung für das 3. Kapitel der Analogieschluß gewählt, weil, wie im Kapitel
3.1.1 zum Ausdruck kommen soll, ein direkter Zugang zum ursprünglichen, mittelalterlichen Recht aus der
Quellenproblematik heraus schwierig ist. Um aber unzulässige interkulturelle Vergleiche und Analogieschlüsse
zu vermeiden, muß vorab eine Prüfung der Übereinstimmung der Vergleichsobjekte erfolgen.
Nachdem also im Kapitel 2.1 anhand modernerer Forschungen grundsätzliche Eigenschaften mündlich
geprägter, in ihrer Abweichung von schriftlich geprägten direkt (weil zeitgenössisch) zu untersuchender
Kulturen herausgearbeitet sind, muß notwendigerweise erst eine Einordnung des Mittelalters in die
Bereiche mündlich oder schriftlich geprägter Kulturen erfolgen (Kapitel 2.2.3), bevor die Erkenntnisse aus
dem Kapitel 2.1.2 auf das Mittelalter übertragen werden können. Zur Ermöglichung dieser Einordnung
dient eine ausführliche Beschäftigung mit den Fragen, wer im Mittelalter lesen und schreiben konnte
(Kapitel 2.2.1) und welche Rolle der Schrift zukam (Kapitel 2.2.2)
Da sich der Sachsenspiegel, als erste Verschriftlichung des geltenden Rechts in deutscher Sprache, als
möglicher Übergang vom Mündlichen zum Schriftlichen greifen läßt, soll ihm in dem Teil der Arbeit, der
sich dem Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit und Recht zuwendet, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Dabei soll zuerst geklärt werden, ob es sich bei ihm wirklich ‘nur’ um verschriftlichtes
Recht handelte und welche Beweggründe zu seiner Abfassung geführt haben könnten (Kapitel 3.2.3). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit
- Kulturelle Aspekte der ‘Mündlichkeit - Schriftlichkeit’
- Problematik der Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich geprägten Kulturen
- Kulturelle Auswirkungen der Mündlich- bzw. Schriftlichkeit
- Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Mittelalter
- Schriftkundige im Mittelalter
- Rolle der Schrift im Mittelalter
- Versuch der Einordnung der mittelalterlichen Kultur als mündlich oder schriftlich geprägt
- Kulturelle Aspekte der ‘Mündlichkeit - Schriftlichkeit’
- Schriftlichkeit und Recht im Mittelalter
- Recht in der mündlichen Tradition
- Quellenproblematik
- Rechtsverständnis und Rechtsfindung
- Verschriftlichung des Rechts
- Unterscheidung zwischen schriftlichem und verschriftlichtem Recht
- Gründe und Auswirkungen der Verschriftlichung alten Rechts
- Der Sachsenspiegel: Schriftliches oder verschriftlichtes Recht
- Recht in der mündlichen Tradition
- Schriftlichkeit und Rechtssituation in den Städten
- Pragmatische Schriftlichkeit und Rechtsbedürfnisse in der mittelalterlichen Stadt
- Gründe für die entstehende pragmatische Schriftlichkeit in der Stadt
- Die Bedeutung der Schrift für die Befriedigung städtischer Rechtsbedürfnisse
- Adaptionen und Rechtssetzungen in mittelalterlichen Stadtrechten
- Adaption des Sachsenspiegels in den Stadtrechten
- Adaption des gelehrten römisch-kanonischen Rechts mittels des Sachsenspiegels
- Rechtsschöpferische Leistungen der Städte
- Pragmatische Schriftlichkeit und Rechtsbedürfnisse in der mittelalterlichen Stadt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der pragmatischen Schriftlichkeit auf das Rechtsverständnis im mittelalterlichen städtischen Raum. Sie fokussiert auf die Frage, ob die Veränderungen im städtischen Recht durch das Aufkommen der pragmatischen Schriftlichkeit erklärt werden können.
- Entwicklung der Schriftlichkeit im Mittelalter
- Einfluss der Schriftlichkeit auf das Rechtsverständnis
- Rechtssituation in mittelalterlichen Städten
- Adaption des Sachsenspiegels in städtischen Rechtsordnungen
- Rechtsschöpferische Leistungen der Städte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit
- Das Kapitel analysiert die Problematik der Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich geprägten Kulturen, beleuchtet die kulturellen Auswirkungen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit und diskutiert die Rolle der Schriftlichkeit im Mittelalter.
- Kapitel 3: Schriftlichkeit und Recht im Mittelalter
- Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Recht im Mittelalter, insbesondere die Verschriftlichung des Rechts und die Herausforderungen, die sich aus der Quellenproblematik ergeben.
- Kapitel 4: Schriftlichkeit und Rechtssituation in den Städten
- Das Kapitel widmet sich der pragmatischen Schriftlichkeit in der mittelalterlichen Stadt, beleuchtet die Gründe für deren Entstehung und untersucht die Bedeutung der Schrift für die Befriedigung städtischer Rechtsbedürfnisse. Es analysiert auch die Adaption des Sachsenspiegels in städtischen Rechtssystemen und die rechtsschöpferischen Leistungen der Städte.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Recht, Mittelalter, Stadt, Sachsenspiegel, pragmatische Schriftlichkeit, Rechtsverständnis, Rechtsfindung, Rechtssetzung, Adaption, Rechtsschöpfung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "pragmatische Schriftlichkeit"?
Es bezeichnet den Gebrauch von Schrift für praktische Zwecke wie Verwaltung, Rechtsetzung und Handel, der über die rein sakrale oder literarische Nutzung hinausgeht.
Wie veränderte die Schrift das mittelalterliche Recht?
Durch die Verschriftlichung wurde Recht dauerhaft fixiert, weniger abhängig von der mündlichen Überlieferung und für die städtische Verwaltung besser handhabbar.
Was ist der Sachsenspiegel?
Der Sachsenspiegel ist das bedeutendste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters und markiert den Übergang vom mündlich überlieferten zum schriftlich fixierten Recht.
Warum war Schriftlichkeit für mittelalterliche Städte wichtig?
Städte benötigten klare, schriftliche Regeln für den Handel, die Bürgerrechte und die Abgrenzung gegenüber dem Adel, um ihre Autonomie zu sichern.
Was ist der Unterschied zwischen schriftlichem und verschriftlichtem Recht?
Verscriftlichtes Recht hält bestehende mündliche Traditionen fest; schriftliches Recht wird direkt in Schriftform neu geschaffen (Rechtssatzung).
- Quote paper
- Andrea Dittert (Author), 1999, Der Wandel des städtischen Rechts durch das Aufkommen pragmatischer Schriftlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23330