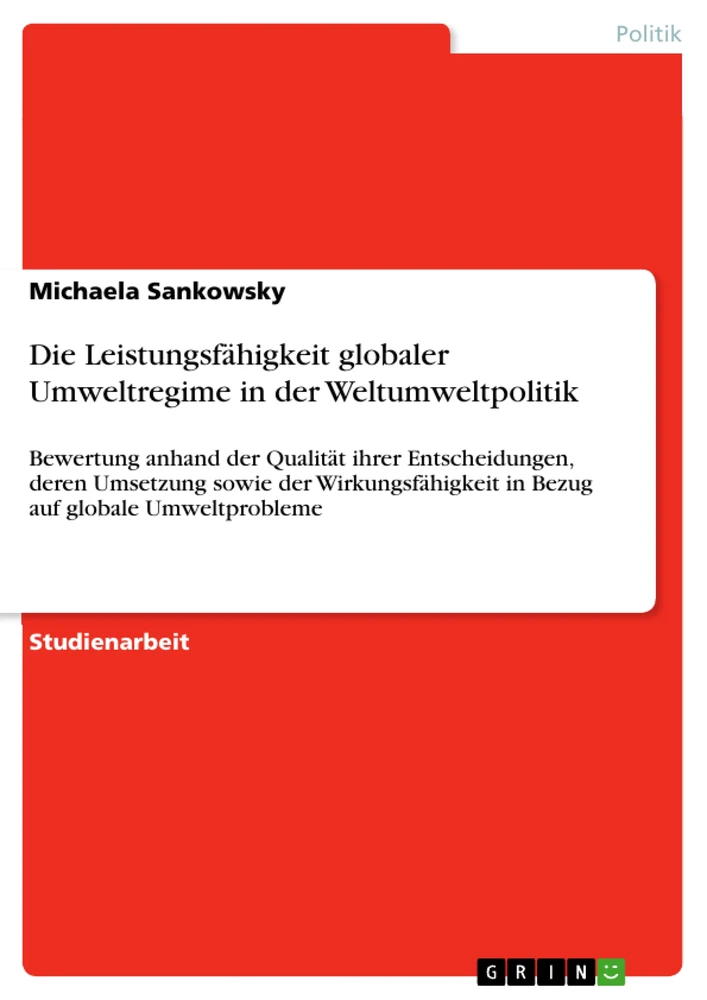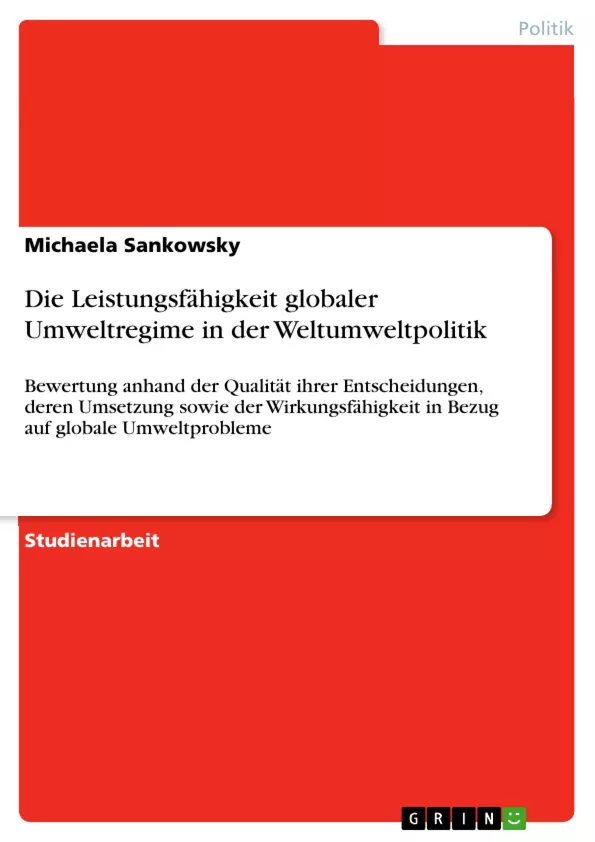In den vergangenen Jahrzehnten ist die Weltgemeinschaft stetig zusammengewachsen: Die weltweite Industrialisierung und die damit verbundene Ausweitung des Weltmarktes haben die Beziehungen der Nationalstaaten immer enger miteinander verknüpft. So wie Gesellschaft und Wirtschaft immer weiter über den nationalen Rahmen hinaus gewachsen sind, haben ebenso die Umweltprobleme an Ausmaß zugenommen – das Ozonloch, die Verschmutzung der Ozeane oder die Zerstörung der Urwälder sind nur wenige Beispiele. Neu an diesen globalen Umweltproblemen ist, dass der einzelne Staat als autonom handelnde Einheit diese Gefahren nicht beseitigen kann und zudem nicht in der Lage ist, sich von den globalen Interpendenzen zu befreien (Rittberger/Zangl 2003:81). Denn der Trend der Globalisierung verbunden mit einer gesellschaftlichen Denationalisierung hat auch dazu geführt, dass die Kapazität von Nationalstaaten, bestimmte Regierungsleistungen zu gewährleisten, zunehmend begrenzt wird (Beisheim 2004:291). Nationale Politiken sind immer weniger in der Lage, die angestrebten Zustände zu erreichen; der Staat verliert an Steuerungskapazität, zentrale Steuerungsressourcen sind außerhalb der nationalen Grenzen verteilt. Dies gilt auch für den Umweltbereich, da globale Umweltprobleme die Steuerungsfähigkeit einzelner Regierungen überfordern, und es noch an ausreichend effektiven internationalen Regelwerken mangelt (Beisheim 2004:291). Ein zentraler Trend der vergangenen Jahrzehnte ist die wachsende Institutionalisierung der zwischenstaatlichen Politik zum Schutz der Umwelt – im Rahmen einer entstehenden „Weltumweltordnung“ regeln heute nahezu 900 multi- und bilaterale Verträge das Verhalten der Staaten (Biermann 2003:270). Die meisten Verträge sehen jedoch nur schwache Sanktionierungen vor, enthalten oft nur schwer überprüfbare Pflichten oder schreiben Standards vor, die die meisten Staaten ohne besondere Anstrengungen erfüllen können. Andererseits funktionieren viele globale Umweltverträge auch ohne spektakuläre Sanktionen, etwa durch nichtrechtliche Prozesse (Biermann
2003:270). So konzentrierten sich die Akteure in vielen Bereichen des
grenzüberschreitenden Umweltschutzes auf die Gründung von internationalen
Regimen, das heißt sie vereinbaren, sich an gewisse Prinzipien, Normen und
Regeln sowie Entscheidungsprozeduren zu halten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internationale Umweltregime
- Beispiele für internationale Umweltregime
- Internationales Regime zum Schutz des Klimas (UNFCCC) (1992)
- Regime über die biologische Vielfalt (CBD) (1992)
- Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) (1973)
- Institutionen
- Prozesse & Strukturen
- Relevante Akteure
- Globale Institutionen
- Nationalstaaten
- Interessenverbände
- Leitende Interessen
- Ressourcen
- Strukturmerkmale transnationaler Umweltproblematiken
- Policy-Problem
- Umfang
- Komplexität (Strukturelle Wirkungszusammenhänge)
- Betroffenheit
- Bewertung der Leistungsfähigkeit von globalen Umweltregimen
- Qualität von Entscheidungen
- Grad der Verrechtlichung
- Qualität der Umsetzung
- Einhaltung
- Wirkungsfähigkeit
- Verhaltenswirksamkeit
- Zusammenfassung: Bewertung der Leistungsfähigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Leistungsfähigkeit globaler Umweltregime in der Weltumweltpolitik. Dabei wird die Qualität ihrer Entscheidungen, deren Umsetzung und die Wirkungsfähigkeit in Bezug auf globale Umweltprobleme analysiert.
- Definition und Charakterisierung internationaler Umweltregime
- Analyse der Strukturmerkmale transnationaler Umweltproblematiken
- Bewertung der Leistungsfähigkeit von globalen Umweltregimen anhand verschiedener Kriterien
- Bedeutung und Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit im Umweltbereich
- Mögliche alternative institutionelle Formen für eine „Weltumweltinstitution“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der internationalen Umweltregime ein und erläutert die wachsende Bedeutung globaler Umweltprobleme im Kontext der Globalisierung. Es werden zentrale Fragen zur Wirksamkeit und Gestaltung von Umweltregimen aufgeworfen.
Kapitel 1 beleuchtet die Definition und Funktionsweise von internationalen Umweltregimen und stellt drei Beispiele – das Klimaregime (UNFCCC), das Regime über die biologische Vielfalt (CBD) und das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) – vor.
Kapitel 2 fokussiert auf die Strukturmerkmale transnationaler Umweltproblematiken. Dabei werden Aspekte wie die Definition des Policy-Problems, der Umfang, die Komplexität und die Betroffenheit von Umweltproblemen beleuchtet.
Kapitel 3 bewertet die Leistungsfähigkeit von globalen Umweltregimen anhand verschiedener Kriterien. Die Qualität von Entscheidungen, die Qualität der Umsetzung und die Wirkungsfähigkeit von Umweltregimen werden untersucht. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der internationalen Zusammenarbeit im Umweltbereich.
Schlüsselwörter
Internationale Umweltregime, globale Umweltprobleme, Nachhaltigkeit, Transnationale Umweltproblematiken, Umweltpolitik, Entscheidungsprozesse, Implementation, Wirksamkeit, Internationale Organisationen, Weltumweltordnung, Kyoto-Protokoll, UNFCCC, CBD, CITES.
Häufig gestellte Fragen
Was sind internationale Umweltregime?
Internationale Umweltregime sind zwischenstaatliche Vereinbarungen, bei denen sich Akteure an Prinzipien, Normen, Regeln und Entscheidungsprozeduren zum Schutz der Umwelt halten.
Welche Beispiele für Umweltregime werden genannt?
Genannt werden das Klimaschutzregime (UNFCCC), das Regime über die biologische Vielfalt (CBD) und das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES).
Warum verlieren Nationalstaaten an Steuerungskapazität in der Umweltpolitik?
Durch Globalisierung und gesellschaftliche Denationalisierung können einzelne Staaten globale Umweltprobleme wie das Ozonloch nicht mehr autonom lösen.
Wie wird die Leistungsfähigkeit dieser Regime bewertet?
Die Bewertung erfolgt anhand der Qualität von Entscheidungen (Verrechtlichung), der Qualität der Umsetzung (Einhaltung) und der Wirkungsfähigkeit (Verhaltenswirksamkeit).
Welche Rolle spielen Sanktionen in globalen Umweltverträgen?
Die meisten Verträge sehen nur schwache Sanktionen vor; viele funktionieren jedoch durch nichtrechtliche Prozesse und freiwillige Standards.
- Quote paper
- Michaela Sankowsky (Author), 2013, Die Leistungsfähigkeit globaler Umweltregime in der Weltumweltpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233327