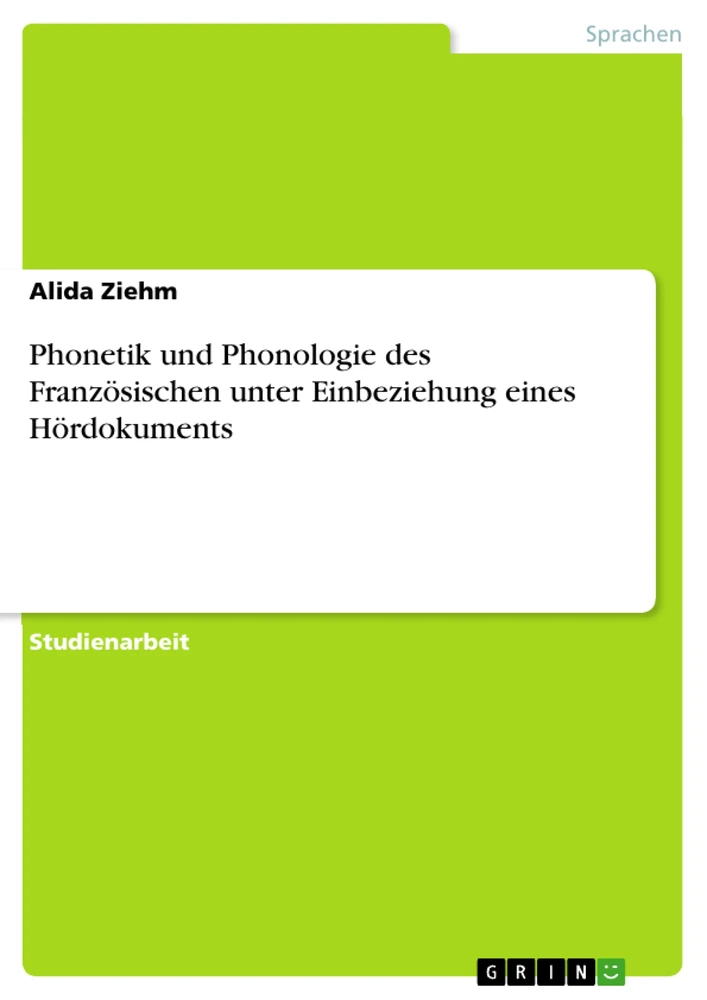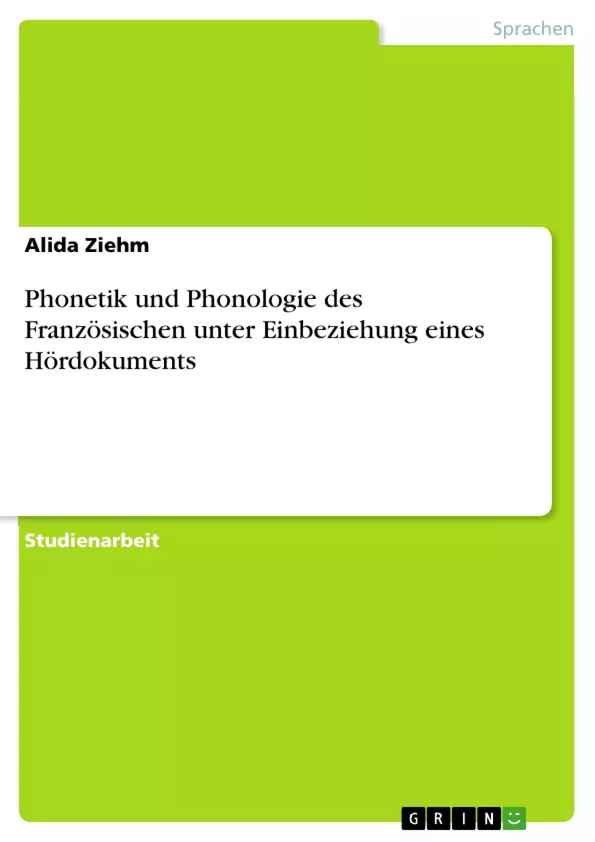Das im Vorfeld für mein Kurzreferat ausgewählte Hördokument: „Le voyage de noces“ soll auch das Thema meiner Hausarbeit sein. Zu diesem Zweck habe ich den eben erwähnten Text vollständig transkribiert (im Anhang zu sehen). In diesem Hörtext berichtet eine junge Frau von ihrer Hochzeitsreise nach Saint-Martin (einer Insel nördlich von Guadeloupe). Sie erzählt, wie sie und ihr Mann dorthin gekommen sind und was sie dort zusammen erlebt haben. Sie verbindet mit dieser Reise nur Positives, so empfand sie sowohl den Flug als auch den dortigen Aufenthalt (inklusive Hotel, Essen, Ausflüge) als angenehm.
Ursprünglich kommt diese Frau aus der Gegend um Paris, wohnt aber zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Alpes Maritimes (im Süden Frankreichs). Beim Hören des Textes fielen mir hinsichtlich der Aussprache der jungen Frau keine speziellen, phonetischen Besonderheiten auf, was man aufgrund ihres Wohnortes hätte erwarten können. Deshalb habe ich mich letztlich dazu entschlossen das Thema Phonetik und Phonologie allgemein darzulegen und die einzelnen Unterpunkte mit Beispielen aus dem Dokument zu versehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phonetik und Phonologie
- Ursprünge
- Phonetik
- Phonologie
- Lautbildung
- Allgemeines
- Vokale
- Oralvokale
- Das E caduc
- Nasalvokale
- Assimilation
- Bibliographie
- Abbildungsverzeichnis
- Transkription: „Le voyage de noces“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Phonetik und Phonologie des Französischen zu erläutern, wobei das Hördokument „Le voyage de noces“ als Beispielmaterial dient. Die Arbeit analysiert die sprachlichen Besonderheiten des Hörtextes und beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Phonetik und Phonologie in Bezug auf die französische Sprache.
- Die Entstehung und Bedeutung der Begriffe Phonetik und Phonologie
- Die verschiedenen Teilbereiche der Phonetik: Artikulatorische, Akustische und Auditive Phonetik
- Die Funktion und das System der Phonologie in der französischen Sprache
- Die Bildung von Lauten, einschließlich der Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten
- Die Eigenschaften von Vokalen und Konsonanten in der französischen Sprache, einschließlich der Unterscheidung zwischen Oral- und Nasalvokalen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Hördokument „Le voyage de noces“ vor und erläutert den Hintergrund der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit den Begriffen Phonetik und Phonologie und deren Ursprünge. Es werden die verschiedenen Teilbereiche der Phonetik, die sich mit der Produktion, Übertragung und Wahrnehmung von Lauten beschäftigen, vorgestellt. Kapitel 2.3 analysiert die Phonologie als funktionale Lautwissenschaft und ihre Bedeutung für das Verständnis der Lautstruktur einer Sprache. Kapitel 3 widmet sich der Lautbildung und stellt den Prozess der Sprachproduktion vom Gehirn des Sprechers bis zum Ohr des Hörers dar. Dabei werden die Funktionen des Gehirns, die Stimmwerkzeuge und die verschiedenen Arten von Lauten (stimmhaft und stimmlos) detailliert beschrieben. Schließlich werden in Kapitel 3.2 die Eigenschaften von Vokalen und Konsonanten im Französischen, einschließlich der Unterscheidung zwischen Oral- und Nasalvokalen, erläutert.
Schlüsselwörter
Phonetik, Phonologie, französische Sprache, Lautbildung, Vokale, Konsonanten, Oralvokale, Nasalvokale, Stimmhaft, Stimmlos, Hördokument, „Le voyage de noces“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Phonetik und Phonologie?
Die Phonetik untersucht die physikalische Produktion von Lauten, während die Phonologie die funktionale Rolle der Laute im System einer Sprache analysiert.
Was sind Nasalvokale im Französischen?
Es sind Vokale, bei denen die Luft sowohl durch den Mund als auch durch die Nase entweicht, was ein charakteristisches Merkmal der französischen Sprache ist.
Was bedeutet der Begriff "E caduc"?
Es beschreibt das "stumme e" im Französischen, das je nach Sprechtempo und Position im Wort entweder ausgesprochen wird oder wegfällt.
Wie werden Laute im menschlichen Körper gebildet?
Durch das Zusammenspiel von Gehirn, Stimmwerkzeugen (Lunge, Kehlkopf, Mundraum) und der Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten.
Welche Rolle spielt die Assimilation in der Phonetik?
Assimilation beschreibt die Angleichung eines Lautes an einen benachbarten Laut, um die Aussprache zu erleichtern.
- Quote paper
- Alida Ziehm (Author), 2006, Phonetik und Phonologie des Französischen unter Einbeziehung eines Hördokuments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233419