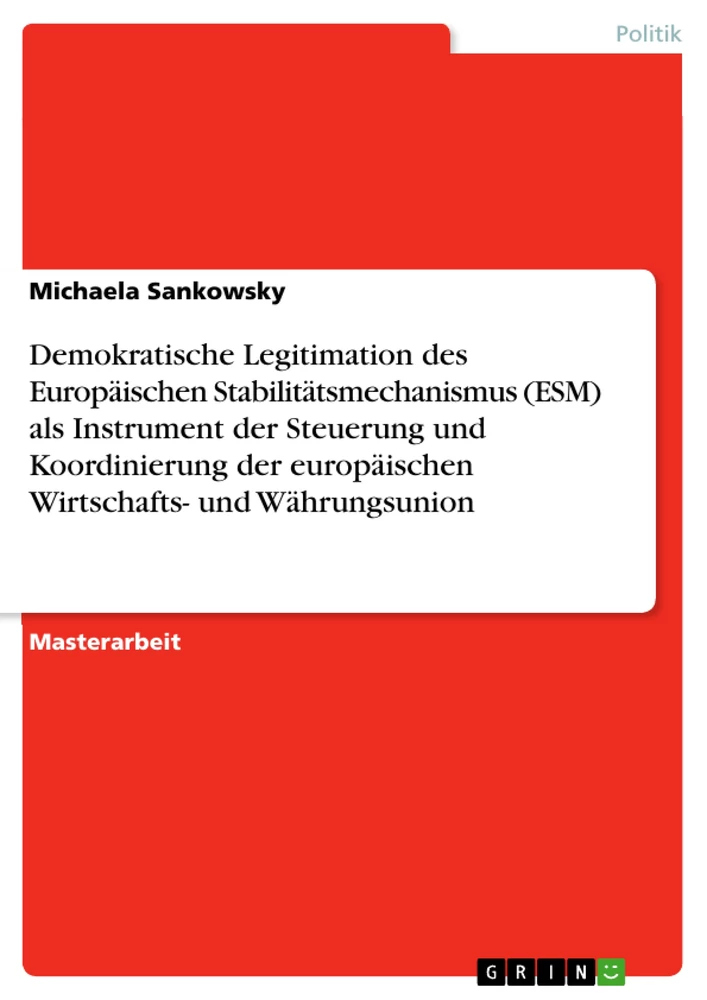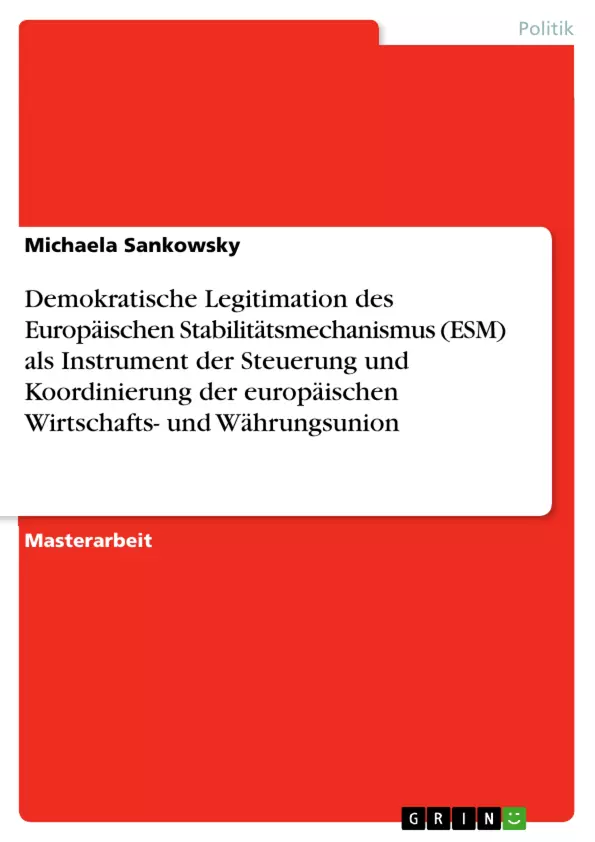Seit Beginn der Finanz- und Verschuldungskrise in der EU wächst der Druck auf die europäischen Institutionen, eine geeignete Strategie zur Krisenbewältigung
zu entwickeln. Mit den finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
einiger Euroländer und deren Abwertung durch internationale Ratingagenturen geriet zudem die Stabilität des Euro in Gefahr. Die EU reagierte mit der Ausschüttung von Rettungshilfen an die Krisenländer und verfestigte diese durch die Gründung der Rettungsfonds EFSM und ESM. Damit sollte die Stabilität des Euro sowie die Liquidität der Krisenländer gewährleistet werden. Mit den Hilfskrediten von EFSM und ESM verbunden ist die Verpflichtung zu Strukturanpassungsprogrammen innerhalb der Länder, die Hilfen beantragen. Jedoch wuchs mit Verwirklichung dieser EU-Krisenpolitik und besonders mit Gründung der dauerhaften Institution ESM der Unmut innerhalb der europäischen Bevölkerung über demokratische Defizite bei der Entscheidung über stetig wachsende Rettungspakete und die sich stetig ausweitende Macht Brüsseler Institutionen über finanzielle Entscheidungen innerhalb der Nationalstaaten. Besonders in Ländern, denen die EU hohe öffentliche Einsparungen auferlegte, wurde offener Protest gegen die europäische Politik laut. Ebenso erfreuten sich antieuropäisch eingestellte
Parteien und Verbände eines großen Zulaufs seitens der Bevölkerung. Grund für
diese Reaktionen war die augenscheinlich fehlende demokratische Legitimation des ESM, auf dessen Gründung und Ausgestaltung die EU-Bürger keinen direkten Einfluss hatten – obwohl er durch Steuergelder finanziert wird. In Deutschland führte die Ratifizierung des ESM sogar zu einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Gericht wies die Klage ab und gab damit den Weg für eine Ratifizierung frei, betonte jedoch erneut die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestags – und zwar auch in Fällen besonderen Handlungsdrucks. Doch die Anwendung von demokratischen Grundsätzen und das Treffen von schnellen, effektiven Entscheidungen schließen sich scheinbar gegenseitig aus. Sind die demokratischen Institutionen und die empfundene „Langsamkeit“ ihrer Verfahren den heutigen finanzpolitischen Herausforderungen noch gewachsen? Um diese Frage zu beantworten ist es nötig, die generellen Governancestrukturen der EU im Hinblick auf ihre demokratische Legitimation zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Prinzip der demokratischen Legitimation
- 1.1 Vorbemerkung
- 1.2 Demokratie und Legitimitätsbegriff
- 1.2.1 Demokratie
- 1.2.2 Legitimation und Legitimität
- 1.2.3 Volkssouveränität
- 1.2.4 Begriff des Volkes
- 1.3 Demokratisches Regieren im Mehrebenensystem
- 1.3.1 Volkssouveränität und Demokratie auf EU-Ebene
- 1.3.2 Die Unionsbürger als Legitimationssubjekt der EU
- 1.4 Zwischenfazit
- 2. Analyse der EU-Governance
- 2.1 Besonderer Charakter europäischen Regierens
- 2.2 Die EU als Mehrebenensystem
- 2.3 Machtverteilung zwischen den EU-Organen
- 2.4 Die EU als eigenständiger Akteur in Europa
- 2.5 Zwischenfazit
- 3. Demokratie und Legitimation der EU
- 3.1 Demokratische Legitimation des EU-Systems
- 3.2 Demokratiedefizit der EU
- 3.2.1 Partizipation (Input)
- 3.2.1.1 Fehlender europäischer Demos
- 3.2.1.2 Fehlende europäische Öffentlichkeit
- 3.2.1.3 Fehlende europäische Parteiensysteme
- 3.2.1.4 Fehlende Legitimationskraft der Europawahlen
- 3.2.2 Prozess (Throughput)
- 3.2.2.1 Ungleichgewicht im Gesetzgebungsprozess
- 3.2.2.2 EP als Repräsentationsorgan ungeeignet
- 3.2.2.3 Fehlende Transparenz im Entscheidungsprozess
- 3.2.3 Ergebnisse (Output)
- 3.2.3.1 EU-Ergebnisse als Output-Legitimation nicht mehr ausreichend
- 3.2.1 Partizipation (Input)
- 3.3 Zwischenfazit
- 4. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
- 4.1 EU-Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion
- 4.2 Geschichte der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- 4.3 Stabilitäts- und Wachstumspakt - Vereinheitlichung der Fiskalpolitik
- 4.4 Die EU-Politik in der Finanzkrise
- 4.5 Zwischenfazit
- 5. Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
- 5.1 Hintergrund
- 5.2 Zweck des ESM
- 5.3 Mitglieder des ESM
- 5.4 Verfahren des ESM
- 5.5 Rechtlicher Rahmen
- 5.6 Finanzierung und Haftung
- 5.7 Laufzeit und Austrittsoptionen
- 5.8 Zwischenfazit
- 6. Analyse der ESM-Governance
- 6.1 Aufbau
- 6.1.1 Gouverneursrat
- 6.1.2 Direktorium
- 6.1.3 Geschäftsführender Direktor
- 6.2 Prozesse und Strukturen
- 6.2.1 Abstimmungsregeln
- 6.2.2 Prüfungsregeln
- 6.3 Akteure
- 6.3.1 EU-Institutionen
- 6.3.2 Mitgliedstaaten
- 6.3.3 Europäisches Volk
- 6.4 Interessen
- 6.4.1 EU-Institutionen
- 6.4.2 Mitgliedstaaten
- 6.4.3 Europäisches Volk
- 6.5 Ressourcen
- 6.5.1 EU-Institutionen
- 6.5.2 Mitgliedstaaten
- 6.5.3 Europäisches Volk
- 6.6 Zwischenfazit
- 6.1 Aufbau
- 7. Demokratie und Legitimation des ESM
- 7.1 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 7.2 Partizipation (Input)
- 7.2.1 Nicht-demokratisches Gremium als ESM-Lenkungsrat
- 7.2.2 Fehlende Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten
- 7.2.3 Verlust der Stimmrechte
- 7.2.4 Verletzung der Informationspflichten des Bundestages
- 7.3 Prozess (Throughput)
- 7.3.1 Verletzung des Haushaltsrechts des deutschen Bundestages
- 7.3.2 Fehlende Laufzeit und Kündigungsoptionen des ESM
- 7.3.3 Unbegrenzte Haftung
- 7.3.4 Berufliche Schweigepflicht
- 7.4 Ergebnisse (Output)
- 7.4.1 Verformung der WWU zu einer Transfer- und Haftungsgemeinschaft
- 7.4.2 Finanzielle Stabilität in der Eurozone
- 7.4.3 Sinkendes Vertrauen der EU-Bürger in europäische Krisenpolitik
- 7.5 Zwischenfazit
- 8. Ratifizierung des ESM-Vertrags in Deutschland
- 8.1 Ratifizierungsdokumente
- 8.2 Gewährleistung der Beteiligung des Bundestages
- 8.3 Gewährleistung der Haushaltshoheit
- 8.4 Informationspflicht
- 8.5 Erhöhung des Stammkapitals
- 8.6 Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die demokratische Legitimation des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) im Kontext der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Ziel ist es, die Governance-Struktur des ESM zu analysieren und deren demokratische Legitimität zu bewerten.
- Demokratiedefizit der EU
- Demokratische Legitimation des ESM
- EU-Governance und Mehrebenensystem
- Analyse der ESM-Governance-Struktur
- Ratifizierung des ESM-Vertrags in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit und skizziert die zentralen Forschungsfragen zur demokratischen Legitimation des ESM. Sie benennt die Notwendigkeit einer eingehenden Analyse der institutionellen Strukturen und Prozesse des ESM sowie seiner Einbettung in das europäische Mehrebenensystem.
1. Prinzip der demokratischen Legitimation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Demokratie, Legitimation und Volkssouveränität und diskutiert deren Anwendbarkeit auf das europäische Mehrebenensystem. Es untersucht das Spannungsverhältnis zwischen nationaler und europäischer Ebene bei der Ausübung demokratischer Souveränität. Die verschiedenen Konzepte der demokratischen Legitimation werden im Detail beleuchtet und auf die Herausforderungen der EU angewandt.
2. Analyse der EU-Governance: Dieses Kapitel analysiert den spezifischen Charakter europäischen Regierens und die Machtverteilung zwischen den EU-Organen innerhalb des Mehrebenensystems. Es beleuchtet den komplexen Prozess der Entscheidungsfindung und die Rolle der verschiedenen Akteure, um das Verständnis der europäischen Entscheidungsarchitektur zu verbessern. Der Fokus liegt auf den institutionellen Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Herausforderungen für die demokratische Legitimation.
3. Demokratie und Legitimation der EU: Hier wird das Demokratiedefizit der EU im Detail untersucht. Es werden die verschiedenen Aspekte des Defizits anhand von Beispielen aus den Bereichen Partizipation (Input), Prozess (Throughput) und Ergebnisse (Output) erläutert. Das Kapitel verdeutlicht die Herausforderungen für eine effektive und legitime Regierungsführung auf EU-Ebene und stellt die Frage, inwieweit die bestehenden Mechanismen der demokratischen Legitimation ausreichen.
4. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte und die Ziele der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Es analysiert den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Reaktion der EU auf die Finanzkrise. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der WWU und den Herausforderungen, die zur Einführung des ESM führten.
5. Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM): Das Kapitel beschreibt die Hintergründe, den Zweck, die Mitglieder, das Verfahren, den rechtlichen Rahmen, die Finanzierung und Haftung sowie die Laufzeit und Austrittsoptionen des ESM. Es bietet einen detaillierten Überblick über die institutionelle Gestaltung des ESM und seine Funktionen im Kontext der europäischen Finanzstabilität.
6. Analyse der ESM-Governance: Dieser Abschnitt analysiert die Governance-Struktur des ESM detailliert. Er beschreibt den Aufbau, die Prozesse und Strukturen, die beteiligten Akteure, ihre Interessen und die verfügbaren Ressourcen. Das Kapitel beleuchtet die komplexen Interaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung im ESM.
7. Demokratie und Legitimation des ESM: In diesem Kapitel wird die demokratische Legitimation des ESM kritisch bewertet. Es werden die verschiedenen Aspekte der Partizipation, des Prozesses und der Ergebnisse im Kontext der demokratischen Legitimität analysiert, unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Die zentrale Frage ist, inwiefern der ESM demokratischen Prinzipien entspricht.
8. Ratifizierung des ESM-Vertrags in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert den Ratifizierungsprozess des ESM-Vertrags in Deutschland. Es befasst sich mit den relevanten Dokumenten, der Beteiligung des Bundestages, der Gewährleistung der Haushaltshoheit, der Informationspflicht und der Erhöhung des Stammkapitals. Es beleuchtet die rechtlichen und politischen Aspekte der Ratifizierung.
Schlüsselwörter
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), Demokratiedefizit, demokratische Legitimation, EU-Governance, Mehrebenensystem, Volkssouveränität, Haushaltshoheit, Bundesverfassungsgericht, Ratifizierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Demokratische Legitimation des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die demokratische Legitimation des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) im Kontext der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Sie analysiert die Governance-Struktur des ESM und bewertet dessen demokratische Legitimität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Demokratiedefizit der EU, die demokratische Legitimation des ESM, die EU-Governance und das Mehrebenensystem, eine detaillierte Analyse der ESM-Governance-Struktur und den Ratifizierungsprozess des ESM-Vertrags in Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Prinzip der demokratischen Legitimation, Analyse der EU-Governance, Demokratie und Legitimation der EU, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Analyse der ESM-Governance und Ratifizierung des ESM-Vertrags in Deutschland. Jedes Kapitel beinhaltet ein Zwischenfazit.
Wie wird die demokratische Legitimation des ESM analysiert?
Die Analyse der demokratischen Legitimation des ESM erfolgt anhand eines Input-Throughput-Output-Modells. Es werden die Partizipationsmöglichkeiten (Input), die Prozesse der Entscheidungsfindung (Throughput) und die Ergebnisse (Output) des ESM kritisch beleuchtet und auf ihre demokratische Legitimität hin untersucht. Dabei spielt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine wichtige Rolle.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und diskutiert?
Zentrale Begriffe wie Demokratie, Legitimation, Volkssouveränität und Haushaltshoheit werden definiert und im Kontext des europäischen Mehrebenensystems diskutiert. Die Arbeit beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen nationaler und europäischer Ebene bei der Ausübung demokratischer Souveränität.
Welche Akteure spielen eine Rolle in der ESM-Governance?
Die Analyse der ESM-Governance umfasst die EU-Institutionen, die Mitgliedstaaten und das europäische Volk. Die Arbeit untersucht die Interessen und Ressourcen dieser Akteure und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung im ESM.
Wie wird die Governance-Struktur des ESM beschrieben?
Die Governance-Struktur des ESM wird detailliert beschrieben, inklusive des Aufbaus (Gouverneursrat, Direktorium, Geschäftsführender Direktor), der Prozesse und Strukturen (Abstimmungsregeln, Prüfungsregeln) und der Interaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren.
Was ist das Fazit der Arbeit bezüglich der demokratischen Legitimation des ESM?
Das Fazit der Arbeit lässt sich nur durch das Lesen der vollständigen Arbeit ziehen. Die Arbeit bewertet kritisch die demokratische Legitimation des ESM und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Governance-Struktur und den Machtverhältnissen im europäischen Mehrebenensystem ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), Demokratiedefizit, demokratische Legitimation, EU-Governance, Mehrebenensystem, Volkssouveränität, Haushaltshoheit, Bundesverfassungsgericht, Ratifizierung.
Wo finde ich das detaillierte Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im oberen Teil des bereitgestellten HTML-Codes enthalten und zeigt die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
- Quote paper
- Michaela Sankowsky (Author), 2013, Demokratische Legitimation des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) als Instrument der Steuerung und Koordinierung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233466