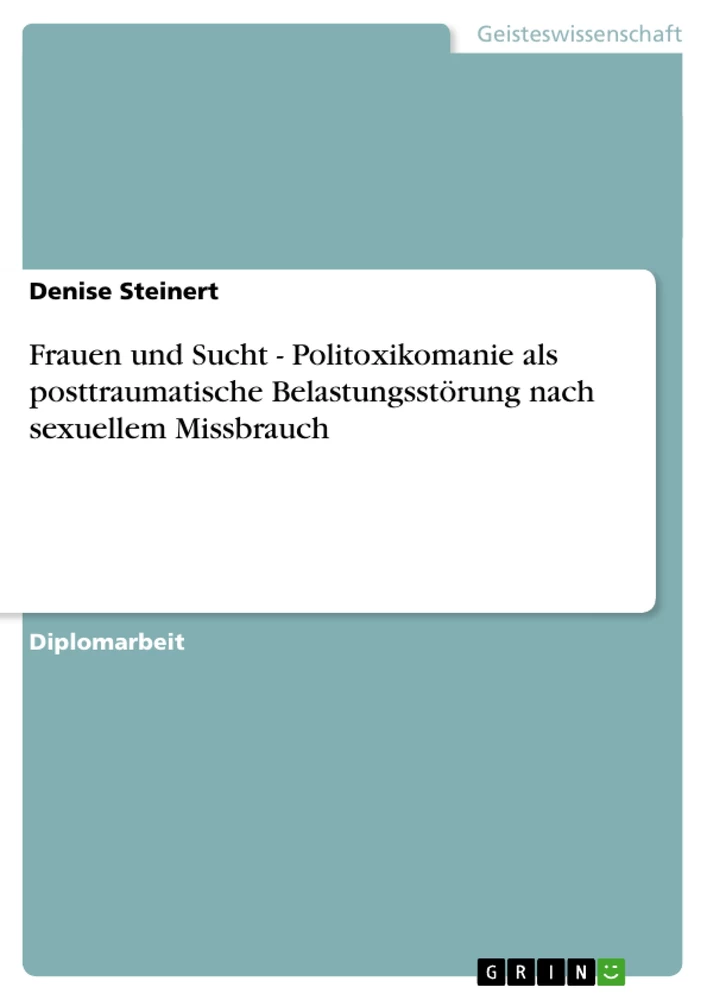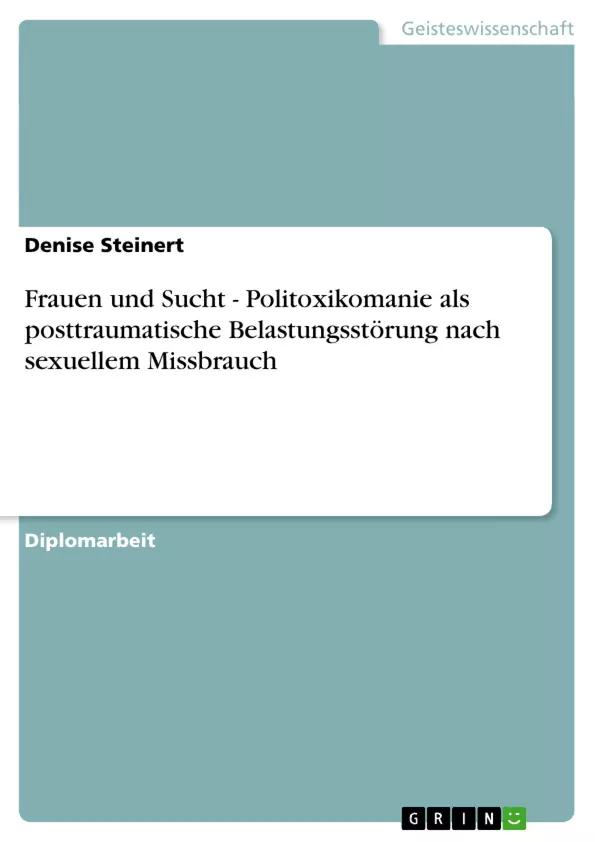[...] Dazu werde ich die vorhandene Literatur auf bisherige Theorieentwicklungen
zum Thema untersuchen und durch die Ergebnisse aus Interviews mit sexuell
missbrauchten Frauen, die polytoxikoman sind, verifizieren, ergänzen bzw.
widerlegen. Im Vordergrund stehen die subjektiven Theorien dieser ehemals
drogenabhängigen Frauen über die Entstehung und Bewältigung ihrer Sucht
vor dem Hintergrund traumatischer Erfahrungen. In der Beschäftigung mit autobiographischem Textmaterial liegt die Möglichkeit
Lebensweltbedingungen lebensecht vermittelt zu bekommen. Mich leiteten die
Fragen: Welche Umstände, welche Bedürfnisse und Erwartungen haben die
Frauen in die Sucht geführt? Welche Funktion haben Drogen erfüllt und welche
Gründe gab es für das Konsumieren mehrerer Drogen parallel? Kann ihre
Sucht als Widerstand gegen ihre Lebenssituation verstanden werden? Welche
Veränderungen gab es, die wichtig für die Entscheidung drogenfrei zu leben,
sind? Wie gehen sie mit ihrer Geschichte und damit verbundenen Gefühlen
um? Bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Sexuellem Missbrauch und
Suchtgenese werde ich zunächst herausarbeiten, was süchtiges Verhalten
ausmacht, wo Sucht anfängt und Suchtmittelgebrauch aufhört. Anschließend
stelle ich das Phänomen der Polytoxikomanie vor. Sexueller Missbrauch wird
nachfolgend näher beleuchtet. Danach werden die Begriffe Trauma und
Posttraumatische Belastungsstörung mit der entsprechenden Symptomatik
erläutert. Im Anschluss an jede Definition findet die Darstellung der jeweiligen
epidemiologischen Grundlagen statt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit
den Theorieansätzen von Sucht und Sexuellem Missbrauch. Da diese Themen
sehr weitläufig sind, beschränke mich auf die für die Arbeit mit süchtigen
Frauen relevanten. Im dritten Kapitel stelle ich die verwendeten Erhebungs- und
Auswertungsmethoden und deren Anwendung für diese Arbeit vor. Die
Einzelauswertung der Interviews wird anhand der gebildeten Kategorien im
vierten Kapitel und die Komparation zentraler übergeordneter Konstrukte im
fünften Kapitel präsentiert. In der Diskussion des sechsten Kapitels werden die
Ergebnisse im Rahmen pädagogischer Praxis und der dargestellten Theorie
abgeglichen. Schließlich erfolgt im siebenten und letzten Teil eine
Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsbestimmung und epidemiologische Grundlagen
- 1.1. Sucht
- 1.1.1. Der Suchtbegriff aus semantischer Sicht
- 1.1.2. Der Suchtbegriff in der Fachsprache
- 1.1.3. Suchtformen
- 1.1.3.1. Stoffgebundene Suchtformen
- 1.1.3.2. Stoffungebundene Suchtformen
- 1.1.4. Suchtkriterien
- 1.1.4.1. Merkmale einer physischen Abhängigkeit
- 1.1.4.2. Merkmale einer psychischen Abhängigkeit
- 1.1.5. Zusammenfassung
- 1.1.6. Befunde frauenspezifischer Suchtforschung
- 1.2. Polytoxikomanie
- 1.2.1. Definition von Polytoxikomanie
- 1.2.2. Der neue Mischkonsum
- 1.2.3. Polytoxikomanie und Frauen
- 1.2.4. Epidemiologische Grundlagen
- 1.3. Sexueller Missbrauch
- 1.3.1. Definition des Begriffs Sexueller Missbrauch
- 1.3.2. Psychische Folgeerscheinungen
- 1.3.3. Epidemiologische Grundlagen
- 1.4. Posttraumatische Belastungsstörung
- 1.4.1. Definition von Trauma
- 1.4.2. Definition des Begriffs Posttraumatische Belastungsstörung
- 1.4.3. Traumabezogene Symptomatik
- 1.4.4. Chronische Dissoziation bei andauerndem Missbrauch
- 1.4.5. Epidemiologische Grundlagen
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Der frauenspezifische Blick auf die Sucht
- 2.1.1. Sucht als Mittel zur Realitätsflucht
- 2.1.2. Sucht als Widerstand
- 2.1.3. Sucht als Überlebensstrategie
- 2.2. Missbrauchstheorien
- 2.2.1. Gesamtgesellschaftliche Ursachen
- 2.2.1.1. Verteilung der Rollen
- 2.2.1.2. Geschlechtsspezifische Sozialisation
- 2.2.1.3. Doppeltes Machtgefälle
- 2.2.1.4. Bild männlicher Sexualität
- 2.2.2. Familiendynamische Ursachen
- 2.2.2.1. Starre Grenzen gegenüber der Gesellschaft
- 2.2.2.2. Verwischung der intrapsychischen Grenzen
- 2.2.2.3. Verwischung der Generationsgrenzen
- 2.2.2.4. Verwischung der interpersonellen Grenzen
- 3. Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden
- 3.1. Erhebung
- 3.1.1. Das problemzentrierte Interview nach WITZEL
- 3.1.2. Vorstellung des Interviewleitfadens
- 3.1.3. Auswahl der Interviewpartnerinnen
- 3.1.4. Verlauf der Erhebung
- 3.2. Datenauswertung: Das „Zirkuläre Dekonstruieren“ nach JAEGGI u.a.
- 4. Einzelauswertung der Interviews
- 4.1. Interview Rosa
- 4.1.1. Zur Person
- 4.1.2. Postskriptum
- 4.1.3. Einzelauswertung
- 4.2. Interview Sonne
- 4.2.1. Zur Person
- 4.2.2. Postskriptum
- 4.2.3. Einzelauswertung
- 4.3. Interview Aina
- 4.3.1. Zur Person
- 4.3.2. Postskriptum
- 4.3.3. Einzelauswertung
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 5.1. Familiensituation
- 5.1.1. Die gespaltene Familie
- 5.1.2. Zwischen Verantwortung und Schuld
- 5.1.3. Normalität
- 5.2. Belastende Lebensereignisse und Bewältigungsstrategien
- 5.2.1. Flucht als Bewältigungsstrategie
- 5.2.2. Selbstheilung und Selbstzerstörung in der Sucht
- 5.2.3. Polytoxikomanie
- 5.2.4. Dissoziation
- 5.3. Weiblichkeitsbild
- 5.3.1. Ablehnung und Anpassung
- 5.3.2. Reproduktion von abhängigen Beziehungen
- 6. Diskussion der Ergebnisse
- 6.1. Befunde über den Zusammenhang von Sucht bzw. Polytoxikomanie und sexuellem Missbrauch
- 6.2. Risikofaktoren für die Suchtgenese
- 6.3. Der Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch, Posttraumatischer Belastungsstörung und Sucht als Überlebensstrategie
- 6.4. Frauenspezifische Suchtarbeit
- 7. Zusammenfassung
- Die Beziehung zwischen sexuellem Missbrauch und Polytoxikomanie
- Die Rolle der posttraumatischen Belastungsstörung in der Entstehung von Sucht
- Die frauenspezifischen Aspekte von Sucht und deren Bewältigung
- Die Bedeutung von Überlebensstrategien im Kontext von Traumatisierung
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der frauenspezifischen Suchtarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Polytoxikomanie bei Frauen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuellen Missbrauch erlitten haben. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen sexuellem Missbrauch, posttraumatischer Belastungsstörung und Sucht als Überlebensstrategie zu untersuchen und die spezifischen Bedürfnisse von Frauen in der Suchtarbeit zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Begriffsbestimmung von Sucht und Polytoxikomanie, wobei der Fokus auf frauenspezifische Aspekte gelegt wird. Es werden auch die relevanten epidemiologischen Daten beleuchtet. Anschließend wird das Thema des sexuellen Missbrauchs und seiner psychischen Folgen, insbesondere der Posttraumatischen Belastungsstörung, behandelt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Missbrauchstheorien und die Bedeutung von gesellschaftlichen und familiendynamischen Ursachen. Im weiteren Verlauf werden die verwendeten Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden vorgestellt, einschließlich des problemzentrierten Interviews und der Methode des „Zirkulären Dekonstruierens“. Es folgt die Einzelauswertung der Interviews, in denen die Lebensgeschichten von drei Frauen mit Polytoxikomanie im Kontext von sexuellem Missbrauch vorgestellt werden. Die Ergebnisse der Auswertung werden anschließend dargestellt, wobei die Schwerpunkte auf der Familiensituation, den belastenden Lebensereignissen und den Bewältigungsstrategien sowie dem Weiblichkeitsbild der Interviewpartnerinnen liegen. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse, wobei der Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch, posttraumatischer Belastungsstörung und Sucht als Überlebensstrategie beleuchtet wird. Darüber hinaus werden die Risikofaktoren für die Suchtgenese und die Notwendigkeit einer frauenspezifischen Suchtarbeit hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Polytoxikomanie, Frauen, sexueller Missbrauch, posttraumatische Belastungsstörung, Sucht, Überlebensstrategie, Frauenspezifische Suchtarbeit, Traumatisierung, Resilienz, psychische Gesundheit.
- Quote paper
- Denise Steinert (Author), 2002, Frauen und Sucht - Politoxikomanie als posttraumatische Belastungsstörung nach sexuellem Missbrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23416