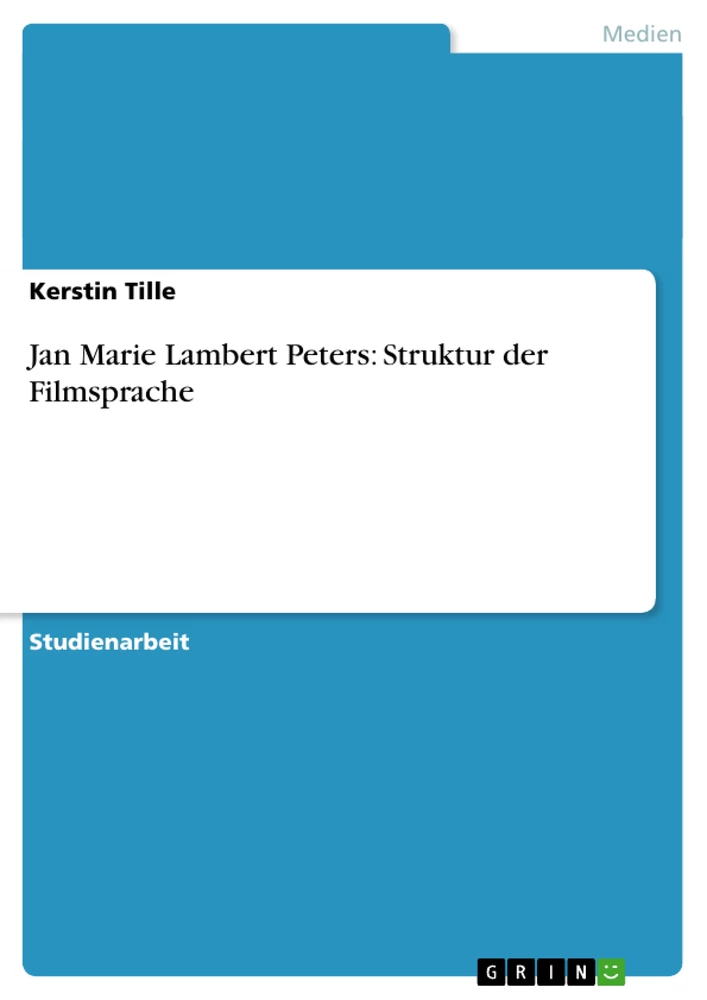Jan-Marie-Lambert Peters wird 1920 in Holland geboren. Er studiert Germanistik und gründet 1958 die Filmhochschule in Amsterdam, zu deren erster Direktor er ernannt wird. In den folgenden Jahren ist der Sprach- und Literaturwissenschaftler als Professor für Filmtheorie an der Universität von Amsterdam tätig und seit 1967 ist Peters Ordinarius für Kommunikationswissenschaft an der Katholischen Universität Leuven. In seinen zahlreichen Werken beschäftigt sich der Niederländer mit Theorien zur Filmsprache und versucht, ähnlich wie sein Kollege Metz, in ihr eine Struktur zu finden. Auf vergleichbarem Wege wie schon andere Filmtheoretiker vor ihm, nähert sich Peters der Filmsemiotik, indem er sie mit den geltenden Regeln der Wortsprache vergleicht. Dabei stößt er allerdings auch auf Widersprüchlichkeiten, die er oft übergeht ohne eine Lösung zu bieten. Diese Arbeit soll seine Überlegungen zur Filmsprache darlegen und eventuelle Schwachstellen in den beiden Aufsätzen „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“ aufzeigen. Die beiden Aufsätze Peters werden nicht klar von einander getrennt behandelt, sondern sind in den einzelnen Untergliederungspunkten verwoben. Dabei wurde für den Gliederungspunkt Montage (2.2.2) stärker der Text „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“ herangezogen. In seinen beiden Aufsätzen formuliert Peters keine eigenen Theorien, wie sie von Eisenstein, Pudowkin, Balasz und anderen aufgestellt worden sind, die in den vorangegangenen Referaten dieses Semesters behandelt worden sind, sondern er analysiert und katalogisiert das Vorhandene, welches sich im Laufe der Filmgeschichte gebildet hat oder auch wieder verloren ging.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufsätze: „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“
- 2.1 Zeichensysteme
- 2.2 Sprachsysteme
- 2.2.1 Kameraperspektive
- 2.2.2 Entwicklung der Filmsprache und der Montage
- 2.2.2.1 Begriffsklärungen
- 2.2.2.2 Spezifisches des filmischen Sehens
- 2.2.3 Funktionen der Montage
- 2.2.4 Einwände gegen die Montage
- 2.2.4.1 Der Tonfilm
- 2.2.4.2 Die Breitwand und „deep-focus“-Objektive
- 2.2.4.3 Manipulation
- 2.3 Formensysteme
- 3. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Aufsätze „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“ von Jan-Marie-Lambert Peters. Ziel ist es, Peters’ Überlegungen zur Filmsprache darzulegen und mögliche Schwächen in seiner Argumentation aufzuzeigen. Die Arbeit verwebt die beiden Aufsätze, wobei der Fokus auf dem zweiten Aufsatz im Kapitel zur Montage liegt.
- Vergleich von Wort- und Filmsprache
- Analyse der Struktur der Filmsprache
- Entwicklung und Funktionen der Filmmontage
- Kritik an Peters' Argumentation
- Die Rolle der Montage in der Filmgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Jan-Marie-Lambert Peters und seine Arbeiten zur Filmtheorie vor. Sie skizziert seine akademische Laufbahn und seine Herangehensweise an die Filmsemiotik, indem er sie mit der Wortsprache vergleicht. Die Arbeit selbst wird als eine Analyse von Peters' Aufsätzen „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“ positioniert, die eventuelle Schwachstellen aufzeigen soll. Es wird betont, dass beide Aufsätze in der Analyse verwoben sind, mit einem stärkeren Fokus auf den zweiten Aufsatz im Kapitel zur Montage.
2. Aufsätze: „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Aufsätze von Peters. Während „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“ sich auf die formale Definition und die psychologischen Aspekte der Montage konzentriert, untersucht „Die Struktur der Filmsprache“ die Filmsprache auf einer breiteren Ebene, die über die bloße Montage hinausgeht. Peters vergleicht Wort- und Filmsprache, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und eine mögliche eigenständige Struktur der Filmsprache zu ermitteln. Das Kapitel hebt die zentralen Fragestellungen beider Aufsätze hervor: die Definition von Montage seit Griffith und ihre ästhetischen Funktionen im einen, und der Vergleich mit der Wortsprache zur Ermittlung einer eigenständigen Struktur der Filmsprache im anderen Aufsatz.
2.1 Zeichensysteme: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Struktur von Zeichen in Wort- und Filmsprache. Peters vergleicht die kleinste Einheit der Wortsprache (das Wort) mit der kleinsten Einheit des Films (die einzelne Aufnahme). Er argumentiert, dass sowohl Wort als auch Bild Zeichen sind, die auf etwas anderes verweisen, jedoch unterschiedliche Arten des Verstehens implizieren: konzeptuelles Verstehen bei der Wortsprache und Wahrnehmungsakt bei der Filmsprache. Die Argumentation weist jedoch Schwächen auf, da der Vergleich der Abstraktionsebenen beider Sprachformen unzureichend ist, da ein Filmbild detailliertere Informationen liefert als ein Wort. Das Kapitel verdeutlicht, wie Filmbilder durch den spezifischen Blickwinkel und die Wahl der Aufnahme Informationen vermitteln und die Aufmerksamkeit des Zuschauers lenken.
Schlüsselwörter
Filmsprache, Filmmontage, Jan-Marie-Lambert Peters, Wort- und Filmsprache Vergleich, Semiotik, Griffith, Kameraperspektive, Filmtheorie, Zeichensysteme, Montagefunktionen, Psychologie der Montage.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Aufsätze von Jan-Marie-Lambert Peters
Was ist der Inhalt der HTML-Datei?
Die HTML-Datei enthält eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit, die die Aufsätze "Die Struktur der Filmsprache" und "Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute" von Jan-Marie-Lambert Peters analysiert. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern. Die Analyse vergleicht die Filmsprache mit der Wortsprache und untersucht die Struktur, Funktionen und Entwicklung der Filmmontage, wobei auch kritische Anmerkungen zu Peters' Argumentation enthalten sind.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Aspekte der Filmtheorie, insbesondere die Filmsprache und die Filmmontage. Es wird ein Vergleich zwischen Wort- und Filmsprache gezogen, die Struktur der Filmsprache analysiert und die Entwicklung und Funktion der Filmmontage, besonders seit Griffith, untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kritik an der Argumentation von Jan-Marie-Lambert Peters und der Rolle der Montage in der Filmgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, das Hauptkapitel "Aufsätze: „Die Struktur der Filmsprache“ und „Theorie und Praxis der Filmmontage von Griffith bis heute“" (unterteilt in Unterkapitel zu Zeichensystemen, Sprachsystemen mit Fokus auf Kameraperspektive, Entwicklung der Filmsprache und Montage, Funktionen und Einwände gegen die Montage) und abschließende Schlußbemerkungen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Peters' Überlegungen zur Filmsprache darzulegen und gleichzeitig mögliche Schwächen in seiner Argumentation aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Wort- und Filmsprache und der Analyse der Struktur und Funktion der Filmmontage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant zusammenfassen, sind: Filmsprache, Filmmontage, Jan-Marie-Lambert Peters, Wort- und Filmsprache Vergleich, Semiotik, Griffith, Kameraperspektive, Filmtheorie, Zeichensysteme, Montagefunktionen, Psychologie der Montage.
Wie wird die Filmmontage in der Arbeit behandelt?
Die Filmmontage wird ausführlich behandelt, insbesondere ihre Entwicklung seit Griffith, ihre Funktionen und die psychologischen Aspekte. Es wird untersucht, wie Peters die Montage definiert und welche ästhetischen Funktionen er ihr zuschreibt. Die Arbeit analysiert auch kritisch die Argumentation von Peters bezüglich der Montage.
Wie wird die Filmsprache im Vergleich zur Wortsprache dargestellt?
Die Arbeit vergleicht systematisch Wort- und Filmsprache, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und eine mögliche eigenständige Struktur der Filmsprache zu ermitteln. Dabei werden die kleinsten Einheiten beider Sprachformen (Wort und einzelne Aufnahme) verglichen und deren jeweilige Funktionsweisen analysiert.
Welche Kritikpunkte werden an Peters' Argumentation geäußert?
Die Arbeit weist auf Schwächen in Peters' Argumentation hin, insbesondere im Vergleich der Abstraktionsebenen von Wort- und Filmsprache. Es wird argumentiert, dass der Vergleich unzureichend ist, da ein Filmbild detailliertere Informationen liefert als ein Wort. Weitere Kritikpunkte werden im Kontext der Montage und deren Funktionen im Laufe der Filmgeschichte behandelt.
- Quote paper
- Kerstin Tille (Author), 1998, Jan Marie Lambert Peters: Struktur der Filmsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23451