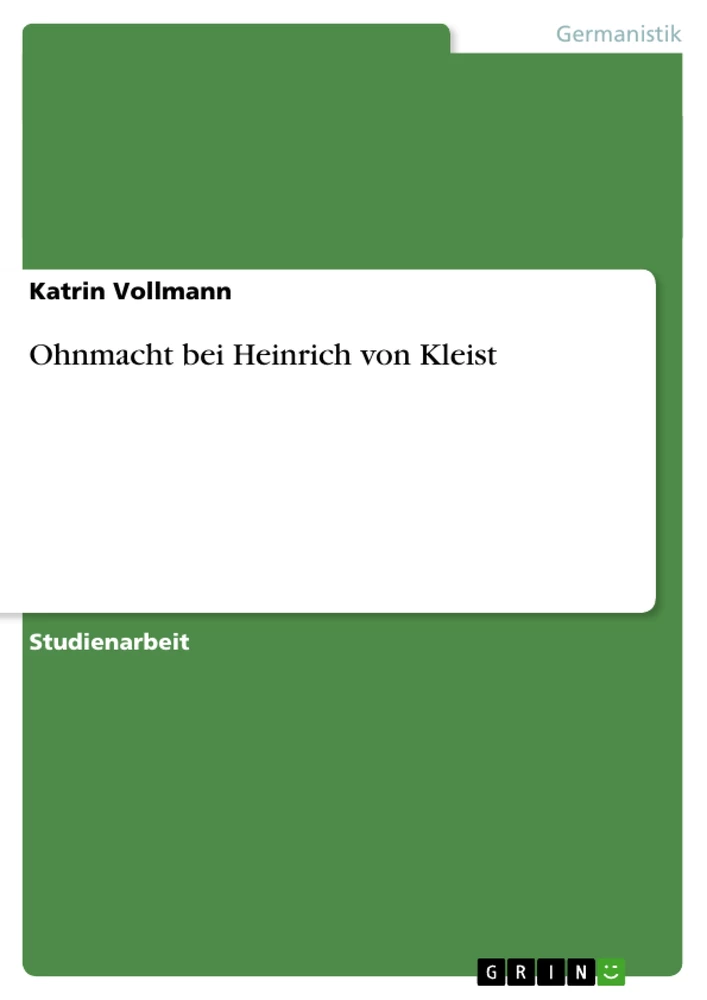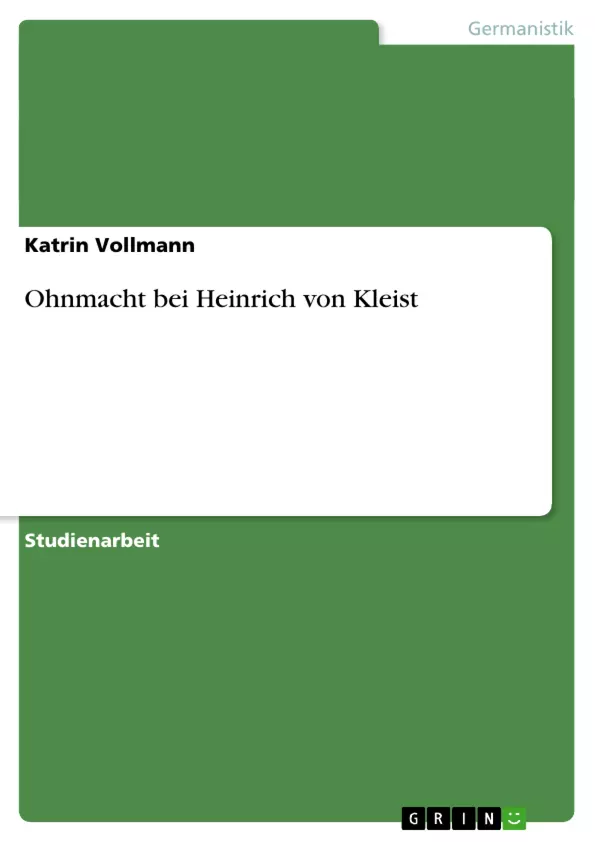Ein zentrales Motiv in Heinrich von Kleists literarischem Werk ist die Ohnmacht. Ohnmachten markieren zentrale, für den weiteren Handlungsverlauf bedeutende Textstellen.
Wie eine Ohnmacht den Verlauf der Handlung beeinflusst, wann und unter welchen Umständen sie auftritt und wer unter ihr zu leiden hat, wird hier, insbesondere anhand der Erzählung "Die Marquise von O..." und des Dramas "Das Käthchen von Heilbronn", zu beantworten versucht.
Die Beschäftigung mit der "Kleistschen Ohnmacht" , mit einem Zustand, in dem der Mensch ohne Bewusstsein ist, wirft die Frage auf, welches Verständnis Kleist von Bewusstsein und Unbewusstsein hatte. In dieser Hinsicht aufschlussreich ist der im Jahre 1810 erschienene Aufsatz "Über das Marionettentheater", sowie die Auseinandersetzung Kleists mit Immanuel Kant, auf die ebenfalls eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen:
- Einleitung
- Kleist und Kant
- Über das Marionettentheater
- Die Marquise von O...
- Inhaltsüberblick
- Bedeutung und Funktion der Ohnmacht
- Das Käthchen von Heilbronn
- Inhaltsüberblick
- Bedeutung und Funktion der Ohnmacht
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Motiv der Ohnmacht im Werk Heinrich von Kleists. Sie untersucht, wie Ohnmachten den Handlungsverlauf beeinflussen, wann und unter welchen Umständen sie auftreten, und wer darunter leidet. Insbesondere werden die Erzählung „Die Marquise von O...“ und das Drama „Das Käthchen von Heilbronn“ herangezogen.
- Die Bedeutung der Ohnmacht als zentrales Motiv in Kleists Werken
- Der Einfluss von Ohnmachten auf den Handlungsverlauf
- Kleists Verständnis von Bewusstsein und Unbewusstsein
- Die Rolle der Vernunft und des Gefühls in Kleists Werken
- Die Tragik des menschlichen Daseins im Kontext der Unvereinbarkeit von innerer und äußerer Welt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkungen
Die Einleitung führt das Thema „Ohnmacht“ in Kleists Werk ein und beschreibt den Fokus der Arbeit. Die Bedeutung von Kleists Begegnung mit Immanuel Kants Philosophie für seine Weltanschauung und seine Werke wird erläutert. Die Entstehung und Entwicklung von Kleists „Kleistschen Ohnmacht“ wird im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Kant und dem Aufkommen des Unbewussten als Instanz des Erkennens beschrieben.
2. Die Marquise von O...
Dieses Kapitel beleuchtet den Inhalt der Erzählung „Die Marquise von O...“. Im Fokus steht dabei die Bedeutung und Funktion der Ohnmacht in der Erzählung, insbesondere die Auswirkungen der Ohnmacht auf die Marquise und die Entwicklung der Handlung.
3. Das Käthchen von Heilbronn
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Drama „Das Käthchen von Heilbronn“. Es analysiert den Inhalt des Werkes und untersucht die Bedeutung und Funktion der Ohnmacht in Bezug auf die Handlung und die Charaktere.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Ohnmacht, Bewusstsein, Unbewusstsein, Immanuel Kant, Rationalismus, Aufklärung, „Die Marquise von O...“, „Das Käthchen von Heilbronn“, Tragik, inneres und äußeres Leben, Handlung, Gefühl, Vernunft.
- Quote paper
- Katrin Vollmann (Author), 2003, Ohnmacht bei Heinrich von Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23459