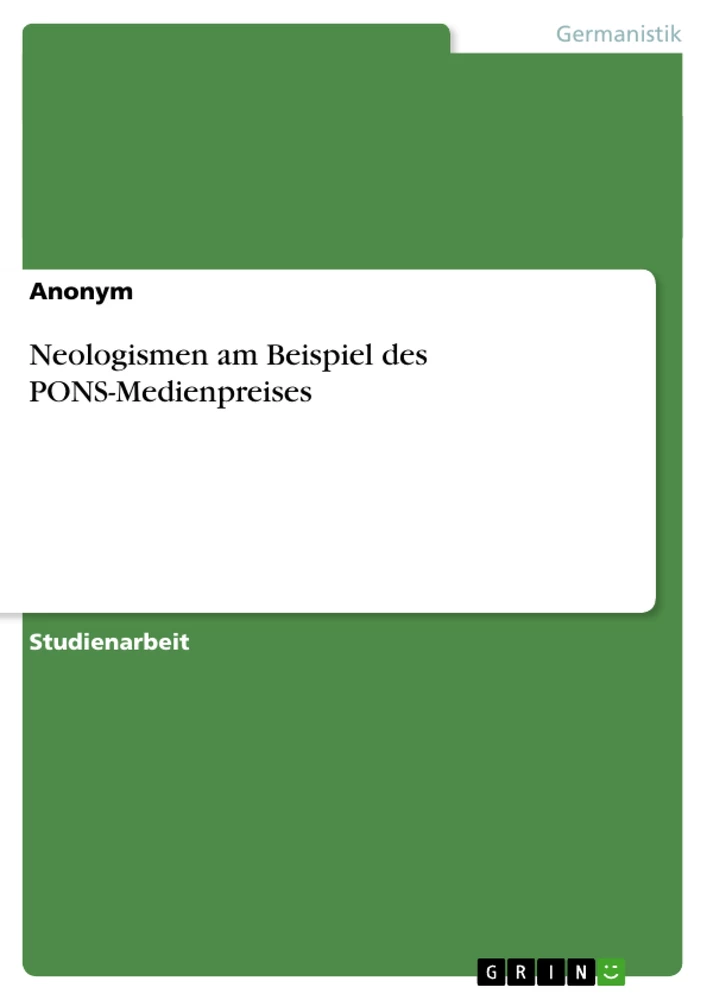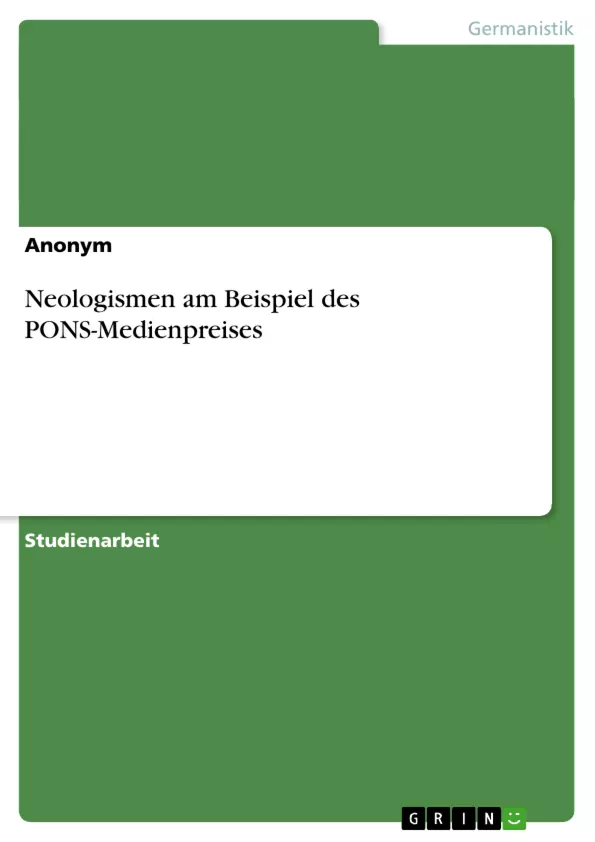„Gouvernator“ oder „Praxisgebühr“ – alles Wörter, die vor einiger Zeit noch keinen Sinn machten. Heute sind sie jedem verständlich und werden im allgemeinen Sprachgebrauch ganz selbstverständlich benutzt. Da drängt sich die Frage auf, um welche Wortschöpfungen handelt es sich hier, woher kommen sie und wieso entwickeln sie sich innerhalb einer derart kurzen Zeit sogar zu Schlagwörtern? Die Antwort darauf ist nur zu geben, wenn man diese Worte als Neubildungen, d.h. Neologismen klassifiziert. Denn dann wird klar, dass diese Worte alle eng mit dem aktuellen Zeitgeschehen verbunden sind und sich so erst entwickeln konnten. Der Gouvernator bezieht sich auf Arnold Schwarzenegger und seine Wahl zum Gouverneur, während die Praxisgebühr durch die Gesundheitsreform entstanden ist.
Die Kreation neuer Worte wird meistens erst nötig, wenn für ein neues Phänomen keine geeignete Bezeichnung zur Verfügung steht. Dieser Vorgang ist vor allem während den Anfängen der Sprachentwicklung zu beobachten, doch auch heute besteht sehr häufig das Bedürfnis nach einer neuen Bezeichnung. Bedingt ist dies durch einen raschen technischen Fortschritt, die Globalisierung, auf deren Grundlage immer mehr fremde Einflüsse in die deutsche Kultur gelangen, und einen Wandel in der Gesellschaft. Die Menschen haben den Drang für alles sofort einen Namen zu finden oder mit Hilfe eines Schlagworts bestimmte Ereignisse zu charakterisieren. Diese Tendenzen machen eine verstärkte Forschung im Bereich der Neologismen notwendig und erregten auch mein Interesse.
Um jedoch die inneren Zusammenhänge zu verstehen, müssen zuerst folgende Fragen aufgeworfen werden: Was ist ein Neologismus? Wie entstand das Phänomen, das hinter dem Namen „Neologismus“ steckt? Welche Forschungsergebnisse liegen darüber bereits vor und wie hat sich die Wissenschaft in diesem Bereich entwickelt? Auf welchem Stand ist die moderne Forschung? Werden Neologismen in der Sprache wahrgenommen?
Anhand der Fragen ist bereits erkennbar, dass es sich hier um ein sehr komplexes Thema handelt. So soll im ersten Teil der Arbeit der Begriff Neologismus und seine theoretischen Grundlagen erläutert und auf den neuesten Forschungsstand eingegangen werden. Im zweiten Teil der Arbeit wird am Beispiel des PONS – Medienpreis der Stellenwert von Neologismen am Anfang des 21. Jahrhunderts dargelegt und versucht, die Tendenzen deren zukünftigen Entwicklung in der deutschen Sprache vorherzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Neologismen und ihre Bewertung
- Entwicklung und Bewertung des Begriffs Neologismus in der Sprachgeschichte
- Die Bedeutung des Neologismus in der Forschungsgeschichte
- Die Wortgeschichte von Neologismus und seine Bewertung
- Die Fortentwicklung des Neologismus in der neueren Forschung
- Die untergeordnete Rolle des Neologismus in der Sprachwandelforschung
- Einordnung des Phänomens „Neologismus“ in den Sprachwandel
- Der Prozess der Wortneuschöpfung
- Das heutige Verständnis von Neologismus
- Das Neulexem
- Die Neubedeutung oder Neusemem
- Definition des Neologismus am Anfang des 21. Jahrhunderts
- Der Neologismus als ein Teil der lexikalischen Innovation
- Motive für Wortneubildungen
- Einordnung in die lexikalische Innovation
- Der aktuelle Stand der Neologismenforschung
- Die Entwicklung von Neologismenwörterbüchern
- Kennzeichen der heutigen Neologismen
- Entwicklung und Bewertung des Begriffs Neologismus in der Sprachgeschichte
- Der PONS – Medienpreis „PONS PONS“ für Wortneuschöpfungen
- Die Idee und Konzeption des Preises
- Der Grundgedanke und die Zielsetzung des Preises
- Die Vorgehensweise bei der Auswahl der Wörter
- Die Preisträger des PONS - Medienpreis
- Die Preisträger des PONS PONS 2000
- Die Preisträger des PONS PONS 2001
- Die Preisträger des PONS PONS 2002
- Die Preisträger des PONS PONS 2003
- Beispielhafte Betrachtung von einigen prämierten Neologismen
- Das Beispiel für den Preis 2000: Inder-Wahnsinn
- Das Beispiel für den Preis 2001: Blabylon
- Das Beispiel für den Preis 2002: Sparminator
- Das Beispiel für den Preis 2003: Der Scholzomat
- Kritische Betrachtung des PONS - Medienpreis
- Die Idee und Konzeption des Preises
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Phänomen der Neologismen im Deutschen und untersucht dessen Bedeutung im Kontext der Sprachentwicklung und -wandel. Sie fokussiert dabei auf den PONS - Medienpreis, der seit dem Jahr 2000 innovative Wortneuschöpfungen prämiert.
- Entwicklung und Bedeutung des Begriffs „Neologismus“ in der Sprachgeschichte
- Die Rolle von Neologismen im Sprachwandel
- Der PONS - Medienpreis und seine Bedeutung für die Identifizierung und Würdigung von Neologismen
- Analyse von prämierten Neologismen und deren Bedeutung
- Der Einfluss von Neologismen auf den Sprachgebrauch des 21. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Neologismen, wobei die Entstehung und Bedeutung des Begriffs beleuchtet werden. Anschließend wird die Entwicklung und Bewertung des Begriffs Neologismus in der Sprachgeschichte behandelt, wobei die Forschungsgeschichte des Begriffs sowie seine Entwicklung in der neueren Forschung beleuchtet werden. Die untergeordnete Rolle des Neologismus in der Sprachwandelforschung wird erörtert, wobei die Einordnung des Phänomens "Neologismus" in den Sprachwandel sowie der Prozess der Wortneuschöpfung betrachtet werden. Das heutige Verständnis von Neologismus wird definiert, wobei das Neulexem und die Neubedeutung oder Neusemem erklärt werden. Der Neologismus als Teil der lexikalischen Innovation wird erläutert, wobei die Motive für Wortneubildungen und deren Einordnung in die lexikalische Innovation behandelt werden. Der aktuelle Stand der Neologismenforschung wird beleuchtet, wobei die Entwicklung von Neologismenwörterbüchern sowie die Kennzeichen der heutigen Neologismen behandelt werden.
Schlüsselwörter
Neologismus, Wortneuschöpfung, Sprachwandel, Lexikalische Innovation, PONS - Medienpreis, deutsche Gegenwartssprache, Sprachentwicklung, Sprachgebrauch
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Neologismus?
Ein Neologismus ist eine sprachliche Neubildung oder Wortneuschöpfung, die oft eng mit aktuellem Zeitgeschehen, technischem Fortschritt oder gesellschaftlichem Wandel verbunden ist.
Warum werden ständig neue Wörter kreiert?
Neue Wörter werden meist dann nötig, wenn für neue Phänomene keine geeigneten Bezeichnungen existieren, getrieben durch Globalisierung und schnellen technischen Wandel.
Was ist der PONS-Medienpreis?
Der PONS-Medienpreis prämiert seit dem Jahr 2000 innovative Wortneuschöpfungen der deutschen Gegenwartssprache, um deren Stellenwert im 21. Jahrhundert zu würdigen.
Können Sie Beispiele für prämierte Neologismen nennen?
Beispiele sind „Gouvernator“ (in Bezug auf Arnold Schwarzenegger), „Praxisgebühr“, „Inder-Wahnsinn“, „Blabylon“ und „Scholzomat“.
Was versteht man unter einem „Neulexem“ und einem „Neusemem“?
Ein Neulexem ist ein komplett neu geschaffenes Wort, während ein Neusemem (oder Neubedeutung) ein bereits existierendes Wort ist, das eine neue Bedeutung erhält.
Welche Rolle spielen Neologismen im Sprachwandel?
Sie sind Teil der lexikalischen Innovation und zeigen, wie sich die Sprache an die Bedürfnisse der Sprecher und die Veränderungen der Umwelt anpasst.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2004, Neologismen am Beispiel des PONS-Medienpreises, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23471