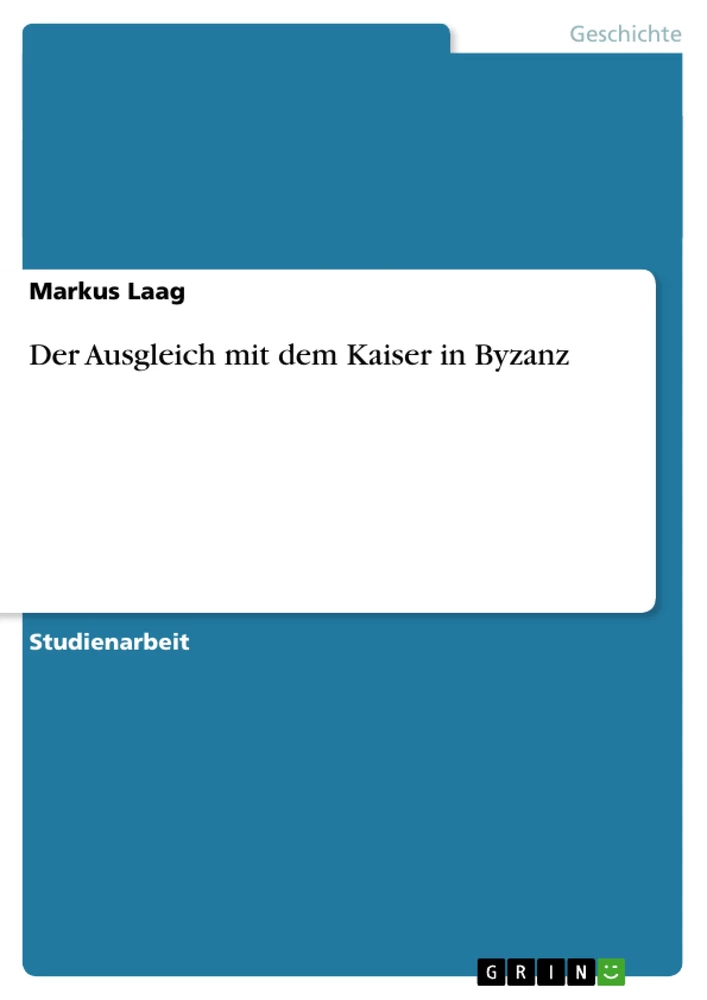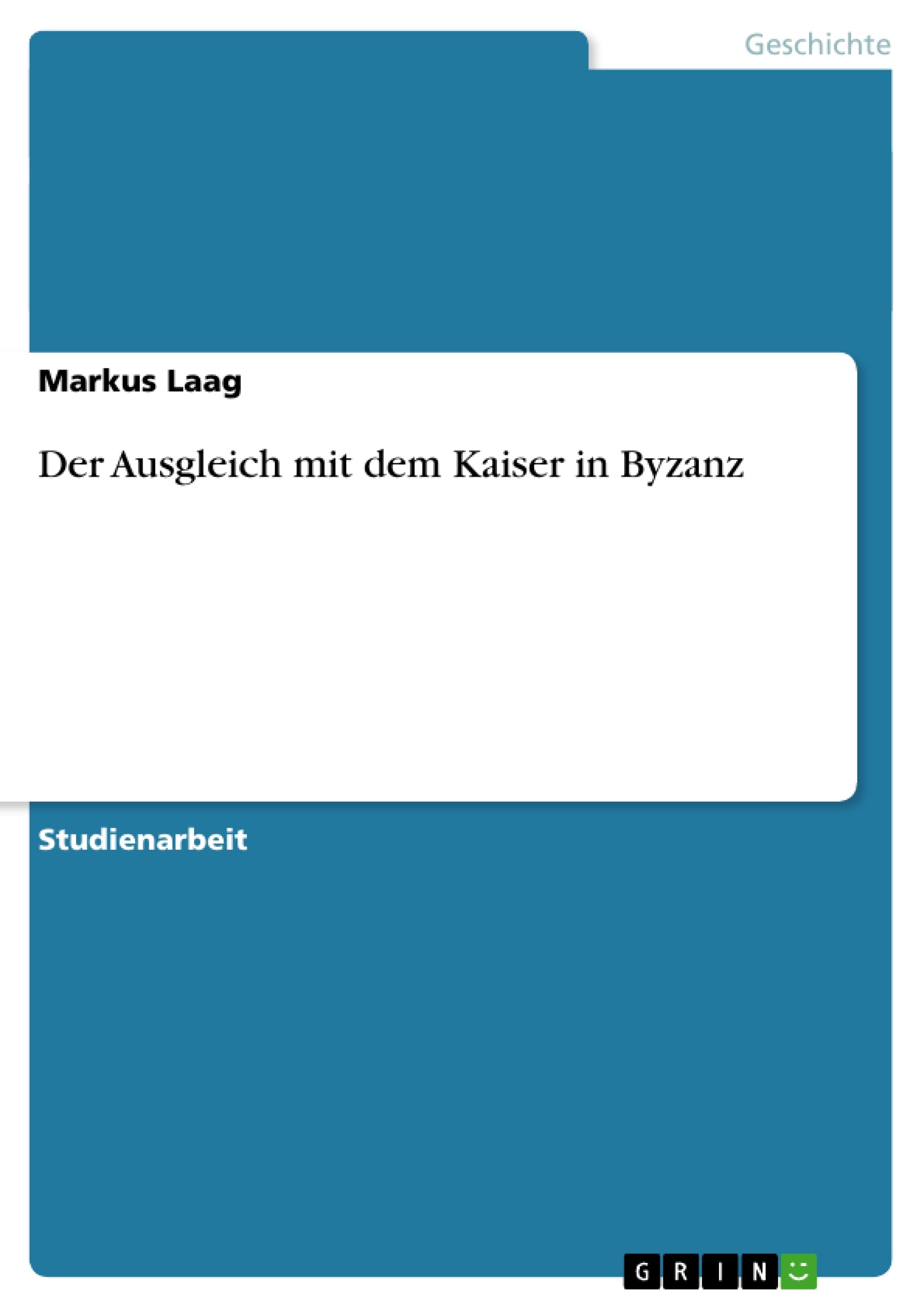Diese Arbeit will zeigen, wie sich nach der Kaiserkrönung Karls des Großen etwas politisch völlig Neues und prinzipiell Widersinniges etablierte: ein Doppelkaisertum. Das Frankenreich hatte zuvor begonnen, nach und nach das von Byzanz hinterlassene Machtvakuum auszufüllen und somit die Position der byzantinischen Kaiser zu schwächen.
Weiterhin geht es in dieser Arbeit um den großen Einfluss des Byzantinischen Reiches auf die Entwicklung der Staatsidee im Westen und die Verknüpfung des fränkischen und deutschen Königtums mit dem zunächst völlig andersartigen Universalismus des römischen Kaisertums.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Thema
- Zu den Quellen
- Die Situation vor der Kaiserkrönung
- Byzanz
- Frankenreich
- Das Papsttum
- Fazit
- Die Interpretation der Kaiserkrönung
- Im Westen
- Im Osten
- Die Kaiserfrage 800-802
- Karl - ein römischer Kaiser?
- Fränkische Ansichten über Irene nach 800
- Das Heiratsprojekt - Legende oder realer Plan?
- Die Kaiserfrage 803-810
- Der Abbruch der Verhandlungen
- Der Kampf um Venetien und Dalmatien
- Die fränkischen Titel für den Kaiser in Byzanz
- Der Ausgleich von 812
- Der Weg zum Friedensvertrag
- Die Situation nach 812
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Etablierung des Doppelkaisertums nach der Kaiserkrönung Karls des Großen, die als ein politisch innovatives und paradoxales Ereignis betrachtet werden kann. Sie untersucht den Einfluss des Byzantinischen Reiches auf die Entwicklung der Staatsidee im Westen und die Belastung des fränkischen Königtums durch den Universalismus des römischen Kaisertums.
- Die Entstehung des Doppelkaisertums als Ergebnis der Kaiserkrönung Karls des Großen
- Der Einfluss des Byzantinischen Reiches auf die Staatsidee im Westen
- Die Beziehung zwischen dem fränkischen Königtum und dem römischen Kaisertum
- Die Rolle des Papsttums in der Entwicklung der politischen Verhältnisse
- Die Verhandlungen und Konflikte zwischen dem Frankenreich und Byzanz nach 800
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Doppelkaisertums als politisch neuartiges und widersprüchliches Phänomen. Sie beleuchtet den Einfluss Byzanz auf die Entwicklung der Staatsidee im Westen und die Herausforderung, die der Universalismus des römischen Kaisertums für das fränkische Königtum darstellte.
- Die Situation vor der Kaiserkrönung: Dieses Kapitel beschreibt die politische Situation in Byzanz, dem Frankenreich und beim Papsttum vor der Kaiserkrönung Karls des Großen. Es zeigt auf, wie Byzanz nach Gebietsverlusten an Einfluss verloren hatte und das Frankenreich die entstandene Machtfülle nutzte. Es werden Hinweise auf Karls Bestrebungen, sein Königtum mit dem Kaisertum gleichzustellen, aufgezeigt.
- Die Interpretation der Kaiserkrönung: Dieses Kapitel behandelt die unterschiedlichen Interpretationen der Kaiserkrönung in West- und Osteuropa. Es wird diskutiert, wie die Kaiserkrönung im Westen und Osten aufgenommen wurde.
- Die Kaiserfrage 800-802: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach Karls Anspruch auf den römischen Kaisertitel und den Reaktionen des fränkischen Hofes auf die Kaiserin Irene. Es behandelt auch die mögliche Heirat Karls Tochter Rotrud mit Konstantin VI., wobei die Frage nach der Legitimität dieses Plans gestellt wird.
- Die Kaiserfrage 803-810: Dieses Kapitel analysiert den Abbruch der Verhandlungen zwischen dem Frankenreich und Byzanz sowie den Streit um Venetien und Dalmatien. Es beleuchtet auch die fränkischen Titel, die der Kaiser in Byzanz trug.
- Der Ausgleich von 812: Dieses Kapitel beschreibt den Weg zum Friedensvertrag zwischen dem Frankenreich und Byzanz und die Situation nach 812.
Schlüsselwörter
Doppelkaisertum, Byzantinisches Reich, Frankenreich, Staatsidee, Universalismus, Papsttum, Karl der Große, Irene, Konstantin VI., Heiratsprojekt, Verhandlungen, Friedensvertrag, politische Beziehungen, historische Quellen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Doppelkaisertum" nach 800 n. Chr.?
Mit der Kaiserkrönung Karls des Großen entstand eine politisch neue Situation: Neben dem Kaiser in Byzanz beanspruchte nun auch ein westlicher Herrscher den Kaisertitel, was zu Spannungen und notwendigen Ausgleichen führte.
Welchen Einfluss hatte Byzanz auf die Staatsidee im Westen?
Das Byzantinische Reich prägte maßgeblich die Vorstellung vom Universalismus des römischen Kaisertums, mit dem sich das fränkische und spätere deutsche Königtum auseinandersetzen musste.
Was war der "Ausgleich von 812"?
Der Ausgleich von 812 war ein Friedensvertrag zwischen dem Frankenreich und Byzanz, in dem Byzanz Karl den Großen als Kaiser (wenn auch nicht als "römischen" Kaiser) anerkannte.
Gab es wirklich Pläne für eine Heirat zwischen Karl und der Kaiserin Irene?
Die Forschung diskutiert, ob das Heiratsprojekt zwischen Karl dem Großen und der byzantinischen Kaiserin Irene ein realer Plan zur Vereinigung der Reiche oder lediglich eine Legende war.
Warum kam es zum Kampf um Venetien und Dalmatien?
Diese Gebiete lagen im Grenzbereich der Einflusssphären beider Reiche. Der Konflikt um sie war Teil der Machtprobe zwischen dem aufstrebenden Frankenreich und dem etablierten Byzanz.
Welche Rolle spielte das Papsttum in diesem Konflikt?
Das Papsttum war ein entscheidender Akteur, da es durch die Kaiserkrönung Karls versuchte, sich vom byzantinischen Einfluss zu lösen und eine neue Schutzmacht im Westen zu etablieren.
- Quote paper
- Markus Laag (Author), 1996, Der Ausgleich mit dem Kaiser in Byzanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23567