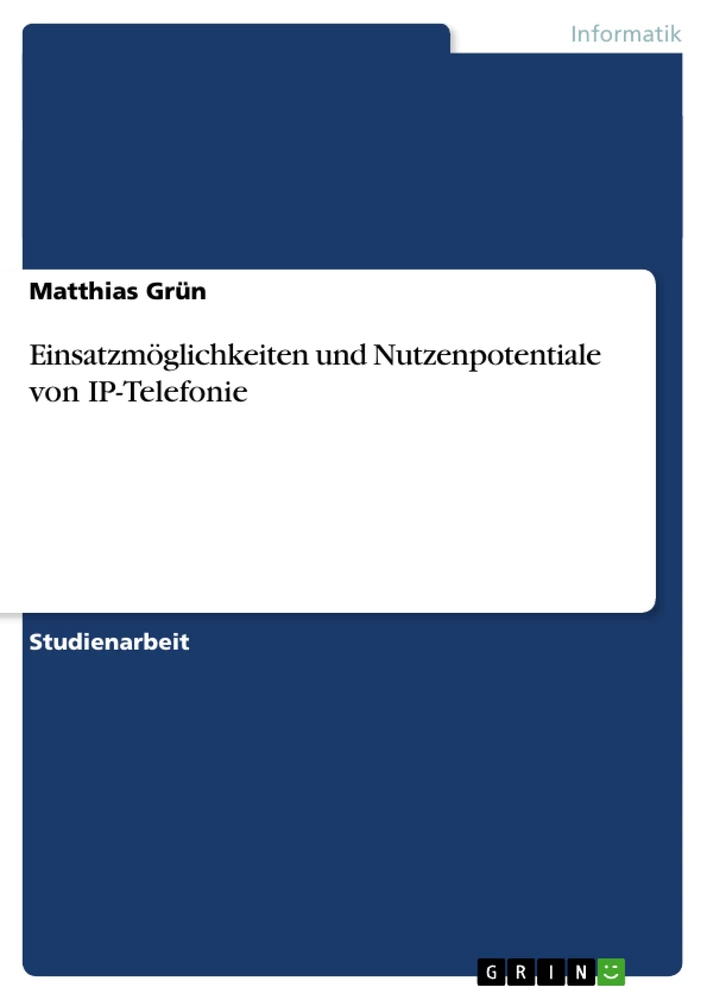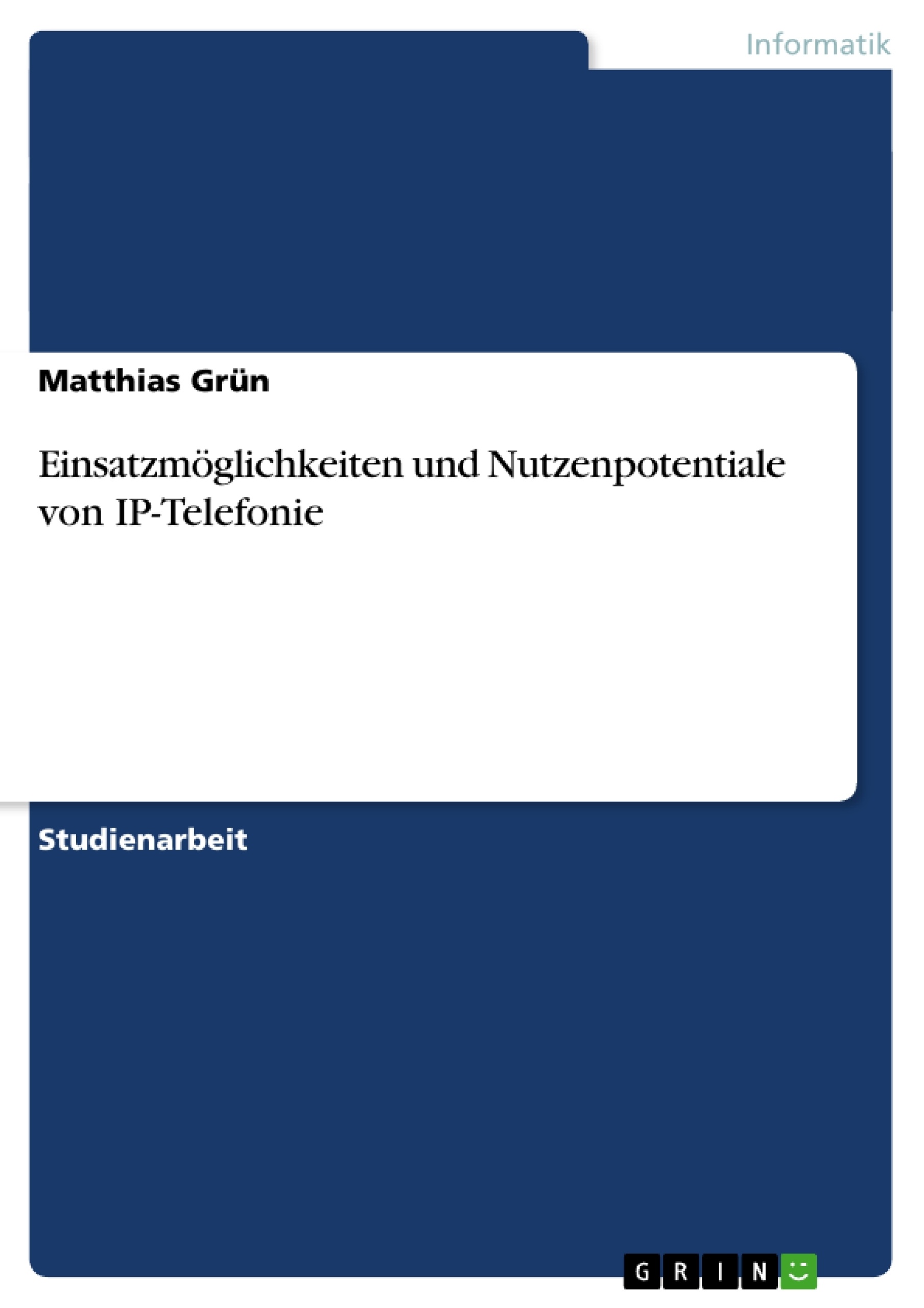[...] Trotz der inzwischen hohen Bedeutung von eMail und Fax für die
Kommunikation ist die gesprochene Sprache für Anwender nach wie vor das wichtigste
Medium, weil davon der laufende Betrieb stark abhängt.1 Kein Wunder also, wenn es schon
schlagkräftiger Argumente bedarf, um eine Firma zu überzeugen, ihre bewährte TK Anlage
gegen eine IP-basierende Lösung auszutauschen. Dennoch steigt die Zahl der Anwender,
die diesen Schritt wagen kontinuierlich an.
Die Möglichkeiten, die paketbasierte Datennetze heutzutage bieten, beschränken sich nicht
mehr nur darauf PC's und Server für die gemeinsame Nutzung zu vernetzen. Gleichzeitig
beginnen die Grenzen zwischen Computer- und Telefoniesystemen zu verschwinden. Der
Gedanke liegt nicht fern, die Telefoniedienste vollständig in Computernetze zu integrieren.
Hierbei wird das Internet Protokoll (IP) zum gemeinsamen Nenner um alle Sprach- und ITSysteme
sicher und zuverlässig miteinander zu verzahnen. Zahlreiche Unternehmen
machen es vor und ersetzen ihre Telekommunikationsinfrastruktur durch die Voice over IP
(VoIP) Technik. Diese Sprach-Daten-Integration verspricht Produktivitätssteigerungen und
Kostenreduzierungen im Unternehmen: Nur noch ein Netz, statt zwei, Computer Integrated
Telephony, intelligentere Endgeräte, direkte Anbindung an ERP Systeme und Datenbanken
– zahlreiche Vorteile, die zu einem kostengünstigen und effizienten Workflow führen sollen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der VoIP Technik, den
Einsatzmöglichkeiten von IP Telefonie und wie Unternehmen, hier speziell XXX GmbH,
davon profitieren können.
Dazu werden zuerst Grundsätzliches zur IP Telefonie wie Begriffsbestimmungen und
Vergleiche zur klassischen TK Anlage beschrieben, bevor in Kapitel 2 auf die verschiedenen
VoIP Protokolle wie H.323, SIP, MGCP und Megaco eingegangen wird.
In Kapitel 3 werden Dienstgüte, Kodierungsverfahren und Sicherheit in VoIP Systemen
behandelt. Kapitel 4 widmet sich den Einsatzmöglichkeiten der IP Telefonie im
professionellen Unternehmenseinsatz. Dort werden unter anderem Themen wie Computer
Telephony Integration, Unified Messaging oder Video Conferencing behandelt. In Kapitel 5
wird schließlich darauf eingegangen, wie Unternehmen durch Kostensenkung,
Investitionssicherheit und Verbesserung der Prozesse von der IP Telefonie profitieren
können. Abschließend erfolgt eine kritische Schlussbetrachtung mit einem kurzen Aublick auf
aktuelle und zukünftige Entwicklungstendenzen.
1 vgl. o.V. (2003a) S.16
Inhaltsverzeichnis
- 1 GRUNDSÄTZLICHES ÜBER IP TELEFONIE
- 1.1 Begriffsbestimmungen
- 1.2 IP Konvergenz
- 1.3 VoIP im Vergleich zur klassischen TK Anlage
- 2 WICHTIGE VOICE OVER IP PROTOKOLLE
- 2.1 Das H.323 Protokoll
- 2.2 Das Session Initiation Protocol
- 2.3 H.323 contra SIP
- 2.4 MGCP und Megaco
- 3 DIENSTGÜTE, KODIERUNG UND SICHERHEIT BEI VOIP
- 3.1 Quality of Service
- 3.1.1 Probleme der digitalen Sprachübvertragung
- 3.1.2 Verbesserung des Übertragungsverhaltens und der Sprachverständlichkeit
- 3.2 Kodierung und Komprimierung von Sprache
- 3.3 Sicherheit mit Voice Over IP
- 3.1 Quality of Service
- 4 EINSATZMÖGLICHKEITEN DER IP TELEFONIE
- 4.1 Unified Messaging
- 4.2 Eigene Applikationen mit XML
- 4.3 Computer Telephony Integration
- 4.4 Video Conferencing
- 4.5 Standortübergeifende Kommunikation
- 4.6 Voice over WLan als Ersatz für DECT Telefonie
- 5 NUTZENPOTENTIALE VON IP TELEFONIE
- 5.1 Kostensenkung durch den Einsatz der VoIP Technik
- 5.1.1 Senkung der Infrastrukturkosten
- 5.1.2 Telefongebühreneinsparungen durch VoIP
- 5.1.3 Senkung der laufenden Betriebskosten
- 5.2 Investitionssicherheit
- 5.3 Verbesserung der Prozesse
- 5.1 Kostensenkung durch den Einsatz der VoIP Technik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotentiale der IP-Telefonie. Ziel ist es, einen Überblick über die Technologie, ihre Protokolle und Sicherheitsaspekte zu geben und deren wirtschaftliche Vorteile aufzuzeigen.
- Grundlagen der IP-Telefonie und Vergleich mit traditionellen Systemen
- Wichtige VoIP-Protokolle (H.323, SIP)
- Dienstleistungsqualität, Kodierung und Sicherheit bei VoIP
- Einsatzmöglichkeiten der IP-Telefonie in verschiedenen Bereichen
- Nutzenpotenziale von IP-Telefonie hinsichtlich Kosten und Prozessoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 GRUNDSÄTZLICHES ÜBER IP TELEFONIE: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die IP-Telefonie, definiert grundlegende Begriffe und erläutert das Konzept der IP-Konvergenz. Es vergleicht die VoIP-Technologie mit traditionellen Telefonanlagen und legt die Basis für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel. Der Vergleich hebt die Unterschiede in der Architektur, den Kostenstrukturen und den Funktionsmöglichkeiten hervor, um den Leser auf den technologischen Wandel vorzubereiten.
2 WICHTIGE VOICE OVER IP PROTOKOLLE: Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Protokollen der VoIP-Technologie, H.323 und SIP. Es beschreibt deren Funktionsweise, Architektur und Unterschiede im Detail. Ein Vergleich der beiden Protokolle hebt deren jeweilige Stärken und Schwächen hervor und hilft dem Leser, die geeignete Technologie für spezifische Anwendungen auszuwählen. Zusätzlich werden MGCP und Megaco kurz vorgestellt, um das Gesamtbild der VoIP-Protokolle abzurunden.
3 DIENSTGÜTE, KODIERUNG UND SICHERHEIT BEI VOIP: Dieses Kapitel behandelt kritische Aspekte der VoIP-Technologie: die Dienstgüte (QoS), die Kodierung und Komprimierung von Sprache, sowie Sicherheitsfragen. Es erläutert die Herausforderungen bei der digitalen Sprachübertragung und wie man die Sprachqualität verbessern kann. Der Abschnitt zur Kodierung beschreibt verschiedene Verfahren und deren Auswirkungen auf die Bandbreite und die Sprachqualität. Schließlich werden Sicherheitsbedrohungen und deren Abwehrmaßnahmen diskutiert, um die Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation zu gewährleisten. Dieser umfassende Überblick ist essenziell für die erfolgreiche Implementierung von VoIP-Systemen.
4 EINSATZMÖGLICHKEITEN DER IP TELEFONIE: Dieses Kapitel befasst sich mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der IP-Telefonie. Es werden verschiedene Anwendungen wie Unified Messaging, eigene Applikationen mit XML, Computer Telephony Integration (CTI), Video Conferencing und standortübergreifende Kommunikation detailliert beschrieben. Der Fokus liegt darauf, zu zeigen, wie VoIP in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden kann und welche Vorteile sich daraus ergeben. Die Diskussion von Voice over WLAN als Alternative zu DECT-Telefonie rundet das Kapitel ab, indem sie die Flexibilität und Skalierbarkeit von VoIP-Lösungen unterstreicht.
5 NUTZENPOTENTIALE VON IP TELEFONIE: Das Kapitel konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Vorteile der IP-Telefonie. Die Kostensenkung durch den Einsatz der VoIP-Technik wird im Detail analysiert, wobei die Einsparungen bei Infrastrukturkosten, Telefongebühren und laufenden Betriebskosten hervorgehoben werden. Zusätzlich werden die Aspekte der Investitionssicherheit und der Prozessverbesserung durch die Implementierung von VoIP-Lösungen betrachtet. Dieser Abschnitt zeigt den erheblichen wirtschaftlichen Nutzen von VoIP für Unternehmen auf.
Schlüsselwörter
IP-Telefonie, VoIP, H.323, SIP, QoS, Kodierung, Sicherheit, Unified Messaging, CTI, Video Conferencing, Kostensenkung, Prozessoptimierung, Wirtschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Grundlagen der IP-Telefonie"
Was sind die Hauptthemen der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit der IP-Telefonie (VoIP), von grundlegenden Begriffen und Protokollen bis hin zu den wirtschaftlichen Vorteilen und verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Schwerpunkte sind die Protokolle H.323 und SIP, die Aspekte der Dienstgüte (QoS), der Sprachkodierung und der Sicherheit, sowie die Kostensenkung und Prozessoptimierung durch den Einsatz von VoIP.
Welche Protokolle werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt insbesondere die VoIP-Protokolle H.323 und SIP. Es wird ein detaillierter Vergleich beider Protokolle mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen geliefert. Zusätzlich werden MGCP und Megaco kurz vorgestellt.
Wie wird die Dienstgüte (QoS) bei VoIP behandelt?
Das Kapitel zur Dienstgüte (QoS) beleuchtet die Herausforderungen bei der digitalen Sprachübertragung und beschreibt Methoden zur Verbesserung der Sprachqualität und des Übertragungsverhaltens. Es werden dabei Probleme der digitalen Sprachübertragung und Lösungsansätze diskutiert.
Welche Sicherheitsaspekte werden betrachtet?
Die Arbeit thematisiert die Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit VoIP und diskutiert verschiedene Abwehrmaßnahmen, um die Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation zu gewährleisten.
Welche Einsatzmöglichkeiten von IP-Telefonie werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, darunter Unified Messaging, die Entwicklung eigener Applikationen mit XML, Computer Telephony Integration (CTI), Video Conferencing, standortübergreifende Kommunikation und Voice over WLAN als Alternative zu DECT-Telefonie.
Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet IP-Telefonie?
Die Arbeit hebt die Kostensenkungspotenziale von IP-Telefonie hervor, die sich in reduzierten Infrastrukturkosten, Telefongebühren und laufenden Betriebskosten manifestieren. Zusätzlich werden die Aspekte der Investitionssicherheit und der Prozessverbesserung durch VoIP-Lösungen beleuchtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt die Grundlagen der IP-Telefonie, Kapitel 2 wichtige VoIP-Protokolle, Kapitel 3 Dienstgüte, Kodierung und Sicherheit, Kapitel 4 die Einsatzmöglichkeiten und Kapitel 5 die Nutzenpotentiale von IP-Telefonie. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich einen umfassenden Überblick über die IP-Telefonie verschaffen möchten, insbesondere über deren Technologie, Protokolle, Sicherheitsaspekte und wirtschaftliche Vorteile. Sie eignet sich für Studenten, Fachleute und alle, die sich für die Thematik interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: IP-Telefonie, VoIP, H.323, SIP, QoS, Kodierung, Sicherheit, Unified Messaging, CTI, Video Conferencing, Kostensenkung, Prozessoptimierung, Wirtschaftlichkeit.
Wo finde ich einen detaillierten Vergleich von H.323 und SIP?
Ein detaillierter Vergleich der Protokolle H.323 und SIP findet sich in Kapitel 2 der Arbeit. Dieser Vergleich hebt die jeweiligen Stärken und Schwächen beider Protokolle hervor.
- Arbeit zitieren
- Matthias Grün (Autor:in), 2003, Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotentiale von IP-Telefonie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23568