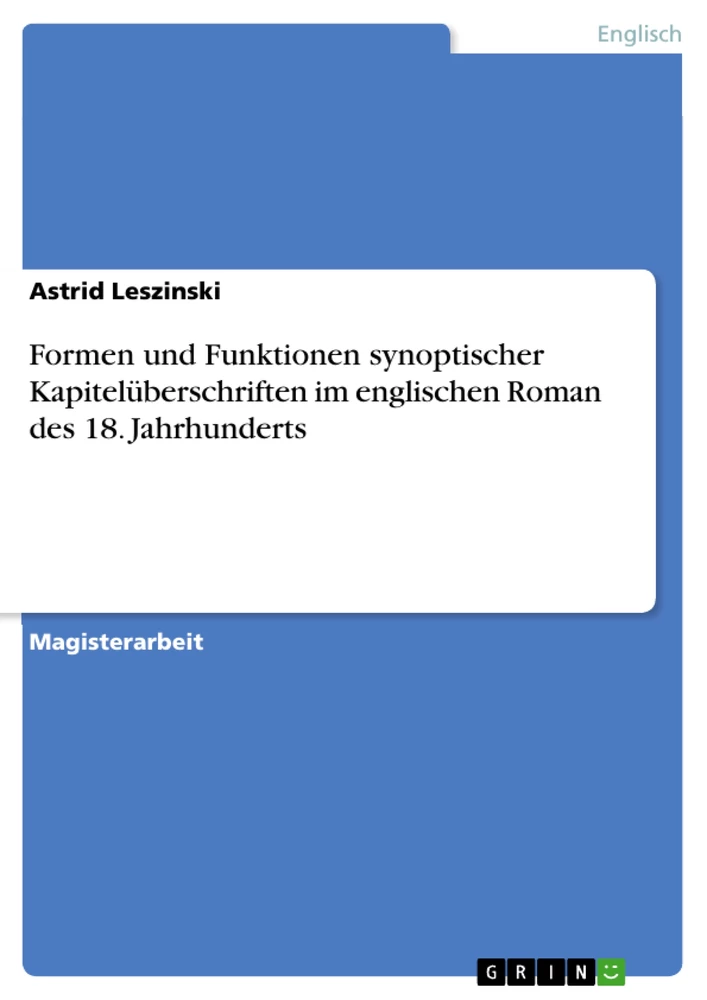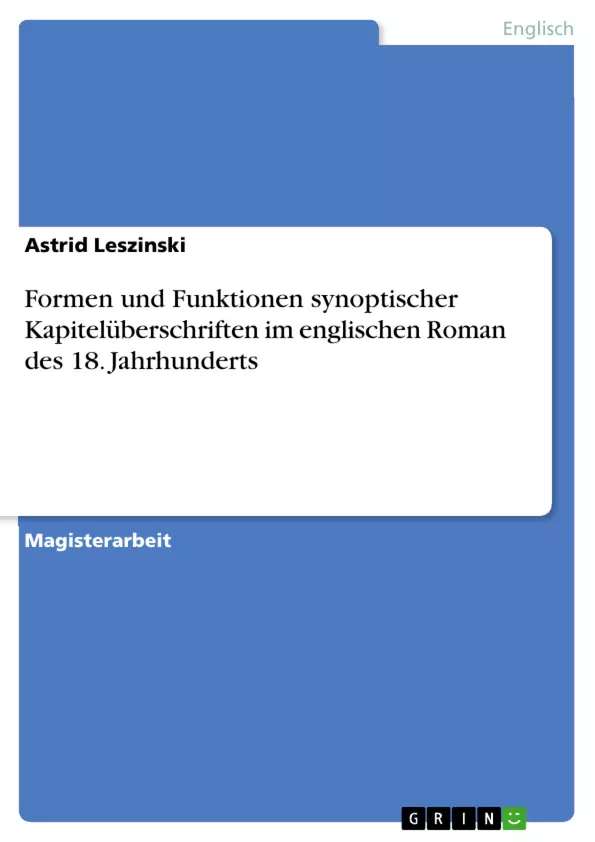I. Kapitel: Einführung in die Problemstellung, Methodik,
Zielsetzung und Forschungslage
1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
[...] first, those little spaces beween our chapters may be looked upon
as an inn or resting-place where he may stop and take a glass or any
other refreshment as it pleases him. [...]. Secondly,what are the
contents prefixed to every chapter but so many inscriptions over the
gates of inns (to continue the metaphor), informing the reader what
entertainment he is to expect, which if he likes not, he may travel on to
the next; [...].(1)
Im ersten Kapitel des zweiten Buchs von Joseph Andrews (im folgenden abgekürzt als JA) erklärt Fielding Sinn und Nutzen der Einteilung eines Romans in Kapitel, sowie das Setzen von Überschriften und erläutert die traditionellen Funktionen dieser Konventionen: Kapitel und deren Überschriften erleichtern dem Leser die Orientierung und geben ihm Zeit zum Nachdenken, Pausieren und Reflektieren. Außerdem bietet die Überschrift eines Kapitels dem Leser die Möglichkeit, das folgende Kapitel zu überspringen, falls die Vorinformationen nicht
mit den Erwartungen oder dem Interesse des Lesers übereinstimmen. Fielding nennt also eine Reihe von Aufgaben, die die synoptische Kapitelüberschrift, d.h. die inhaltsresümierende Überschrift, erfüllen kann.(2) Die Leistungen der Kapitelüberschrift, die auf mannigfaltige Weise auf den Leser und den Leseprozeß einwirken
können, sind damit jedoch nicht erschöpft. Obwohl die roman-theoretischen Überlegungen Fieldings in den Anfangskapiteln jedes Buches von JA als Schlüssel zu seiner Romankonstitution fungieren und daher in der Sekundärliteratur einen wichtigen Analyseansatz für sein Werk bilden,(3) sind die Untersuchungen zu seinen Theorien über Kapiteleinteilung und Überschriften defizitär.
_____
1 Henry Fielding, Joseph Andrews, II,1, 123f.
2 Vgl. zur Definition von Synopse und synoptischer Überschrift Stanzel (1995: 40-66) und Kapitel II, 1.2 dieser Arbeit.
3 Fast jede Studie zur Erzähltheorie und Romanstruktur von JA nimmt Fieldings Einleitungskapitel als Ausgangspunkt für weitere narratologische Analysen. Ausschließlich mit diesen Kapiteln befaßt sich Chibka (1990). Vgl. dazu auch Kaplan (1973), der die Einleitungskapitel von TJ ins Zentrum seiner Betrachtung stellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Kapitel: Einführung in die Problemstellung, Methodik, Zielsetzung und Forschungslage
- 1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Theoretischer Referenzrahmen und methodische Vorüberlegungen
- 3. Forschungsbericht zu den Formen und Funktionen synoptischer Kapitelüberschriften
- II. Kapitel: Typologien von Formen und Funktionen der Kapitelüberschriften im Roman
- 1. Literaturgeschichtliche und erzähltheoretische Einordnung der Kapitelüberschrift
- 1.1 Zu Ursprung und Entwicklung der Kapitelüberschrift
- 1.2 Relation zwischen synoptischer Kapitelüberschrift und Text: Bedeutung und Relevanzabschätzung für den Roman
- 2. Klassifikation verschiedener Erscheinungsformen der synoptischen Kapitelüberschrift
- 2.1 Dominant fiktionsbezogene Überschriften
- 2.2 Dominant rezeptionsbezogene Überschriften
- 2.3 Dominant metafiktionsbezogene Überschriften
- 3. Typologie rezeptionslenkender Funktionen der synoptischen Kapitelüberschrift
- 3.1 Informationsvergabe und Spannungsaufbau
- 3.2 Sympathie- und Antipathielenkung
- 3.3 Beeinflussung der Intensität der Rezeption
- 3.4 Aufforderung zur aktiven Mitarbeit am Produktionsprozeß
- 4. Relationen zwischen Formen und Funktionen von Kapitelüberschriften
- 1. Literaturgeschichtliche und erzähltheoretische Einordnung der Kapitelüberschrift
- III. Kapitel: Die Bedeutung der synoptischen Kapitelüberschriften in den Romanen Henry Fieldings
- 1. Einführung in die Textkonstitution und Rezeptionsästhetik der Romane Henry Fieldings
- 2. Joseph Andrews: Fiktion oder Authentizität? Kontrastive Wirklichkeitsvermittlung als Strukturprinzip der Überschriften
- 3. Jonathan Wild: Hyperbolische Sympathielenkung zur Potenzierung von Ironie
- 4. Tom Jones: Demonstrative Fiktionalität und explizite Aufforderungen zur individuellen Sinnkonfiguration
- 5. Amelia: Relevanzminderung der Synopse und Affektaktivierung des Rezipienten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktionen von synoptischen Kapitelüberschriften in den Romanen Henry Fieldings. Ziel ist es, die rezeptionslenkenden Aspekte dieser Überschriften zu beleuchten und deren Einfluss auf den Leseprozess zu analysieren. Die Untersuchung setzt sich mit den verschiedenen Formen und Funktionen von Kapitelüberschriften auseinander und analysiert, wie sie im Kontext der jeweiligen Romane eingesetzt werden.
- Rezeptionslenkende Funktionen von Kapitelüberschriften
- Formen und Typologien von Kapitelüberschriften
- Diachrone Entwicklung des Gebrauchs von Kapitelüberschriften in den Romanen Fieldings
- Bedeutung von Kapitelüberschriften für die Romanstruktur und Rezeptionsästhetik
- Bedeutung der Untersuchung für die Fielding-Forschung und Romananalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Einführung in die Problemstellung, Methodik, Zielsetzung und Forschungslage. Es stellt die Relevanz von Kapitelüberschriften im Roman heraus und beleuchtet den Forschungsstand zu diesem Thema. Kapitel Zwei widmet sich der Typologie von Formen und Funktionen von Kapitelüberschriften im Roman. Es werden verschiedene Erscheinungsformen von Überschriften klassifiziert und deren rezeptionslenkende Funktionen analysiert. Kapitel Drei untersucht die Bedeutung der synoptischen Kapitelüberschriften in den Romanen Henry Fieldings. Dabei werden die Romane "Joseph Andrews", "Jonathan Wild", "Tom Jones" und "Amelia" exemplarisch analysiert und die spezifischen Formen und Funktionen der Kapitelüberschriften in diesen Werken herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind synoptische Kapitelüberschriften, Rezeptionslenkung, Formen und Funktionen von Kapitelüberschriften, Romanstruktur, Romananalyse, Henry Fielding, "Joseph Andrews", "Jonathan Wild", "Tom Jones", "Amelia".
- Citar trabajo
- Astrid Leszinski (Autor), 1997, Formen und Funktionen synoptischer Kapitelüberschriften im englischen Roman des 18. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/236