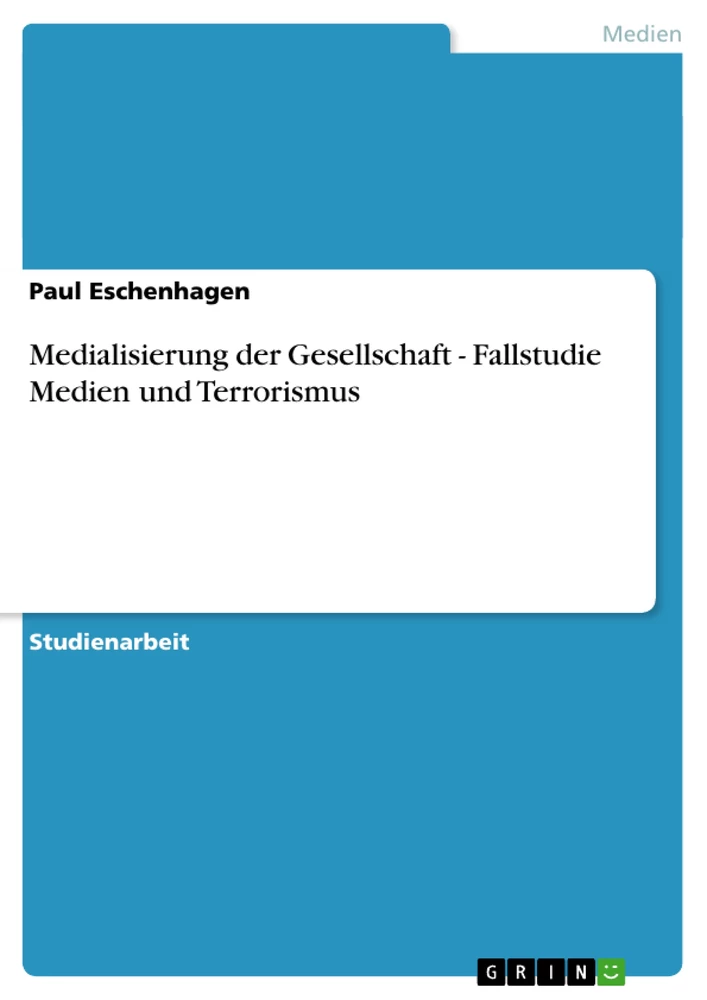Kann man von Terrorismus sprechen, ohne daran teilzunehmen? Iwan Kaliajew, in Albert Camus „Les Justes“ Das Konzept der Medialisierung1 beschreibt allgemein die zunehmende Bedeutungssteigerung der Massenmedien, vor allem für die politische Kommunikation. Dabei ist zu untersuchen, ob – und wenn, wie weit – die Medien mit ihrer systemeigenen Logik der Selektion, Produktion und Publikation von Themen, Meinungen und Einstellungen mittlerweile den Prozess der politischen Kommunikation bestimmen, wie es zum Beispiel Meyer (2001, 2002) auch für die Bundesrepublik Deutschland beobachtet. Oder ob nicht eher doch die Politik – und die politische Öffentlichkeitsarbeit – die Kontrolle über die publizierten Inhalte besitzt und die Medien für ihre Zwecke instrumentalisiert. Mit dieser Frage der politischen Kommunikation beschäftigt sich das zweite Kapitel, in dem nach den Grundlagen des Konzepts der Medialisierung ein Vorschlag der Verbindung von System- und Akteurstheorie vorgestellt wird, der vor allem auf Jarren & Donges (2002a, b) zurückgeht und die empirische Untersuchung der Beziehungen zwischen sozialen Systemen ermöglicht . Das zweite Unterkapitel befasst sich zunächst mit dem Konzept der politischen Kommunikationskultur, mit dem die Interaktionen und Einstellungen im etablierten Handlungssystem der politischen Kommunikation beschrieben und untersucht werden können, um dieses dann am Beispiel der Medialisierung des politischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland zu konkretisieren.
Dabei zeigt sich, wie anschließend dargestellt werden soll, dass die zunehmende Medialisierung zu einem Rückkoppelungseffekt bei den Medien selbst führt: der „Metaberichterstattung“, d.h. der Berichterstattung über das eigene Metier Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit. Im dritten Kapitel soll das Konzept der Medialisierung anhand einer Fallstudie zum Phänomen des internationalen Terrorismus konkretisiert werden. Die Hypothese dabei lautet, dass der internationale Terrorismus fundamental auf auf das Zusammenspiel mit der internationalen Medienöffentlichkeit angewiesen ist, weil er durch sie seine eigentliche Wirkung entfaltet. Terroristen legen planen die Anschläge so, dass sie möglichst gut der Medienlogik entsprechen, um die vorhandene Medienagenda zu überlagern und andere Medienereignisse zu überschatten. Im ersten Unterkapitel wird der Begriff „Terrorismus“ näher definiert; der internationale Terrorismus erscheint als dessen besonders medialisierte Form.. Kapitel 3.2 stellt einige ausgewählte, Beispiele für internationalen Terrorismus vor und fokussiert sich dabei auf Medienberichterstattung und die Interaktionen – soweit diese möglich waren – von Terroristen und Journalisten. In Kapitel 3.3 wird versucht, auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse den Terrorismus in die System- bzw. Handlungstheorie einzuordnen. Dabei wird konzentriert sich die Arbeit wiederum auf die Beziehungen zwischen den Massenmedien und dem internationalem Terrorismus. Das letzte Kapitel fasst die Resultate zusammen und wagt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medialisierung der Gesellschaft
- 2.1 Theoretische Grundlagen - Medialisierung als Konzept
- 2.1.1 Medialisierung und die Mediengesellschaft
- 2.1.2 Interpenetrationsansatz und Handlungssystem
- 2.2 Medialisierung der Politik
- 2.2.1 Das politische Kommunikationssystem
- 2.2.2 Politische Kommunikationskultur
- 2.2.3 Medialisierung der Politik in Deutschland
- 2.3 Metaberichterstattung als Konsequenz der Medialisierung
- 3. Medien und Terrorismus
- 3.1 Einführung
- 3.1.1 Terrorismus – eine Definition
- 3.1.2 Internationaler Terrorismus – medialisierter Terrorismus
- 3.2 Theater des Terrors - Beispiele für medialisierten Terrorismus
- 3.2.1 Bombenanschlag auf das King-David-Hotel in Jerusalem, 1946
- 3.2.2 TWA Flug 847 – Medienspektakel Flugzeugentführung, 1985
- 3.2.3 Der 11. September 2001 – Katastrophe in Echtzeit
- 3.3 Terrorvision – Warum Terroristen Medien brauchen
- 4. Fazit
- 4.1 Medialisierung und politische Kommunikationskultur
- 4.2 Terrorismus im Licht von Globalisierung und Medialisierung
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Medialisierung auf die politische Kommunikation und den internationalen Terrorismus. Sie analysiert, inwieweit die Medien die politische Kommunikation bestimmen oder ob die Politik die Medien instrumentalisiert. Weiterhin wird die These geprüft, dass internationaler Terrorismus auf die Medienöffentlichkeit angewiesen ist, um seine Wirkung zu entfalten.
- Medialisierung der politischen Kommunikation
- Das Verhältnis zwischen Politik und Medien
- Der Einfluss der Medienlogik auf die Berichterstattung
- Der internationale Terrorismus als medialisiertes Phänomen
- Die Interaktion zwischen Terroristen und Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der Medien auf die politische Kommunikation und den Terrorismus. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die theoretischen Grundlagen, die im Folgenden verwendet werden. Die These, dass internationaler Terrorismus auf Medien angewiesen ist, um seine Wirkung zu erzielen, wird hier als Ausgangspunkt formuliert.
2. Medialisierung der Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Medialisierung, definiert den Begriff und analysiert den Bedeutungszuwachs der Massenmedien in der Gesellschaft. Es wird ein Modell vorgestellt, das die Interaktion zwischen Medien und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen mittels des Interpenetrationsansatzes erklärt und die Rolle der Medienlogik in der Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit herausarbeitet. Die zunehmende Selbstreferenzialität der Medienberichterstattung, die sogenannte Metaberichterstattung, wird als Konsequenz der Medialisierung diskutiert.
3. Medien und Terrorismus: Dieses Kapitel untersucht den internationalen Terrorismus als Fallstudie der Medialisierung. Es definiert Terrorismus und analysiert dessen mediale Dimension. Anhand ausgewählter Beispiele – wie dem Bombenanschlag auf das King-David-Hotel, der Entführung des TWA Fluges 847 und den Anschlägen vom 11. September – wird die Interaktion zwischen Terroristen und Medien und der Einfluss der Medienlogik auf die Planung und Ausführung von Terrorakten untersucht. Das Kapitel beleuchtet, wie Terroristen die Medien strategisch nutzen, um ihre Botschaften zu verbreiten und maximale Aufmerksamkeit zu erzielen.
Schlüsselwörter
Medialisierung, Mediengesellschaft, politische Kommunikation, Terrorismus, Medienlogik, Interpenetrationsansatz, Systemtheorie, Akteurstheorie, Metaberichterstattung, internationale Medienöffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Medialisierung auf politische Kommunikation und internationalen Terrorismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Medialisierung auf die politische Kommunikation und den internationalen Terrorismus. Sie analysiert das Verhältnis zwischen Politik und Medien, den Einfluss der Medienlogik auf die Berichterstattung und den internationalen Terrorismus als medialisiertes Phänomen. Ein zentraler Aspekt ist die Interaktion zwischen Terroristen und Medien.
Welche zentralen Thesen werden vertreten?
Die Arbeit prüft die These, dass internationaler Terrorismus auf die Medienöffentlichkeit angewiesen ist, um seine Wirkung zu entfalten. Weiterhin wird analysiert, inwieweit die Medien die politische Kommunikation bestimmen oder ob die Politik die Medien instrumentalisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Medialisierung der Gesellschaft, Medien und Terrorismus, Fazit und Literaturverzeichnis. Das zweite Kapitel beleuchtet das Konzept der Medialisierung und die Interaktion zwischen Medien und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Das dritte Kapitel untersucht den internationalen Terrorismus als Fallstudie der Medialisierung anhand konkreter Beispiele wie dem Bombenanschlag auf das King-David-Hotel oder den Anschlägen vom 11. September.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Interpenetrationsansatz, um die Interaktion zwischen Medien und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen zu erklären. Bezüge zur Systemtheorie und Akteurstheorie werden ebenfalls hergestellt. Die Medienlogik spielt eine zentrale Rolle in der Analyse.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Bombenanschlag auf das King-David-Hotel in Jerusalem (1946), die Entführung von TWA Flug 847 (1985) und die Anschläge vom 11. September 2001 als Beispiele für medialisierten Terrorismus. Diese Fälle illustrieren die strategische Nutzung der Medien durch Terroristen.
Was ist der Fokus des Kapitels "Medialisierung der Gesellschaft"?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Medialisierung, analysiert den Bedeutungszuwachs der Massenmedien in der Gesellschaft und untersucht die Rolle der Medienlogik in der Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die zunehmende Selbstreferenzialität der Medienberichterstattung (Metaberichterstattung) wird als Konsequenz der Medialisierung diskutiert.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss der Medialisierung auf die politische Kommunikationskultur und den Terrorismus im Kontext von Globalisierung und Medialisierung zusammen. (Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text selbst nachzulesen).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Medialisierung, Mediengesellschaft, politische Kommunikation, Terrorismus, Medienlogik, Interpenetrationsansatz, Systemtheorie, Akteurstheorie, Metaberichterstattung, und internationale Medienöffentlichkeit.
- Citation du texte
- Paul Eschenhagen (Auteur), 2003, Medialisierung der Gesellschaft - Fallstudie Medien und Terrorismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23613