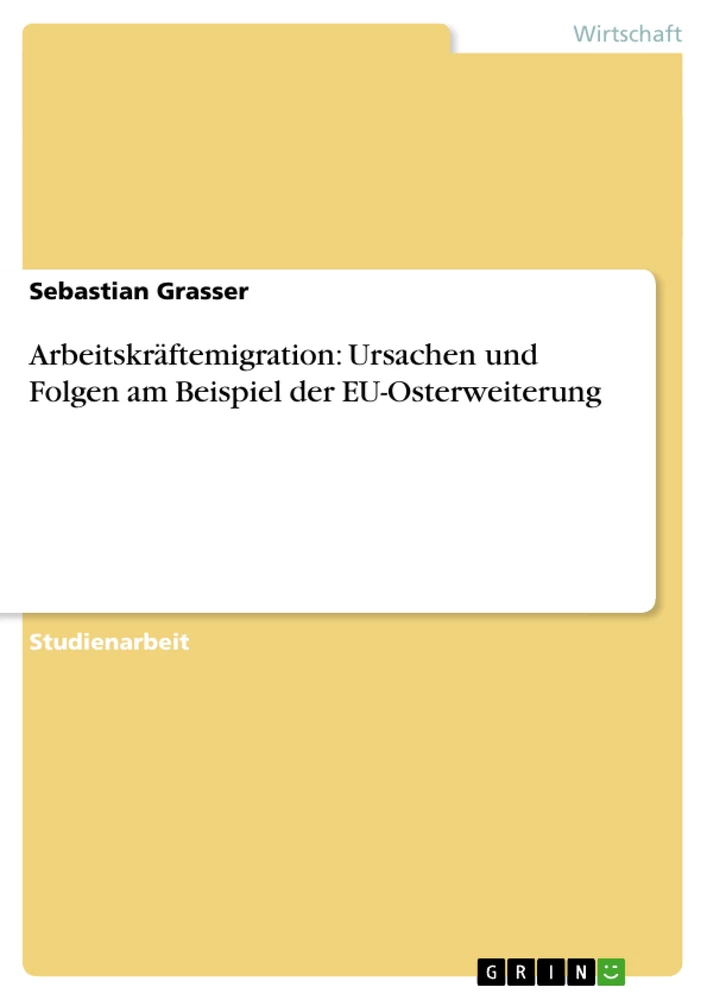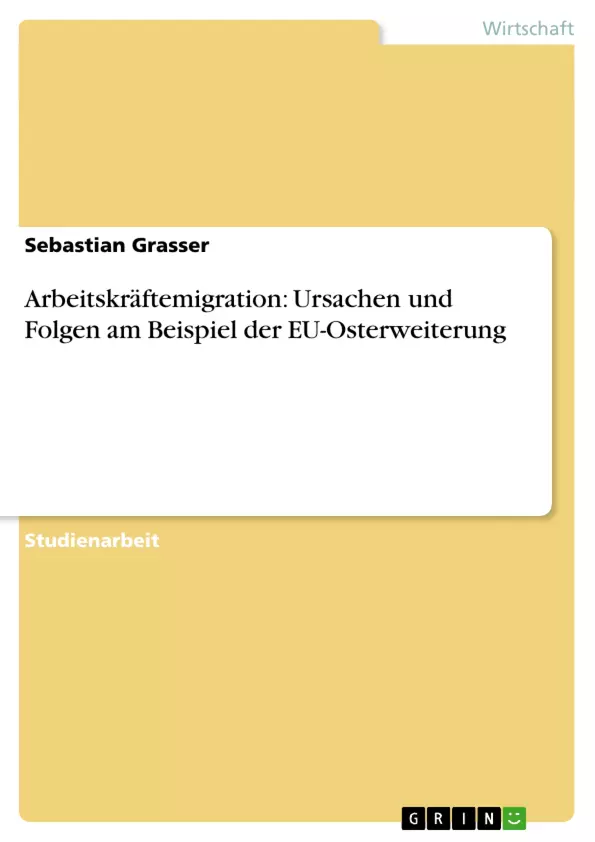Der Europäische Rat beschloss am 13. Dezember 2002 in Kopenhagen die Aufnahme von zehn Staaten aus Mittel- und Osteuropa in die Europäische Union nach einem fast zehnjährigen Verhandlungsmarathon1. Ebenfalls in Kopenhagen, jedoch im Jahre 1993, „verabschiedete der Europäische Rat die Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder“2 in die Europäische Union, die sog. „Kopenhagener Kriterien“. Diese umfassen je ein politisches (institutionelle Stabilität), wirtschaftliches (funktionsfähige Marktwirtschaft) und juristisches (Übernahme des Besitzstandes der Gemeinschaft, den sog. „acquis communutaire) Kriterium3. 1998 nahm die Europäische Union mit sechs Bewerbern die Verhandlungen auf. – dies waren Estland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Im Jahr 2000 kamen Lettland, Litauen, Malta, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien zu den Beitrittsverhandlungen hinzu4. Im Dezember 2002 hatten schließlich alle genannten Staaten – bis auf Rumänien und Bulgarien – die Kopenhagener Kriterien und die Konvergenzkriterien der Union erfüllt. Somit wurden in Kopenhagen die Verhandlungen nach einem harten Finanzpoker um weitere Agrarzuschüsse für Polen, Tschechien, Slowenien und Ungarn, abgeschlossen. Das Europäische Parlament plädierte am 9. April 2003 für einen Beitritt der Bewerberländer, wodurch exakt eine Woche später in Athen auf der Akropolis die feierliche Unterzeichnung der Beitrittsverträge vonstatten gehen konnte5. Es ist die „größte Erweiterung der Union in ihrer Geschichte“6, die EU-Bevölkerung
vergrößert sich um 75 Mio. auf 450 Mio. Menschen. Diese Arbeit beschäftigt sich insofern mit der Osterweiterung, als dass sie die Ursachen und Folgen der aus der Osterweiterung entstehenden Arbeitskräftemigration untersucht, das erwartete Wanderungsvolumen darstellt und in diesem Zusammenhang prüft, welche Auswirken die Migranten sowohl auf das deutsche Sozialsystem wie auch auf den Arbeitsmarkt haben werden. 1 Vgl. Arend 2003 2 Arend 2003 3 Vgl. Zwick 2003 4 Vgl. Arend 2003 5 Vgl. Arend 2003 6 Daniel 2003
Inhaltsverzeichnis
- 1. VON KOPENHAGEN 1993 NACH ATHEN 2003: DER LANGE WEG DER EU-OSTERWEITERUNG
- 1.1. DIE STATIONEN DER EU-OSTERWEITERUNG
- 1.2. DIE ANGST DER DEUTSCHEN VOR DER OSTERWEITERUNG
- 1.3. DIE BISHERIGE ENTWICKLUNG DER ARBEITSKRÄFTEWANDERUNG IN DER UNION
- 2. URSACHEN DER WANDERUNG: WANDERUNGSANREIZE UND WANDERUNGSVOLUMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE IN DEN BEITRITTSLÄNDERN
- 2.1. THEORETISCHE GRUNDÜBERLEGUNGEN VON MIGRATION
- 2.1.1. DIE MIKROÖKONOMISCHE MIGRATIONSTHEORIE
- 2.1.2. WANDERUNGSANREIZE DURCH PULL- UND PUSH-FAKTOREN
- 2.2. DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE AUSGEWÄHLTER BEITRITTSKANDIDATEN
- 2.3. NETZWERKE ALS WANDERUNGSFÖRDERNDER FAKTOR
- 2.4. ERRECHNETES WANDERUNGSVOLUMEN LAUT DEM IFO-INSTITUT
- 3. FOLGEN DER WANDERUNGEN FÜR DEN STANDORT DEUTSCHLAND
- 3.1. DAS MODELL INTERNATIONALER ARBEITNEHMERFREIZÜGIGKEIT NACH KRUGMANN
- 3.2. AUSWIRKUNG DER MIGRATION AUF DEN ARBEITSMARKT
- 3.3. AUSWIRKUNG DER MIGRATION AUF DAS SOZIALSYSTEM
- 4. LÖSUNGSANSÄTZE ZUR BEWÄLTIGUNG EINER ZU HOHEN MIGRATIONSWELLE
- 4.1. MÖGLICHE LÖSUNGSANSÄTZE DES IFO-INSTITUTS
- 4.2. LÖSUNGSANSATZ DER EU-KOMISSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Ursachen und Folgen der Arbeitskräftemigration im Kontext der EU-Osterweiterung. Ziel ist es, das erwartete Wanderungsvolumen darzustellen und die Auswirkungen der Migranten auf das deutsche Sozialsystem sowie den Arbeitsmarkt zu analysieren.
- Die Stationen der EU-Osterweiterung und die Kopenhagener Kriterien
- Die Angst vor der Osterweiterung in Deutschland
- Die historische Entwicklung der Arbeitskräftemigration in der EU
- Theoretische Grundüberlegungen zur Migration, insbesondere die mikroökonomische Migrationstheorie
- Die wirtschaftliche Lage der Beitrittskandidaten und deren Einfluss auf die Wanderungsanreize
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet den langen Weg der EU-Osterweiterung, beginnend mit den Kopenhagener Kriterien im Jahr 1993 bis zur feierlichen Unterzeichnung der Beitrittsverträge in Athen 2003. Dabei wird auch auf die deutsche Angst vor einer Überflutung des Arbeitsmarktes durch Migranten und die bisherige Entwicklung der Arbeitskräftemigration innerhalb der EU eingegangen.
Kapitel 2 befasst sich mit den Ursachen der Arbeitskräftemigration im Kontext der EU-Osterweiterung. Es werden sowohl theoretische Grundüberlegungen zur Migration, insbesondere die mikroökonomische Migrationstheorie, als auch die wirtschaftliche Lage der Beitrittskandidaten betrachtet. Neben pull- und push-Faktoren wird auch die Rolle von Netzwerken als wanderungsfördernder Faktor sowie das erwartete Wanderungsvolumen laut dem Ifo-Institut beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Folgen der Arbeitskräftemigration für Deutschland. Es wird das Modell internationaler Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Krugmann vorgestellt und die Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem untersucht.
Kapitel 4 widmet sich möglichen Lösungsansätzen zur Bewältigung einer zu hohen Migrationswelle. Hier werden sowohl Ansätze des Ifo-Instituts als auch der EU-Kommission vorgestellt.
Schlüsselwörter
EU-Osterweiterung, Arbeitskräftemigration, Wanderungsanreize, Mikroökonomische Migrationstheorie, Pull- und Push-Faktoren, Wirtschaftliche Lage, Beitrittskandidaten, Folgen der Migration, Arbeitsmarkt, Sozialsystem, Lösungsansätze, Ifo-Institut, EU-Kommission
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt?
Die Kopenhagener Kriterien umfassen ein politisches Kriterium (institutionelle Stabilität), ein wirtschaftliches Kriterium (funktionsfähige Marktwirtschaft) und ein juristisches Kriterium (Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes).
Wann fand die größte Erweiterung der EU-Geschichte statt?
Die Verhandlungen wurden im Dezember 2002 in Kopenhagen abgeschlossen, und die feierliche Unterzeichnung der Beitrittsverträge erfolgte am 16. April 2003 in Athen.
Welche Rolle spielen Push- und Pull-Faktoren bei der Migration?
Push-Faktoren sind Bedingungen im Herkunftsland, die Menschen zur Abwanderung bewegen, während Pull-Faktoren attraktive Bedingungen im Zielland sind, die Migranten anziehen.
Wie wirkt sich die Migration auf das deutsche Sozialsystem aus?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Stabilität und Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland im Kontext der EU-Osterweiterung.
Was besagt die mikroökonomische Migrationstheorie?
Diese Theorie betrachtet Migration als eine individuelle Investitionsentscheidung, bei der Kosten und Nutzen einer Wanderung gegeneinander abgewogen werden.
- Quote paper
- Sebastian Grasser (Author), 2004, Arbeitskräftemigration: Ursachen und Folgen am Beispiel der EU-Osterweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23663