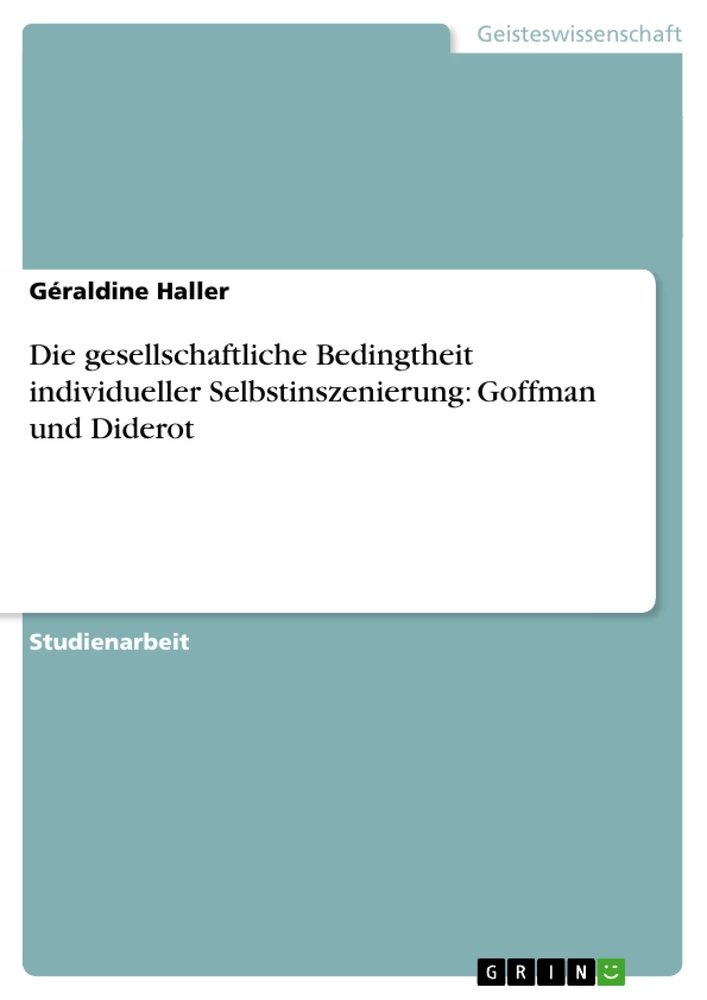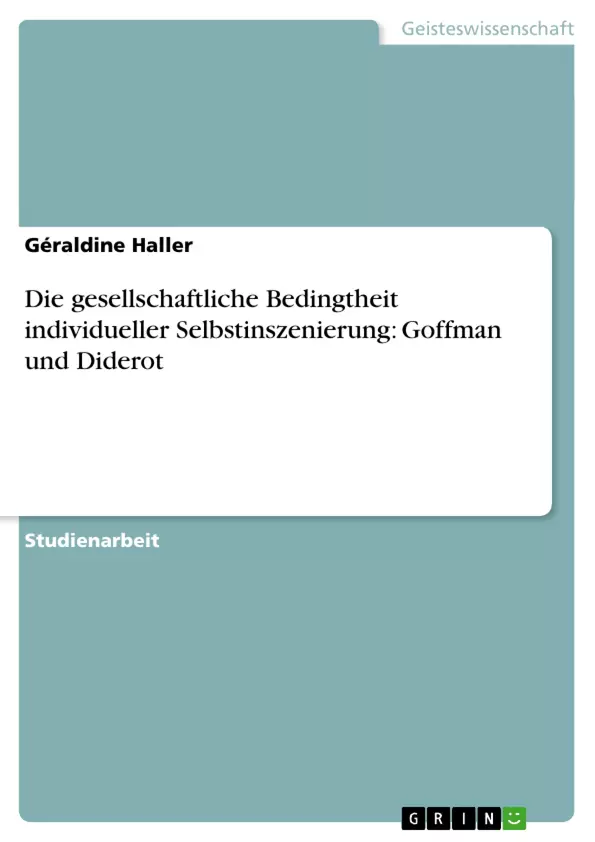Der französische Schriftsteller und Philosoph Denis Diderot gehört zu den bedeutendsten und herausragendsten Repräsentanten der französischen Aufklärung. Der große Denker ist ein Zeitgenosse Jean-Jacques Rousseaus, von welchem er sich für sein Rollenkonzept hat inspirieren lassen. Denn auch Rousseau hat sich zu Lebzeiten Gedanken über die damalige Gesellschaft gemacht. In seiner Kultur- und Zivilisationskritik geht Rousseau davon aus, dass der Mensch ursprünglich in seinem Naturzustand ein Einzelgänger war, alle seine körperlichen Bedürfnisse befriedigen konnte und sonst auch keine anderen Bedürfnisse hatte. Mit der Zeit fanden die Menschen zueinander und es entstanden neue ‚künstliche’ Bedürfnisse (Eigentum besitzen, Familie gründen, Anerkennung erlangen...). Die Menschen gerieten in ein Abhängigkeitsverhältnis, weil nicht jeder für sich alles anbauen, entwickeln und tun konnte. Somit fingen die Menschen an, sich selbst zu inszenieren, damit sie andere dazu bewegen konnten, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und da es eine naturgegebene Ungleichheit zwischen den Menschen gibt (der Starke kann mehr, der Geschickte schneller und der Kluge effektiver arbeiten), kam es zu dem Unterschied zwischen Arm und Reich. Folglich ließ der Reiche den Armen für sich arbeiten, um seinem unbefriedigten ‚künstlichen’ Bedürfnis nach Reichtum entgegenzukommen. Auf diese Weise hat Rousseau ein Gesellschaftsmodell geschaffen, welches Diderot als Vorbild dienen wird. Denn auch der Skeptiker und Rationalist Diderot versucht, im Geist der Aufklärung gegen die damalige Gesellschaftsordnung vorzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Diderots Konzept der individuellen Selbstinszenierung
- Goffmans Konzept der individuellen Selbstinszenierung
- Stärken und Schwächen der beiden Konzeptionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die individuelle Selbstinszenierung in der Gesellschaft gestaltet. Dazu werden die Konzepte von Denis Diderot und Erving Goffman analysiert. Der Fokus liegt auf den Stärken und Schwächen beider Konzeptionen.
- Das Verhältnis von individueller Natur und gesellschaftlicher Bedingtheit
- Die Rolle des Rollenspiels in der Selbstinszenierung
- Die Frage der Authentizität und Selbstfindung in der modernen Gesellschaft
- Der Einfluss von Rousseau auf Diderots Denken
- Die Darstellung der sozialen Widersprüche in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Diderots Konzept der individuellen Selbstinszenierung, wie es in seinem Werk "Rameaus Neffe" deutlich wird. Es werden die Charaktere des Erzählers und des Neffen vorgestellt, die unterschiedliche Ansichten von Moral und Selbstfindung repräsentieren. Diderots Konzept der individuellen Natur, die die Rolle des Einzelnen prägt, wird erläutert.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Goffmans Konzept der individuellen Selbstinszenierung. Hier werden die zentralen Elemente von Goffmans Theorie, wie z.B. die "dramaturgische Perspektive" und die "Impression Management", vorgestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Stärken und Schwächen der beiden Konzeptionen. Es werden die jeweiligen Vorteile und Einschränkungen beider Theorien diskutiert und mögliche Kritikpunkte aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Individuelle Selbstinszenierung, Gesellschaftliche Bedingtheit, Rollenspiel, Authentizität, Selbstfindung, Diderot, Goffman, Rousseau, "Rameaus Neffe", Dramaturgische Perspektive, Impression Management, Soziale Widersprüche.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Denis Diderot in der Aufklärung?
Diderot war ein bedeutender Skeptiker und Rationalist, der gegen die damalige Gesellschaftsordnung argumentierte und Konzepte der individuellen Natur entwickelte.
Was ist Erving Goffmans "dramaturgische Perspektive"?
Goffman betrachtet soziales Handeln als eine Form der Theateraufführung, bei der Individuen versuchen, den Eindruck, den sie auf andere machen, zu steuern (Impression Management).
Wie beeinflusste Rousseau das Denken von Diderot?
Rousseaus Kritik an "künstlichen Bedürfnissen" und der gesellschaftlichen Abhängigkeit diente Diderot als Vorbild für sein eigenes Rollenkonzept.
Was thematisiert Diderots Werk "Rameaus Neffe"?
Das Werk stellt unterschiedliche Ansichten von Moral und Selbstfindung durch die Charaktere des Erzählers und des Neffen gegenüber.
Was sind die zentralen Themen der individuellen Selbstinszenierung?
Zentrale Themen sind das Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft, die Frage nach Authentizität und die Bewältigung sozialer Widersprüche.
- Quote paper
- Géraldine Haller (Author), 2003, Die gesellschaftliche Bedingtheit individueller Selbstinszenierung: Goffman und Diderot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23667