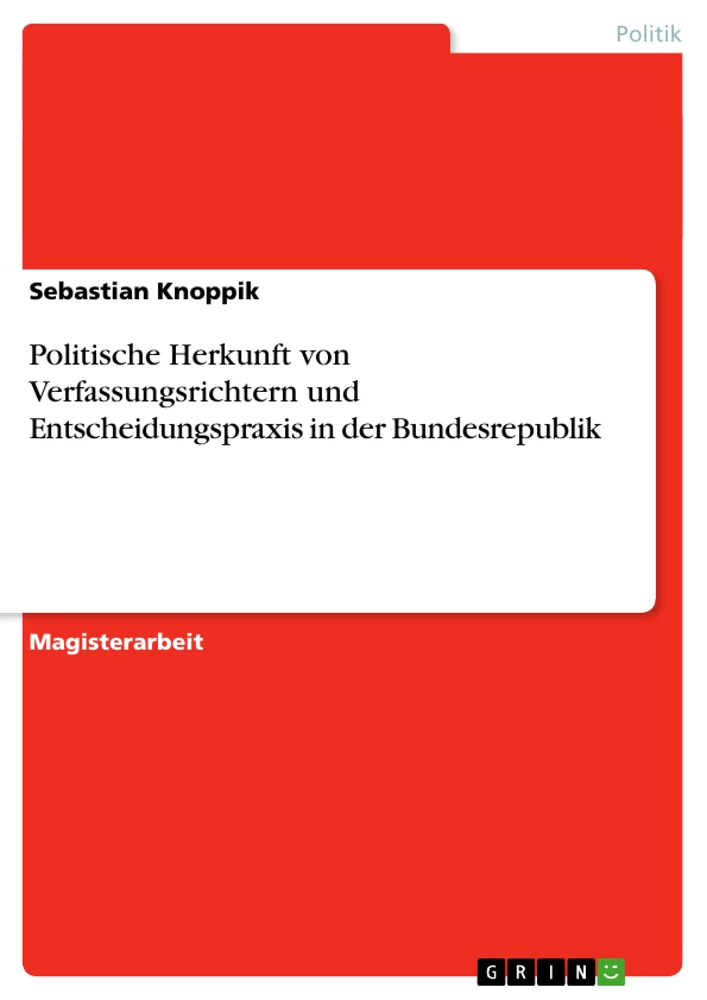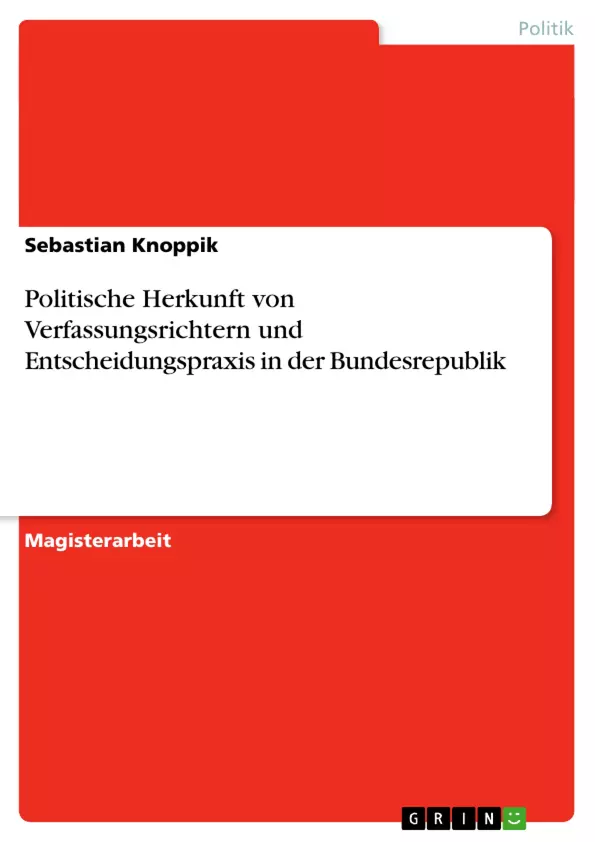Das Bundesverfassungsgericht hat sich in den inzwischen mehr als 50 Jahren seines Bestehens als wichtige Säule des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland bewährt. Die Entscheidungen des Gerichtes wurden als wichtig für sowohl den Bestand als auch die Fortentwicklung des Verfassungsrechts angesehen. Bewertungen wie „Hüter der Verfassung“ zeugen von diesem Respekt vor der Leistungsbilanz des höchsten deutschen Gerichts.
Allerdings hat es auch an Kritik am Bundesverfassungsgericht nie gemangelt. Bemängelt wurde etwa immer wieder, das Gericht spiele sich als „Gegenregierung“ auf. Befürchtet wird , dass das Verfassungsgericht mit seinen Entscheidungen so weit in die Politik eingreift, dass die Gewaltenteilung nicht mehr gewährleistet ist. Kritiker bemängelten die Justizialisierung der Politik durch das Gericht. Karlsruhe sei ein verlängerter Arm der Opposition. Die Richter betrieben nicht Rechtssprechung, sondern machten Politik.
Im Rahmen dieser Argumentation wird auch das stark politisierte Verfahren der Richterwahl bemängelt. Dabei schließen die Kritiker häufig von der Art des Wahlverfahrens auf die Rechtsprechung. Ob die Richter bei Urteilen tatsächlich so abstimmen, wie es ihre Parteizugehörigkeit erwarten lässt, ist jedoch bislang nur unzureichend untersucht worden.
Zwar weisen Landfried (1984, 1988), Bryde (1982) und Kommers (1976) einzelne Fälle von parteipolitischer Fraktionierung nach, die meist als Ausnahmen zur Bestätigung der Regel parteipolitischer Unabhängigkeit interpretiert werden. Landfried bemerkt sogar, dass die „Mehrheitsverhältnisse bei den Abstimmungen [...] seit 1970 mit der Veröffentlichung der ‚dissenting opinions‘ kein Geheimnis mehr sind“ (1984: 16). Bislang hat jedoch nur Jäger (1987) eine entsprechende quantitative Studie1 an Hand der Sondervoten vorgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung des Bundesverfassungsgerichts in das politische System Deutschlands
- Wahl der Bundesverfassungsrichter
- Anzahl der Richter in den Senaten und Abstimmungsmodus
- Wählbarkeitsvoraussetzungen
- Amtszeit
- Wahlverfahren
- Wahlverfahren im Bundestag
- Wahlverfahren im Bundesrat
- Vorschlagsrecht des Bundesverfassungsgerichts
- Wahl der Präsidenten und stellvertretenden Präsidenten
- Ernennung der Richter durch den Bundespräsidenten
- Geübte Wahlpraxis
- Geübte Wahlpraxis im Bundestag
- Geübte Wahlpraxis im Bundesrat
- Absprachen zwischen den Wahlgremien
- Kritik am Wahlverfahren
- Kritik am formalen Wahlverfahren
- Kritik an der geübten Praxis des Wahlverfahrens
- Reformvorschläge
- Die Gesetzentwürfe der Bundestagsfraktionen von Grünen, Bündnis 90/Die Grünen und PDS zur Reform des Wahlrechts
- Weitere Reformvorschläge
- Die Wahlen von 1951 bis 2000
- Wahl der Verfassungsrichter
- Wahl der Präsidenten und stellvertretenden Präsidenten
- Herkunft und Orientierung der Bundesverfassungsrichter
- Einfluss des Wahlverfahrens auf die Rechtsprechung
- Empirischer Teil: Analyse der abweichenden Meinungen
- Fragestellung
- Unabhängige Variable: Parteizugehörigkeit der Verfassungsrichter
- Abhängige Variable: Abstimmungsverhalten der Richter bei Sondervoten
- Hypothesen
- Methode
- Zum Institut der abweichenden Meinungen
- Historische Entwicklung
- Anzahl der abweichenden Meinungen
- Abweichende Meinungen als repräsentative Stichprobe der gesamten Rechtsprechung des Gerichts
- Vorstellung der empirischen Ergebnisse
- Überprüfung der Hypothesen
- Fragestellung
- Fazit: Verfassungsrichter als Veto-Player oder juristische Mediatoren?
- Ausblick: Ist eine Reform des Wahlverfahrens angezeigt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die politische Herkunft von Verfassungsrichtern in Deutschland und untersucht deren Einfluss auf die Entscheidungspraxis des Bundesverfassungsgerichts. Ziel ist es, zu erforschen, inwieweit die politische Prägung der Richter die Rechtsprechung beeinflusst und ob sich Parteipolitische Fraktionierung in den Entscheidungen widerspiegelt.
- Politische Herkunft von Verfassungsrichtern
- Wahlverfahren des Bundesverfassungsgerichts
- Einfluss der politischen Prägung auf die Rechtsprechung
- Analyse von Sondervoten als Indikator für politische Einflüsse
- Reformvorschläge zum Wahlverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungslücke im Kontext der bestehenden Literatur erläutert. Anschließend wird das Bundesverfassungsgericht in das politische System Deutschlands eingeordnet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Wahlverfahren der Verfassungsrichter, analysiert die geübte Wahlpraxis und diskutiert Kritikpunkte sowie Reformvorschläge. Im empirischen Teil werden die Sondervoten von 1970 bis 2002 untersucht, um die Auswirkungen der politischen Herkunft auf die Rechtsprechung zu beleuchten. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze gibt.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Wahlverfahren, politische Herkunft, Rechtsprechung, Sondervoten, Parteizugehörigkeit, Veto-Player, juristische Mediatoren, Reformvorschläge, Gewaltenteilung, politische Fraktionierung.
Häufig gestellte Fragen
Beeinflusst die Parteizugehörigkeit die Urteile der Bundesverfassungsrichter?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage empirisch anhand von Sondervoten (dissenting opinions), um festzustellen, ob eine parteipolitische Fraktionierung vorliegt.
Wie werden die Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt?
Die Richter werden jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, wobei die Arbeit die geübte Wahlpraxis und Absprachen kritisch analysiert.
Was sind Sondervoten und warum sind sie für die Forschung wichtig?
Sondervoten sind abweichende Meinungen von Richtern. Sie dienen in dieser Studie als Indikator, um das Abstimmungsverhalten quantitativ zu analysieren.
Welche Kritikpunkte am Wahlverfahren werden in der Arbeit genannt?
Kritisiert werden die starke Politisierung des Verfahrens, die Justizialisierung der Politik und die mangelnde Transparenz bei Absprachen.
Welchen Zeitraum umfasst die empirische Analyse?
Die Untersuchung der abweichenden Meinungen bezieht sich auf den Zeitraum von 1970 bis 2002.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Knoppik (Autor:in), 2004, Politische Herkunft von Verfassungsrichtern und Entscheidungspraxis in der Bundesrepublik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23679