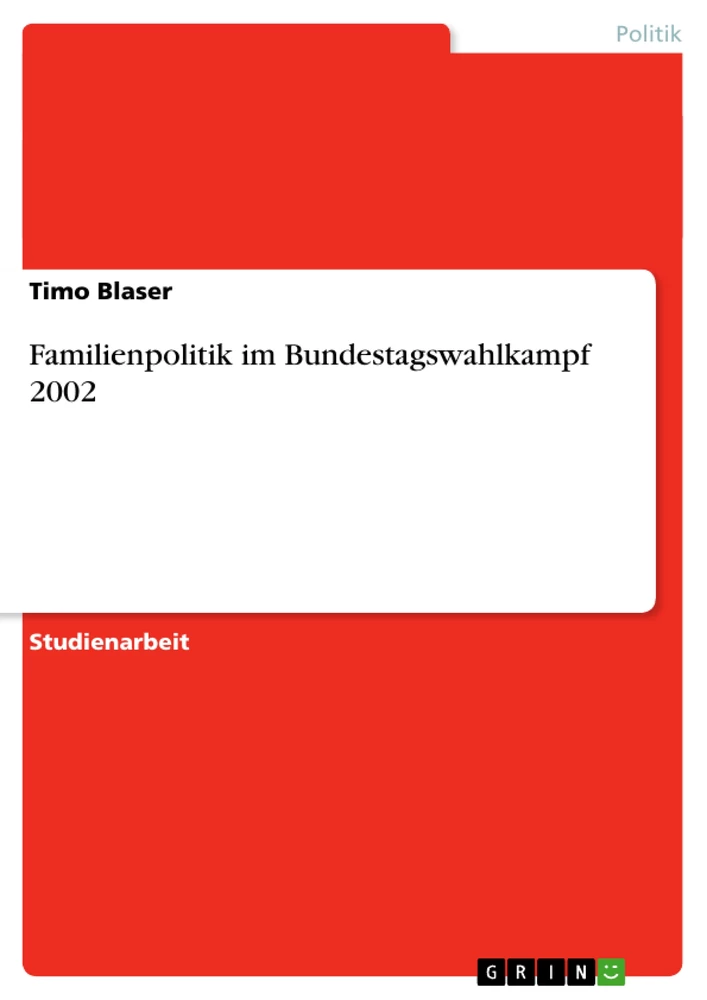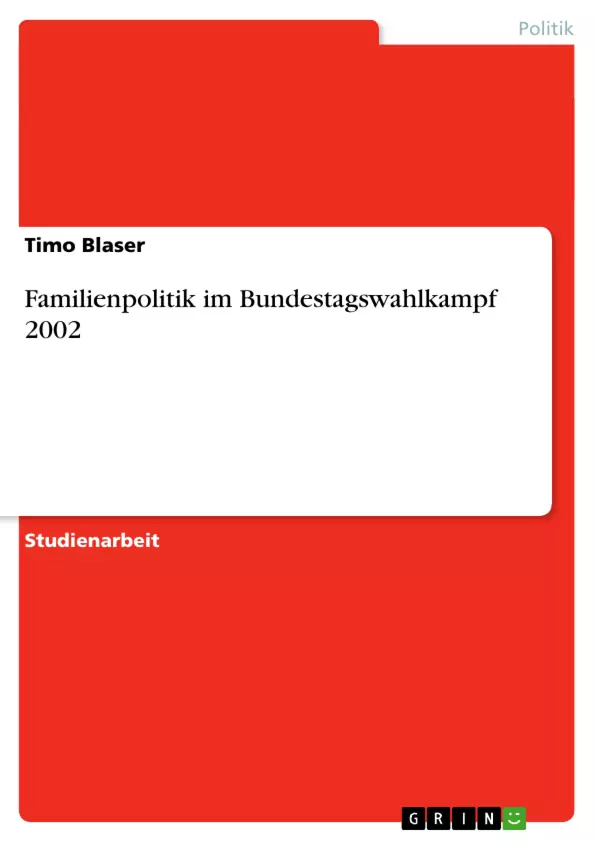Die Institution Familie ist in klassischerweise ein Beziehungsfeld des Privaten. In der Familie können „Nähe, Intimität und Sorge füreinander “ zu großen Teilen selbstbestimmt gelebt werden. Doch familiäres Zusammenleben kann keineswegs gänzlich autonom sein, sondern wird von „herrschenden Konventionen, wie ein solches Leben auszusehen habe“, wie die gesellschaftlich verankerten Rollenbilder von Mann und Frau, und von vielfältigen staatlichen Interventionen gelenkt und unterstützt.
Ob und in welcher Form Familien gegründet und gelebt werden hängt deshalb mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Dies lässt sich an der Familienentwicklung von der deutschen Nachkriegszeit bis zur Gegenwart ablesen. So sind ab den 60er Jahren die damals üblichen Großfamilien seltener geworden, da „die stärkere Übernahme von Fürsorgeleistungen durch den Sozial- und Wohlfahrtsstaat die „ökonomische“ Bedeutung der Kinder für die Eltern vermindert“ hatte. Weiterhin hatte die Emanzipationsbewegung der Frauen, die nun zunehmend einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sich aus der häuslichen Enge lösen wollten, Auswirkungen auf die Familienbildungen. „ Die Ausbreitung von anspruchsvollen und individualistischen Lebensstilen [..], die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Kinderlosigkeit [, sowie mehr] Familienplanung durch Aufklärung und bessere Mittel und Methoden der Empfängnisverhütung“ sind weitere wichtige Einflüsse auf die Entwicklung der Familien.
Ein Blick nach Skandinavien zeigt außerdem, dass die Entscheidung ein Kind zu bekommen, an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gekoppelt ist, da hier die Geburtenrate höher als in anderen europäischen Staaten, aber auch das Betreuungsangebot für Kinder besser ausgebaut ist.
Familien sind aber nicht nur >passive Masse< im Fluss gesellschaftlicher Veränderungen, sondern sind auch „Träger des Gemeinwesens“5, die Erhebliches für den Zusammenhalt einer Gesellschaft leisten. „Sie sind Anbieter von Produktionsfaktoren und Nachfrager von Konsumgütern, sowie Produzenten personaler Pflege- und Versorgungsleistungen für die Haushaltsmitglieder, sie treffen Entscheidungen über [..] den Generationenverbund sowie über die Bildung von Human-, Geld- und Sachvermögen, sie sind primäre Sozialisationsinstanzen für die nachwachsende Generation und Stätten der Alltagskultur sowie Elemente basaler politischer Strukturen und Prozesse.“
Inhaltsverzeichnis
- Die Interdependenz von privater Familie und gesellschaftlich-staatlicher Öffentlichkeit
- Familienpolitik in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2002
- Familienpolitik im Wahlprogramm der SPD
- Familienpolitik im Wahlprogramm der CDU/CSU
- Familienpolitik im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen
- Familienpolitik im Wahlprogramm der FDP
- Familienpolitik im Wahlprogramm der PDS
- Der breite Konsens: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Literatur / Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Interdependenz von privater Familie und gesellschaftlich-staatlicher Öffentlichkeit und untersucht die Bedeutung von Familienpolitik, insbesondere im Kontext der Bundestagswahl 2002.
- Die Rolle der Familie in der Gesellschaft und ihre Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- Die Bedeutung von Familienpolitik für die Gestaltung von Familienleben und die soziale Entwicklung
- Die Analyse der Familienpolitik in den Wahlprogrammen der wichtigsten deutschen Parteien im Jahr 2002
- Der wachsende Konsens über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als zentrales Ziel der Familienpolitik
- Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Gestaltung der Familienpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Interdependenz von privater Familie und gesellschaftlich-staatlicher Öffentlichkeit
Dieses Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen der Institution Familie und der gesellschaftlichen und staatlichen Öffentlichkeit. Es betont, dass familiäres Zusammenleben zwar weitgehend privat ist, aber dennoch stark von gesellschaftlichen Konventionen und staatlichen Interventionen beeinflusst wird. Der Text zeigt, wie die Familienentwicklung in Deutschland von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart durch politische und gesellschaftliche Faktoren geprägt wurde, wie z.B. die Ausbreitung von Sozialleistungen, die Emanzipationsbewegung der Frauen und die zunehmende Akzeptanz von Kinderlosigkeit. Es wird auch die Bedeutung von familienpolitischen Maßnahmen für die Gestaltung von Familienleben und die Sicherung der Reproduktion der Bevölkerung hervorgehoben.
2. Familienpolitik in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2002
Dieses Kapitel analysiert die Familienpolitik der wichtigsten deutschen Parteien im Kontext der Bundestagswahl 2002. Es werden die wichtigsten Punkte der Wahlprogramme der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und PDS im Hinblick auf die Themen Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finanzielle Unterstützung von Familien und die allgemeine Bedeutung von Familienpolitik in der Gesellschaft betrachtet.
3. Der breite Konsens: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Dieses Kapitel konzentriert sich auf den wachsenden Konsens über die Notwendigkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Der Text beleuchtet die verschiedenen Ansätze der Parteien, um dieses Ziel zu erreichen, z.B. durch den Ausbau der Kinderbetreuung, die Einführung flexibler Arbeitszeiten und die Förderung von betrieblichen Betreuungsangeboten.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Gesellschaft, Familie, Staat, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bundestagswahl, Wahlprogramme, SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, PDS, demografische Entwicklung, Sozialleistungen, Emanzipation, Kinderlosigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Institution Familie seit den 60er Jahren verändert?
Großfamilien wurden seltener, die ökonomische Bedeutung von Kindern sank durch den Sozialstaat, und die Emanzipation der Frauen führte zu neuen Lebensstilen.
Was ist das zentrale Ziel der Familienpolitik im Wahlkampf 2002?
Ein breiter Konsens bestand über alle Parteien hinweg in der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Warum ist Kinderbetreuung ein politisches Kernthema?
Ein Blick nach Skandinavien zeigt, dass die Entscheidung für Kinder eng an den Ausbau von Betreuungsangeboten und flexiblen Arbeitszeiten gekoppelt ist.
Welche Rolle spielt die Familie für das Gemeinwesen?
Familien sind Träger des Gemeinwesens, primäre Sozialisationsinstanzen und Produzenten von Pflege- und Versorgungsleistungen für die Gesellschaft.
Wie unterschieden sich die Parteiprogramme 2002 zur Familienpolitik?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Ansätze von SPD, CDU/CSU, Grünen, FDP und PDS hinsichtlich finanzieller Unterstützung und Betreuungskonzepten.
- Quote paper
- Timo Blaser (Author), 2002, Familienpolitik im Bundestagswahlkampf 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23682