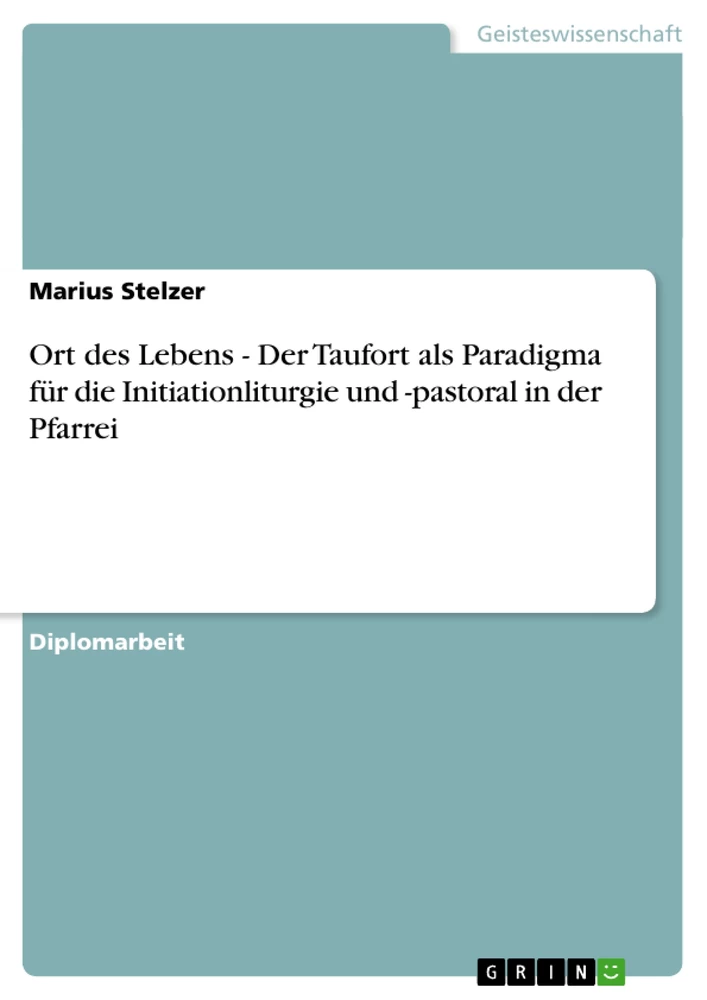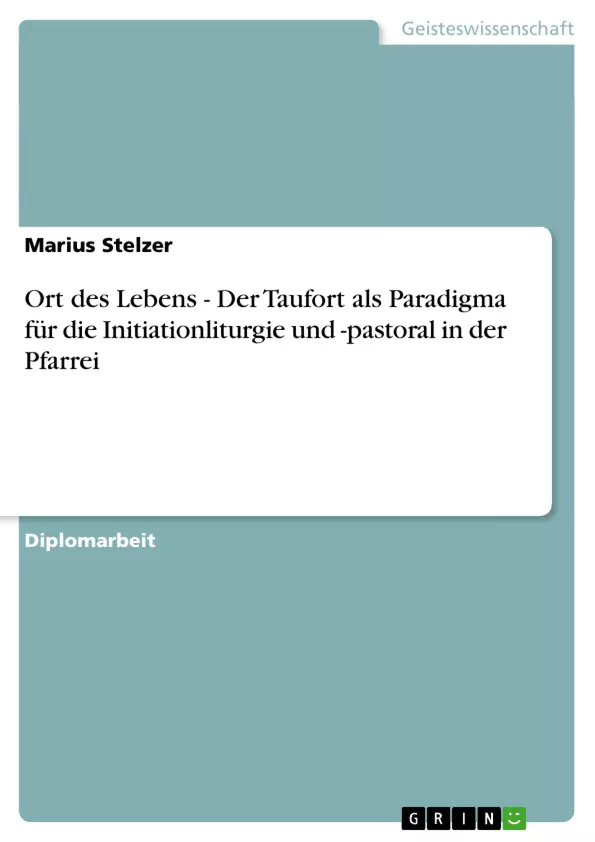[...] Im ersten Teil wird der Taufort im frühen Christentum untersucht.
Unterstützend werden altkirchliche Dokumente zu Fragen
der Taufpraxis und Ausgestaltung der Tauforte hinzugezogen. Die
weitere Entwicklung des Taufortes in der Geschichte bis zum
II. Vatikanischen Konzil wird in einem geschichtlichen Abriss verdeutlicht.
Hier soll nur ein roter Faden gesponnen werden, um
daraufhin den Kern der Problemanzeige dieser Arbeit zu formulieren.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Gestaltung des
Taufortes in heutiger Zeit. Es wird das erneuerte Verständnis der
Initiationsliturgie nach dem II. Vatikanischen Konzil anhand einschlägiger
Texte und Dokumente erörtert. Hierzu zählen auch die
gängigen Arbeitshilfen und Ritualbücher, um die wesentlichen
Punkte einer gewünschten Praxis der Initiationsliturgie zu dokumentieren.
Die tatsächliche Taufpraxis wird ablesbar in der Gestaltung
ausgewählter Tauforte, wie sie anschließend gesichtet und
bewertet werden. Daraufhin wird auf der Basis der bis dahin fest gehaltenen Ergebnisse in einem vorhandenen Kirchenbau ein
Taufort gestaltet, der sowohl den (kunst-) historischen, theologischen
als auch den pastoralliturgischen Ansprüchen und im wesentlichen
dem Menschen gerecht werden soll: „Die Sakramente
sind hingeordnet auf die Heiligung des Menschen“ (SC 59) ist ein
Grundsatz der Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils
und sollte vor allem in der Gestaltung des Taufortes sichtbar werden.
Dabei werden in dieser Arbeit besonders die Aspekte Kindertaufe
und Erwachsenentaufe beachtet, denn die Feier der Kindertaufe
wird auch in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen; die
Feier der Erwachsenentaufe bildet gerade in der jüngsten Zeit eine
besondere Herausforderung, da sich viele Erwachsene entgegen
jedem Trend zum Christsein entscheiden (hier erhalten wir
besonders aus den USA wertvolle Impulse). Abschließend werden
Optionen hinsichtlich der Feier der Tauferinnerung untersucht. Die
Tauferinnerung /-erneuerung kann vor allem eine Alternative zum
Problempunkt „Schuldbekenntnis / Kyrie“ im Gottesdienst sein und
soll dementsprechend dargestellt werden. Ebenso kann der Taufort
als Ort des Lebens gerade in den liturgischen Feiern am Lebensende,
der Krankensalbung und Begräbnisliturgie eine besondere
Rolle einnehmen. Grundsätzlich wird in dieser Arbeit exemplarisch gearbeitet.
Das bietet die Chance, die Sachverhalte im Wesentlichen zu
bestimmen und auf konkretes Anschauungsmaterial anzuwenden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Ikonografie des Taufortes in der Antike
- Der Taufort im frühen Christentum
- Das Taufhaus von Kal'at Sim'ân in Zentralsyrien
- Frühchristliche Dokumente zur Feiergestalt der Taufe
- Die Typologie des Taufortes /-gerätes in der Geschichte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
- Der geschichtliche Befund
- Zusammenschau
- Die Entwicklung der Ausgestaltung des Taufortes nach dem II. Vatikanischen Konzil
- Das erneuerte Verständnis der Taufe nach dem Konzil
- Problemanalyse
- Die Typologie nachkonziliarer Tauforte
- Die architektonische Dimension des Rituals
- Der Taufort der St. Christophorus Pfarrei in Westerland /Sylt
- Der Taufort der St. Hedwig Pfarrei in Paderborn - Auf der Lieth
- Der Taufort der St. Bruno Pfarrei in Düsseldorf-Unterrath
- Gestaltungsprobleme des Taufortes
- Exkurs: Die Gestaltung ausgewählter Tauforte in den USA
- Zusammenfassung
- Möglichkeiten der zeitgemäßen Gestaltung des Taufortes in einem bestehenden Kirchenraum
- Die Pfarrkirche St. Joseph in Stadtlohn - Ist-Zustand
- Die Pfarrkirche St. Joseph in Stadtlohn - Kann-Zustand
- Optionen für die Feiergestalt der Kinder- und Erwachsenentaufe
- Zukünftige Aufgaben der neuen Tauforte
- Taufgedächtnis im Sonntagsgottesdienst
- Krankensalbung
- Begräbnisliturgie und Friedhofsgestaltung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Gestaltung des Taufortes in der Geschichte des Christentums, insbesondere im Kontext des II. Vatikanischen Konzils. Sie untersucht die Entwicklung des Taufortes von der Antike bis zur Gegenwart und analysiert die theologischen und praktischen Aspekte der Initiationsliturgie im Wandel der Zeit.
- Die Ikonografie des Taufortes in der Antike und der frühen Kirche
- Die Typologie des Taufortes in der Geschichte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
- Die Gestaltung des Taufortes nach dem II. Vatikanischen Konzil
- Möglichkeiten der zeitgemäßen Gestaltung des Taufortes in einem bestehenden Kirchenraum
- Zukünftige Aufgaben der neuen Tauforte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Bedeutung der Liturgie im kirchlichen Leben und die zentrale Rolle der Taufe als Sakrament des Glaubens hervorhebt. Im ersten Teil wird der Taufort im frühen Christentum untersucht, wobei altkirchliche Dokumente zu Fragen der Taufpraxis und Ausgestaltung der Tauforte hinzugezogen werden. Die weitere Entwicklung des Taufortes in der Geschichte bis zum II. Vatikanischen Konzil wird in einem geschichtlichen Abriss verdeutlicht.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Gestaltung des Taufortes in heutiger Zeit. Es wird das erneuerte Verständnis der Initiationsliturgie nach dem II. Vatikanischen Konzil erörtert. Die tatsächliche Taufpraxis wird anhand ausgewählter Tauforte, die gesichtet und bewertet werden, ablesbar. Abschließend werden Möglichkeiten der zeitgemäßen Gestaltung des Taufortes in einem bestehenden Kirchenraum diskutiert.
Schlüsselwörter
Taufe, Initiationsliturgie, Taufort, Liturgie, Ikonografie, Typologie, II. Vatikanisches Konzil, Gestaltung, Praxis, Kirche, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Bedeutung des Taufortes?
Der Taufort gilt als "Ort des Lebens" und ist das Zentrum der Initiationsliturgie, an dem die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft vollzogen wird.
Wie sah der Taufort im frühen Christentum aus?
In der Antike gab es oft separate Taufhäuser (Baptisterien), wie das Beispiel Kal'at Sim'ân in Syrien zeigt, die architektonisch auf das Ritual abgestimmt waren.
Was änderte das II. Vatikanische Konzil an der Taufpraxis?
Das Konzil erneuerte das Verständnis der Initiation und forderte eine Gestaltung des Taufortes, die der Heiligung des Menschen und der Feiergestalt besser gerecht wird.
Warum ist die Erwachsenentaufe heute eine besondere Herausforderung?
Da sich wieder mehr Erwachsene für das Christsein entscheiden, muss der Taufort auch für Ganzkörper-Immersion (Untertauchen) oder entsprechende Riten geeignet sein.
Welche Rolle spielt der Taufort bei der Begräbnisliturgie?
Der Taufort kann als Ort des Lebens auch bei Feiern am Lebensende eine Rolle spielen, um den Bogen von der Taufe bis zur Auferstehungshoffnung zu spannen.
Wie kann ein Taufort in einer bestehenden Kirche modernisiert werden?
Die Arbeit zeigt am Beispiel von St. Joseph in Stadtlohn, wie historische Räume unter theologischen und pastoralen Aspekten zeitgemäß umgestaltet werden können.
- Quote paper
- Marius Stelzer (Author), 2000, Ort des Lebens - Der Taufort als Paradigma für die Initiationliturgie und -pastoral in der Pfarrei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23754