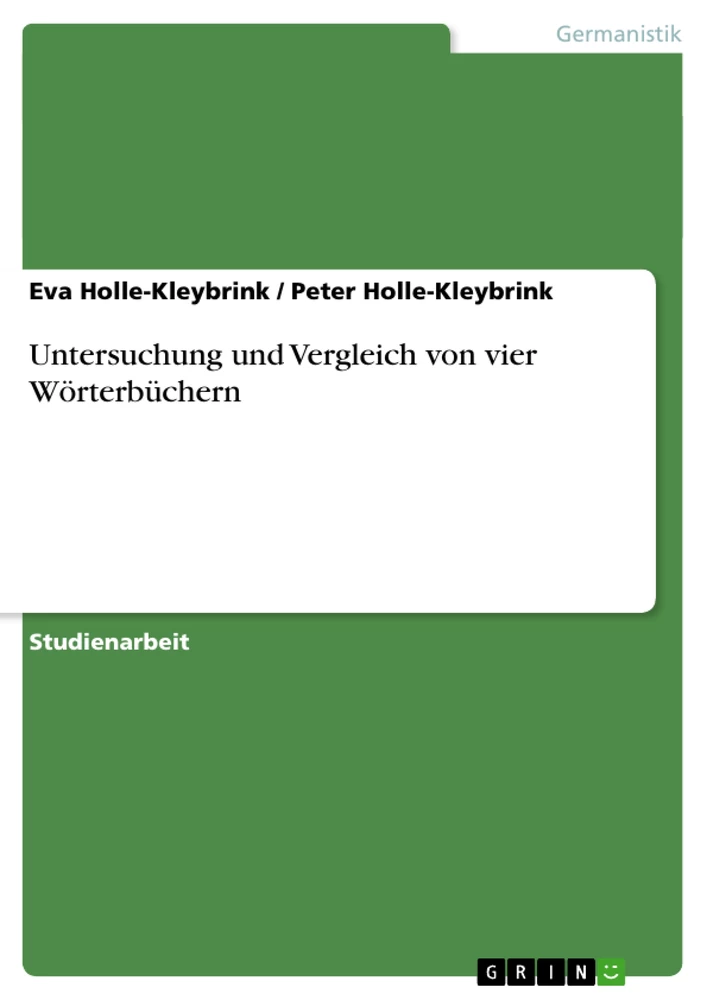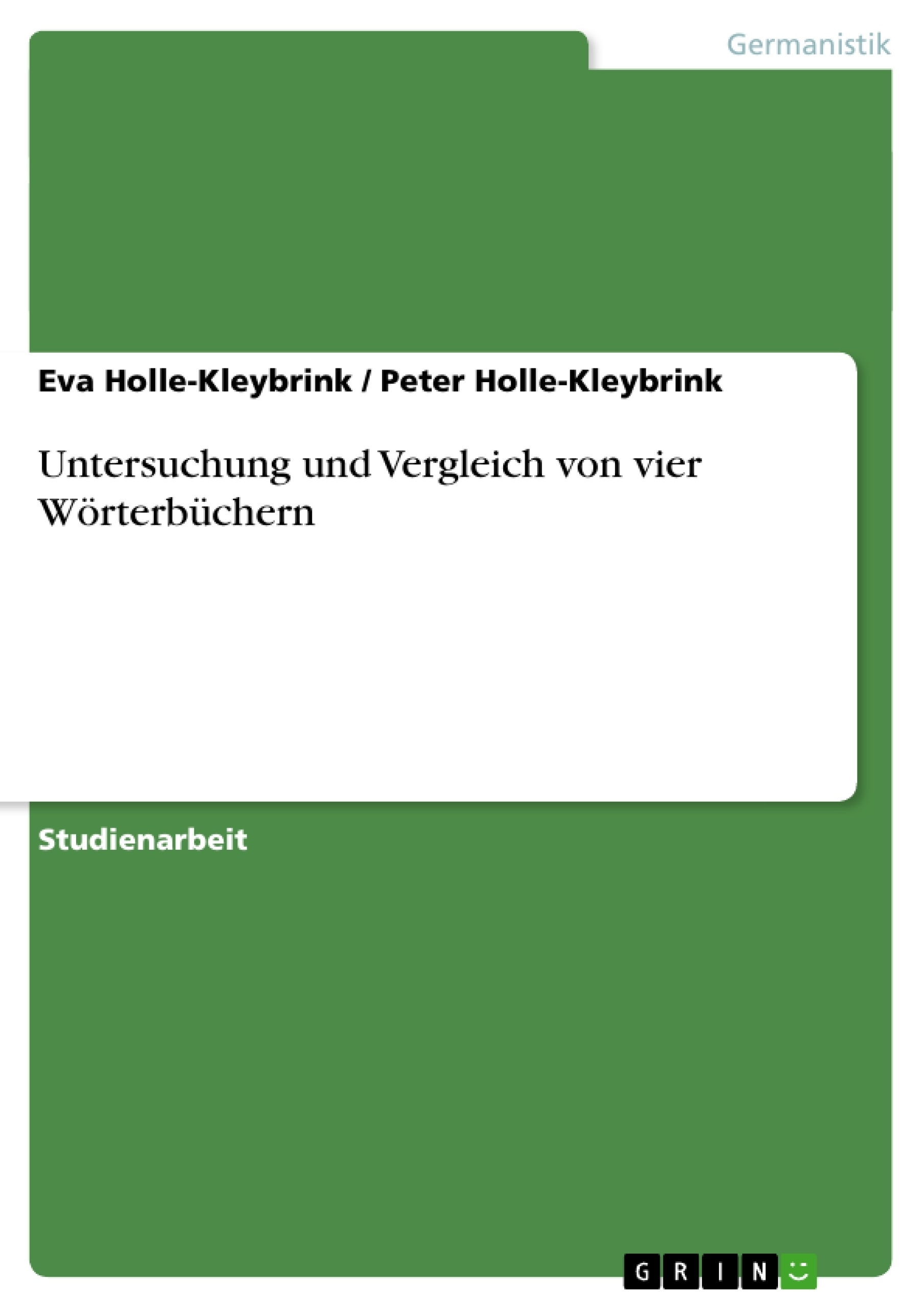[...] Da unsere Aufgabe darin besteht Wörterbücher zu vergleichen, galt es eine weitere
Auswahl zu treffen. Michael Schlaefer unterscheidet in seinem Buch „Lexikologie und
Lexikographie“ 3 vier Hauptgruppen von Wörterbuchtypen. Wir entschieden uns aus
diesem Grund dafür, ein Wörterbuch aus jeder Gruppe zu untersuchen. Die Wahl eines
gegenwartssprachlichen- standardsprachlichen Wörterbuches hatten wir ja bereits getroffen.
Als sprachhistorisches Wörterbuch entschieden wir uns für „Das Herkunftswörterbuch“4
aus dem Dudenverlag. Ein regionalsprachliches Wörterbuch hatten wir leider nicht zur
Verfügung, deshalb wählten wir zwei Wörterbücher zu Soziolekten – ein Fachwörterbuch
„Springer Wörterbuch Medizin“5 und ein jargonbezogenes Wörterbuch von Heinz Küpper
„Das Bundessoldatendeutsch“ 6 . Damit wir wenigstens bei grundlegenden Begriffen
Wiederholungen vermeiden können, werden wir in einem allgemeinen Teil zum
Wörterbuchaufbau immer wieder vorkommende Begrifflichkeiten klären. Der Aufbau der
folgenden Arbeit gliedert sich wie folgt: Vorstellung des Wörterbuchs, Untersuchung des
Wörterbuchaufbaus. Die Reihenfolge der Untersuchungen ist die Gleiche wie in dieser
Einleitung. Dieses Schema erachten wir als sinnvoll, da auf diese Weise auch ein selektiver
Zugriff auf die einzelnen Wörterbücher gewährleistet ist. Wir hoffen auf diesem Wege am Schluss Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfiltern zu können. Die behandelten
Beispiele finden sich im Anhang dieser Arbeit.
Dies soll zur Einleitung genügen, denn: „Am Anfang war das Wort - am Ende die
Phrase.“7
3 Schlaefer, Michael: Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutsche Wörterbücher.
Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH und Co 2002 (=Grundlagen der Germanistik 40).
4 Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. überarbeiteter Nachdruck der 2.
Auflage. Mannheim u.a. Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG 1997(=Der Duden in 12 Bänden 7).
5 Reuter, Peter: Springer Wörterbuch Medizin. Berlin: Springer-Verlag Berlin u.a. 2001.
6 Küpper, Heinz: ABC-Komiker bis Zwitschergemüse. Das Bundessoldatendeutsch. Wiesbaden: Verlag für
deutsche SpracheVfdS) GmbH 1978.
7 Stanislaw Jerzy Lec (polnischer Schriftsteller) 1906-1966.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wörterbuchaufbau
- Wörterbuchuntersuchungen
- Wahrig Deutsches Wörterbuch
- Aufbau Wahrig
- Duden Herkunftswörterbuch
- Aufbau des Herkunftswörterbuchs
- Springer Wörterbuch Medizin
- Aufbau des medizinischen Wörterbuchs
- ABC- Komiker bis Zwitschergemüse, Das Bundeswehrsoldatendeutsch
- Aufbau „Das Bundessoldatendeutsch“
- Wahrig Deutsches Wörterbuch
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht und vergleicht vier verschiedene Wörterbücher, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Aufbau und Informationsgehalt aufzuzeigen. Die Auswahl der Wörterbücher repräsentiert verschiedene Wörterbuchtypen nach Schlaefer (Lexikologie und Lexikographie).
- Vergleich verschiedener Wörterbuchtypen (Allgemeinwörterbuch, sprachhistorisches Wörterbuch, Fachwörterbuch, Jargonwörterbuch)
- Analyse des Aufbaus verschiedener Wörterbücher hinsichtlich Makro- und Mikrostruktur
- Untersuchung der Informationsdichte und -präsentation in den jeweiligen Wörterbüchern
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Informationsorganisation
- Bewertung der jeweiligen Wörterbücher für unterschiedliche Nutzergruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wörterbuchuntersuchung ein und begründet die Auswahl der vier untersuchten Wörterbücher: Wahrig (Allgemeinwörterbuch), Duden Herkunftswörterbuch (sprachhistorisches Wörterbuch), Springer Wörterbuch Medizin (Fachwörterbuch) und Küppers „Das Bundessoldatendeutsch“ (Jargonwörterbuch). Es wird die Methodik der Arbeit erläutert, die auf einem Vergleich der Wörterbuchaufbauten basiert und einen selektiven Zugriff auf die einzelnen Wörterbücher ermöglicht. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Wörterbücher herauszuarbeiten.
Wörterbuchaufbau: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Wörterbuchs und grenzt es von Lexika und Enzyklopädien ab. Es erläutert das Prinzip der alphabetischen Ordnung und die verschiedenen Arten der Informationsdichte und -präsentation. Der Kapitel beschreibt die Unterscheidung zwischen Artikelteil und komplementären Wörterbuchteilen (z.B. Vorwort, Abkürzungsverzeichnis). Im Detail werden die Makrostruktur (Organisationsprinzip der Artikelreihenfolge, z.B. alphabetisch, rückläufig) und die Mikrostruktur (Organisationsprinzip der Artikel selbst, z.B. erzählende vs. systematische Textform) von Wörterbuch-Artikeln untersucht und anhand verschiedener Typen (glattalphabetisch, nischenalphabetisch, nestalphabetisch) differenziert.
Schlüsselwörter
Wörterbücher, Lexikographie, Wahrig, Duden, Springer, Küpper, Wörterbuchaufbau, Makrostruktur, Mikrostruktur, Allgemeinwörterbuch, Herkunftswörterbuch, Fachwörterbuch, Jargonwörterbuch, alphabetische Ordnung, Informationsdichte, Lemma, Artikel.
FAQ: Wörterbuchuntersuchung - Aufbau und Vergleich verschiedener Wörterbuchtypen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht und vergleicht vier verschiedene Wörterbücher, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Aufbau und Informationsgehalt aufzuzeigen. Die untersuchten Wörterbücher repräsentieren verschiedene Wörterbuchtypen (Allgemeinwörterbuch, sprachhistorisches Wörterbuch, Fachwörterbuch, Jargonwörterbuch).
Welche Wörterbücher wurden untersucht?
Die Arbeit analysiert das Wahrig Deutsche Wörterbuch (Allgemeinwörterbuch), das Duden Herkunftswörterbuch (sprachhistorisches Wörterbuch), das Springer Wörterbuch Medizin (Fachwörterbuch) und Küppers „Das Bundeswehrsoldatendeutsch“ (Jargonwörterbuch).
Was sind die Ziele der Untersuchung?
Die Ziele sind der Vergleich verschiedener Wörterbuchtypen, die Analyse der Makro- und Mikrostruktur der Wörterbücher, die Untersuchung der Informationsdichte und -präsentation, die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Informationsorganisation sowie die Bewertung der Wörterbücher für unterschiedliche Nutzergruppen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Wörterbuchaufbau, ein Kapitel zu den Wörterbuchuntersuchungen (mit Unterkapiteln zu jedem der vier Wörterbücher), und einen Schluss. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter "Wörterbuchaufbau" verstanden?
Das Kapitel "Wörterbuchaufbau" definiert den Begriff "Wörterbuch", grenzt ihn von Lexika und Enzyklopädien ab und beschreibt die alphabetische Ordnung, Informationsdichte und -präsentation. Es analysiert die Makrostruktur (Organisation der Artikelreihenfolge) und die Mikrostruktur (Organisation der Artikel selbst), einschließlich der Unterscheidung zwischen Artikelteil und komplementären Wörterbuchteilen.
Welche Aspekte der Mikro- und Makrostruktur werden untersucht?
Die Makrostruktur umfasst die Organisationsprinzipien der Artikelreihenfolge (z.B. alphabetisch, rückläufig). Die Mikrostruktur befasst sich mit der Organisation der Artikel selbst (z.B. erzählende vs. systematische Textform) und unterscheidet zwischen glattalphabetisch, nischenalphabetisch und nestalphabetisch.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik basiert auf einem Vergleich der Wörterbuchaufbauten und ermöglicht einen selektiven Zugriff auf die einzelnen Wörterbücher. Die Einleitung erläutert die Methodik im Detail.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wörterbücher, Lexikographie, Wahrig, Duden, Springer, Küpper, Wörterbuchaufbau, Makrostruktur, Mikrostruktur, Allgemeinwörterbuch, Herkunftswörterbuch, Fachwörterbuch, Jargonwörterbuch, alphabetische Ordnung, Informationsdichte, Lemma, Artikel.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Lexikographie, Wörterbücher und deren Aufbau interessieren, insbesondere für Studierende der Linguistik und Lexikologie.
- Citation du texte
- Eva Holle-Kleybrink (Auteur), Peter Holle-Kleybrink (Auteur), 2004, Untersuchung und Vergleich von vier Wörterbüchern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23806