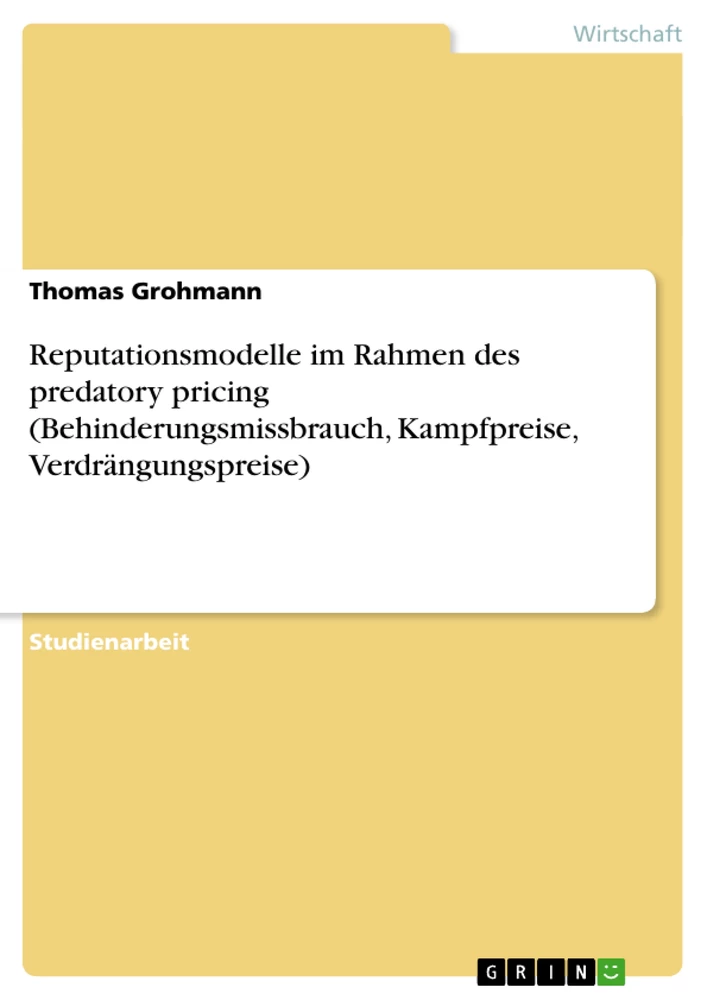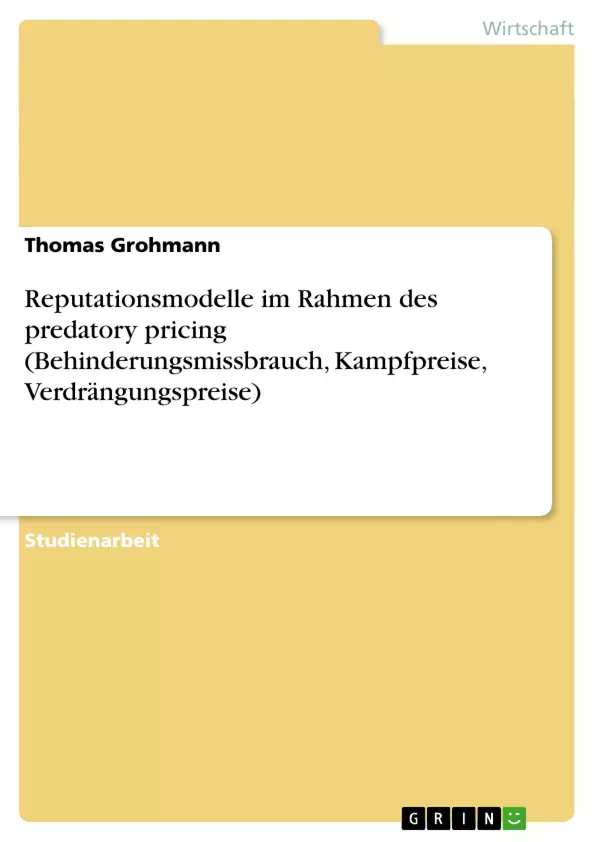Behinderungsmissbrauch beschreibt den Versuch durch Wahl bestimmter Strategien, insbesondere durch Anwendung des sog. Predatory Pricing, Wettbewerber aus einem Markt zu verdrängen bzw. Markteintritte zu verhindern. Dabei bezeichnet Predatory Pricing das Setzen von sog. Kampf- bzw. Verdrängungspreisen. Eine dominante Firma setzt dabei temporär aggressive Preise mit dem ausschließlichen Ziel, Marktanteile zu gewinnen. Die Vertreter der sog. Chicago School (u.a. McGee) vertreten jedoch die Ansicht, dass derartige Verdrängungspreispraktiken irrationale Strategien darstellen. McGees Hauptargumente hierfür sind, dass Verdrängungspreiswettbewerb inkonsistent ist mit kurzfristiger Gewinnmaximierung, es günstigere Strategien wie bspw. Fusionen oder Unternehmenskäufe zur Erzielung einer Monopolstellung gibt, die dominante Firma selbst größere Verluste erleidet als ihr Gegner, die potentiellen Wettbewerber die Drohung von Verdrängungspreiswettbewerb nicht als glaubwürdig empfinden und Preiskampf seitens der dominanten Firma gegenüber bereits bestehenden Firmen keine zukünftigen Markteintritte verhindert. Gegen diese Meinung kam schnell Kritik auf. McGees Argument, dass Verdrängungspreiswettbewerb unprofitabel sei, gründet darauf, dass sich die dominante Firma nur einem einzelnen Wettbewerber gegenübersieht. Wenn jedoch Firmen in mehreren räumlich abgegrenzten Märkten sequentiell oder simultan agieren oder wenn es sich um ein Mehrproduktunternehmen handelt, kann die Firma durchaus Verdrängungspreistechniken in einem Markt anwenden, um andere Wettbewerber abzuschrecken. Dies erscheint intuitiv logisch: Die Firma erwirbt sich einen Ruf, eine Reputation für aggressives Verhalten bei Markteintritt und hält dadurch andere Konkurrenten, aus Angst, die gleiche Reaktion der dominanten Firma zu erfahren, von ihren Eintrittsversuchen ab. Jedoch wurde von Selten in seinem „Chain-Store Paradoxon“ gezeigt, dass dieser Reputationseffekt gerade nicht existiert. Erneut fehlte die Basis für die rationale Anwendung von Verdrängungspreisstrategien.
Im Jahr 1982 gelang es jedoch Kreps und Wilson sowie Milgrom und Roberts anhand eines formalen Modells doch die Existenz von Reputationseffekten aufzuzeigen. Sie lieferten damit die Begründung, dass Verdrängungspreistechniken durchaus in der Praxis angewendet werden, da sie nicht, wie ursprünglich angenommen, irrationale Praktiken darstellen, sondern unter bestimmten Bedingungen als rationale, gewinnmaximierende Strategien erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Chain-Store Paradoxon von Selten
- 2.1 Begrenzte Anzahl von potentiellen Konkurrenten
- 2.2 Unendliche Anzahl potentieller Wettbewerber
- 2.3 Zusammenfassung und Beurteilung des Chain-Store Paradoxons
- 3. Asymmetrische Information als Begründung für Reputationseffekte
- 3.1 Die Grundidee
- 3.2 Darstellung des Modells und seiner Annahmen
- 3.3 Herleitung und Beweis der gleichgewichtigen Strategien
- 3.4 Erweiterung und Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen des Behinderungsmissbrauchs, insbesondere mit der Frage, ob und unter welchen Bedingungen "Predatory Pricing" als Strategie zur Verdrängung von Wettbewerbern und zur Verhinderung von Markteintritten effektiv und rational ist. Die Arbeit analysiert das "Chain-Store Paradoxon" von Selten und untersucht die Rolle der asymmetrischen Information als Grundlage für Reputationseffekte.
- Das Chain-Store Paradoxon von Selten und seine Implikationen für Verdrängungspreisstrategien
- Die Rolle der asymmetrischen Information bei der Entstehung von Reputationseffekten
- Die Frage der Rationalität und Effektivität von Verdrängungspreispraktiken
- Die Kritik an der Chicago School und ihre Argumentation gegen die Existenz von Verdrängungspreisstrategien
- Die Bedeutung von Reputation für Unternehmen in mehreren Märkten oder im Wettbewerb mit mehreren Produkten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Behinderungsmissbrauch und "Predatory Pricing" ein. Es stellt die unterschiedlichen Sichtweisen der Chicago School und ihrer Kritiker dar, wobei besonders die Argumente von McGee und Selten beleuchtet werden.
Kapitel 2 analysiert das "Chain-Store Paradoxon" von Selten, das die Frage aufwirft, ob Reputationseffekte bei der Abschreckung potentieller Konkurrenten tatsächlich funktionieren. Es untersucht die beiden Szenarien mit einer begrenzten und einer unendlichen Anzahl von potentiellen Wettbewerbern und bewertet die Auswirkungen des Paradoxons auf die Rationalität von Verdrängungspreisstrategien.
Kapitel 3 befasst sich mit der asymmetrischen Information als Grundlage für Reputationseffekte. Es stellt ein Modell vor, das die Interaktion zwischen einem etablierten Unternehmen und einem potentiellen Konkurrenten unter Bedingungen der Informationsasymmetrie untersucht. Die Kapitel erörtert die Entstehung von glaubwürdigen Drohungen durch Reputation und analysiert die Auswirkungen auf die Markteintrittsentscheidung des Konkurrenten.
Das vierte Kapitel gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen und analysiert die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Behinderungsmissbrauch, "Predatory Pricing", Reputationseffekte, asymmetrische Information, "Chain-Store Paradoxon", strategisches Verhalten, Markteintritt, Marktmacht, Chicago School, und die Analyse von Spieltheorie-Modellen.
Häufig gestellte Fragen zu Predatory Pricing und Reputationsmodellen
Was versteht man unter „Predatory Pricing“?
Predatory Pricing (Kampfpreisstrategie) bezeichnet das bewusste Setzen extrem niedriger Preise durch ein dominantes Unternehmen, um Wettbewerber aus dem Markt zu verdrängen.
Was besagt das „Chain-Store Paradoxon“ von Selten?
Reinhard Selten zeigte mit diesem Paradoxon, dass Reputationseffekte in einem Spiel mit endlicher Wiederholung theoretisch nicht existieren dürften, was aggressive Preiskämpfe irrational erscheinen ließe.
Wie begründen asymmetrische Informationen die Rationalität von Kampfpreisen?
Wenn potenzielle Konkurrenten nicht genau wissen, ob ein etabliertes Unternehmen „aggressiv“ oder „schwach“ ist, kann dieses durch Kampfpreise eine Reputation für Härte aufbauen, um Markteintritte zu verhindern.
Welche Position vertritt die Chicago School zum Thema Kampfpreise?
Vertreter wie McGee halten Verdrängungspreise für irrational, da sie für das dominante Unternehmen teurer seien als Fusionen und keine langfristige Abschreckung garantierten.
Warum ist Reputation für Mehrproduktunternehmen wichtig?
Ein Unternehmen kann in einem Markt aggressiv agieren, um eine Reputation aufzubauen, die Wettbewerber in vielen anderen Märkten gleichzeitig abschreckt.
- Quote paper
- Thomas Grohmann (Author), 2004, Reputationsmodelle im Rahmen des predatory pricing (Behinderungsmissbrauch, Kampfpreise, Verdrängungspreise), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23814