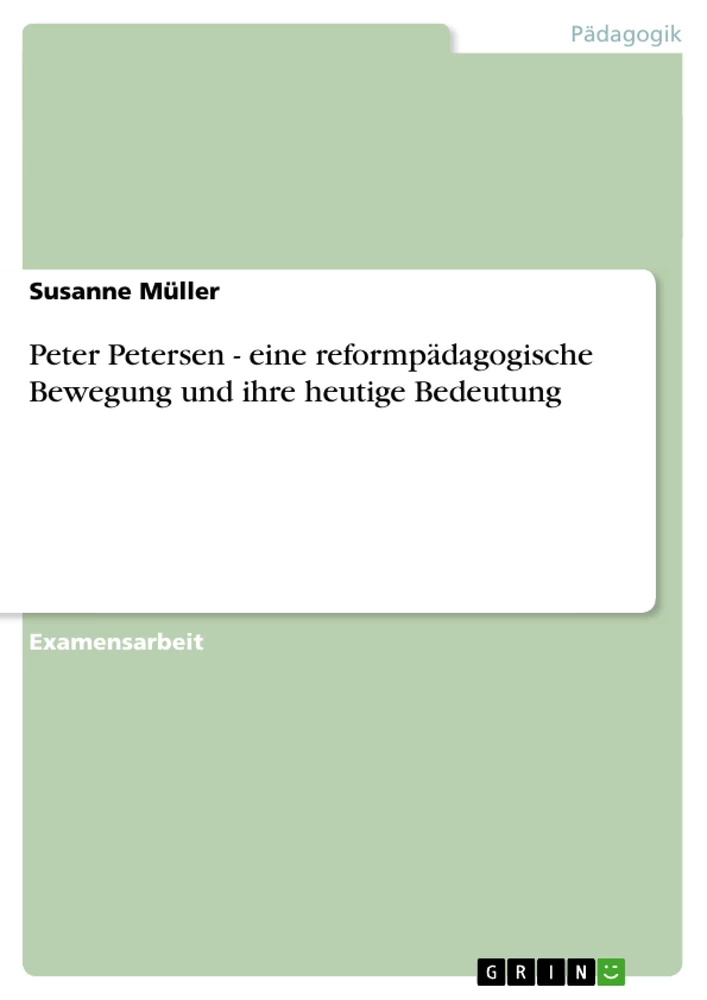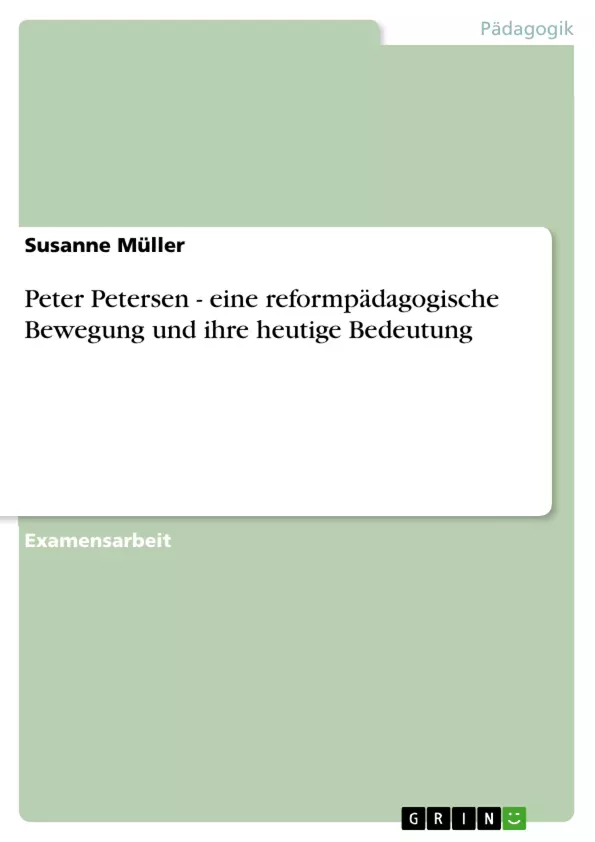Den Anstoß für die folgende Arbeit gaben die Erfahrungen während meines Blockpraktikums in der Erfurter Grundschule am Steiger. Im Rahmen dieses Praktikums bot sich mir einmalig die Möglichkeit, einen Einblick in einen durch Wochenplanunterricht geprägten Schulalltag zu bekommen. Bei meiner Hospitation konnte ich den Einsatz des Wochenplans beobachten. Ich erlebte die Gestaltung eines rhythmisierten Vormittags, geprägt durch immer wiederkehrende Elemente wie das Klassengespräch im Morgenkreis, die selbsttätige Arbeit der Kinder und die Vorstellung verschiedener Arbeiten. Im gesamten Schulalltag fiel mir immer wieder ganz besonders die selbständige Arbeit der Kinder mit Hilfe ihrer Wochenpläne, aber auch während der Ausübung der freien Tätigkeiten auf. Die Lehrerinnen erlebte ich in einem partnerschaftlichen Umgang in einer für mich zunächst ungewohnten Rolle.
Auch wenn das Praktika schon einige Zeit vergangen ist, hat mich dieser von Offenheit und Vielfalt geprägte Unterricht so sehr begeistert, dass ich den Wunsch verspürte, mich insbesondere mit dem Thema „Peter Petersen“ näher auseinanderzusetzen.
Besonders der Vergleich mit meinem ersten Orientierungspraktikum und auch mit meiner eigenen Grundschulzeit, welche geprägt waren durch einen überwiegend frontal vom Lehrer geführten Unterricht, machten mich neugierig auf die Möglichkeiten, die der „Jenaplan“ von Peter Petersen bieten kann. Darüber hinaus ist es für mich von großer Bedeutung, dass ich mich einem Thema widme, welches sich direkt auf die Arbeit in der Grundschule bezieht.
Aus diesen Gründen weckte das Thema „Peter Petersen“, aber auch die aktuelle Situation in den Schulen, im Hinblick darauf, ob und wie der „Jenaplan“ eingesetzt wird, mein Interesse. Ich beschloss daher, meine wissenschaftliche Hausarbeit über diese Thematik zu verfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Jenaplan als Form des offenen Unterrichts
- 2.1 Die Öffnung von Schule und Unterricht
- 2.2 Der pädagogische Auftrag der Grundschule
- 2.3 Die veränderte Lebenswelt der Kinder
- 2.3.1 Kinder leben heute in einer veränderten familiären Lebenswelt
- 2.3.2 Veränderte Spiel- und Freizeitverhalten
- 2.3.3 Veränderte Lebenswirklichkeit durch Medien
- 2.3.4 Veränderte elterliches Erziehungsverhalten
- 2.3.5 Veränderte Situation durch Vielfalt der Kulturen
- 2.4 Innere Differenzierung als Reaktion auf eine veränderte Kindheit
- 3. Biographie von Peter Petersen
- 3.1 Hamburger Jahre
- 3.2 Berufung nach Jena
- 4. Jenaplan – Entwicklung einer pädagogischen Schule
- 4.1 Die Reformpädagogik
- 4.1.1 Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und am konventionellen Lernbegriff
- 4.1.2 Die schulorganisatorischen Forderungen
- 4.2 Reform der Schule unter dem Primat der Erziehung
- 4.2.1 Die Universitätsübungsschule in Jena
- 4.2.2 Die neu-europäische Erziehungsbewegung 1925
- 4.2.3 Die Entstehung des Namens „Jena-Plan“
- 4.2.4 Die Universitätsübungsschule in Jena in der SBZ und der DDR zwischen 1945 und 1950
- 4.2.5 Schulversuche nach dem Jenaplan in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.2.6 Aktuelle Konzepte
- 4.3 Jenaplan Renaissance in den Niederlanden
- 4.4 Zusammenfassung
- 4.5 Resümee: Die Jenaplan Schule als eine Schule der Demokratie?
- 5. Der Ansatz des Jenaplans
- 5.1 Die Erziehungsidee
- 5.2 Wochenarbeitsplan statt „Fetzenstundenplan“
- 5.2.1 Kriterien eines „rhythmischen Wochenarbeitsplans“
- 5.3 Bildungsgrundformen
- 5.3.1 Das Gespräch
- 5.3.2 Das Spiel
- 5.3.3 Die Arbeit
- 5.3.3.1 Die Arbeitsmittel
- 5.3.3.2 Leistungskultur statt Leistungskult
- 5.3.4 Die Feier
- 5.3.4.1 Ziele der Feier
- 5.3.4.2 Schlussbetrachtung
- 5.4 „Schulwohnstube“ statt Klassenzimmer
- 5.4.1 Das Gestalten der „Schulwohnstube“
- 5.4.2 Lernumgebung als Anreiz
- 5.5 Stammgruppenprinzip statt Jahrgangsklassen
- 5.5.1 Die pädagogisch-didaktischen Vorteile
- 5.5.2 Die Schulgemeinde
- 5.6 Die Lehrerrolle
- 5.7 Probleme beim Unterricht nach dem Jenaplan
- 5.8 Zusammenfassung
- 6. Die Grundschule am Steigerwald
- 6.1 Das Schulkonzept
- 6.2 Elternarbeit
- 7. Der Jenaplan in der schulischen Praxis
- 7.1 Einführung
- 7.2 Erkenntnismöglichkeiten des narrativen Interviews
- 7.3 Das Ablaufschema
- 7.4 Gruppendiskussion
- 7.5 Ergebnisse und Interpretation des Interviews
- 8. Kindorientierung in der Jenaplan-Schule?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den Jenaplan als reformpädagogisches Konzept und seine heutige Bedeutung für die Grundschule. Ziel ist es, den Jenaplan im Kontext der veränderten Lebenswelt von Kindern zu betrachten und seine Eignung für den heutigen Unterricht zu evaluieren. Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln des Jenaplans, analysiert seine pädagogischen Prinzipien und untersucht seine praktische Umsetzung an einem Beispiel.
- Der Jenaplan als Antwort auf die veränderte Lebenswelt von Kindern
- Die historischen Entwicklung und die philosophischen Grundlagen des Jenaplan
- Die Prinzipien des Jenaplans: Wochenplan, Stammgruppen, Schulwohnstube
- Die Rolle der Lehrer und die Bedeutung der Elternarbeit im Jenaplan
- Eine Fallstudie: Die Umsetzung des Jenaplan an einer konkreten Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Entstehungshintergrund der Arbeit, der in den Erfahrungen während eines Blockpraktikums in einer Grundschule mit Wochenplanunterricht liegt. Die Autorin erläutert ihre Motivation, sich mit dem Thema „Peter Petersen“ auseinanderzusetzen, aufgrund des Kontrasts zwischen dem erlebten offenen Unterricht und ihrem eigenen, eher frontal unterrichteten Grundschulalltag. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Untersuchung der gesellschaftlichen Bedeutung des Jenaplans im Kontext der Demokratie und verzichtet auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Rolle des Jenaplans im Nationalsozialismus.
2. Der Jenaplan als Form des offenen Unterrichts: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit der Öffnung von Schule und Unterricht und dem pädagogischen Auftrag der Grundschule im heutigen Kontext. Es analysiert die Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder (Familie, Freizeit, Medien, Erziehungsstile, kulturelle Vielfalt) und begründet damit die Notwendigkeit eines differenzierten Unterrichts, wie er vom Jenaplan angeboten wird. Es stellt die Argumentation auf, dass der Jenaplan ein Ansatz sein kann, der dem pädagogischen Auftrag der Schule in einer sich verändernden Gesellschaft gerecht wird.
3. Biographie von Peter Petersen: Dieses Kapitel skizziert die wichtigsten biographischen Stationen von Peter Petersen, um seine Entwicklung als Pädagoge und die Entstehung seiner Ideen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf seinen Erfahrungen und Einflüssen, die zur Entwicklung des Jenaplan führten. Die Darstellung seiner Hamburger Jahre und seiner Berufung nach Jena liefert einen wichtigen Kontext für das Verständnis seiner pädagogischen Konzepte.
4. Jenaplan – Entwicklung einer pädagogischen Schule: Dieses Kapitel verortet den Jenaplan historisch und konzeptionell innerhalb der Reformpädagogik, untersucht seine Entwicklung in verschiedenen politischen Systemen (SBZ/DDR, Bundesrepublik) und analysiert seine unterschiedlichen Interpretationen im Laufe der Zeit. Es wird die gesellschaftspolitische Position von Peter Petersen im Zusammenhang mit dem Jenaplan beleuchtet.
5. Der Ansatz des Jenaplans: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Kernelemente des Jenaplan-Konzepts, einschließlich der Erziehungsidee, des Wochenplans, der Bildungsgrundformen (Gespräch, Spiel, Arbeit, Feier), der Gestaltung der Lernumgebung („Schulwohnstube“), des Stammgruppenprinzips und der Rolle der Lehrkräfte. Es werden die pädagogisch-didaktischen Vorteile des Jenaplan erläutert und auch die Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung angesprochen.
6. Die Grundschule am Steigerwald: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, die die praktische Umsetzung des Jenaplan an einer konkreten Grundschule beschreibt. Es beschreibt das Schulkonzept und die Rolle der Elternarbeit in der Schule.
7. Der Jenaplan in der schulischen Praxis: Dieses Kapitel zeigt die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Jenaplan. Es beschreibt die Methodik des narrativen Interviews und der Gruppendiskussion, und analysiert die Ergebnisse der Untersuchung.
8. Kindorientierung in der Jenaplan-Schule?: Dieses Kapitel untersucht, inwiefern der Jenaplan den Prinzipien der Kindorientierung gerecht wird.
Schlüsselwörter
Jenaplan, Reformpädagogik, Peter Petersen, Offener Unterricht, Wochenplan, Stammgruppen, Schulwohnstube, Grundschule, Kindorientierung, Differenzierung, Demokratie, Gemeinschaft, Erziehung, Lebenswelt der Kinder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: "Der Jenaplan"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Jenaplan als reformpädagogisches Konzept und seine heutige Bedeutung für die Grundschule. Sie analysiert den Jenaplan im Kontext der veränderten Lebenswelt von Kindern und evaluiert seine Eignung für den heutigen Unterricht.
Welche Aspekte des Jenaplans werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln des Jenaplans, analysiert seine pädagogischen Prinzipien (Wochenplan, Stammgruppen, Schulwohnstube etc.), untersucht seine praktische Umsetzung an einem Beispiel (Grundschule am Steigerwald) und befasst sich mit der Rolle der Lehrer und der Bedeutung der Elternarbeit.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit einer empirischen Untersuchung. Die empirische Untersuchung nutzt narrative Interviews und Gruppendiskussionen, um den Jenaplan in der schulischen Praxis zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Der Jenaplan als Form des offenen Unterrichts, Biographie von Peter Petersen, Jenaplan – Entwicklung einer pädagogischen Schule, Der Ansatz des Jenaplans, Die Grundschule am Steigerwald, Der Jenaplan in der schulischen Praxis und Kindorientierung in der Jenaplan-Schule? Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Jenaplan-Konzepts.
Wer ist Peter Petersen und welche Rolle spielt er?
Peter Petersen ist der Begründer des Jenaplan-Konzepts. Die Arbeit skizziert seine Biographie und zeigt auf, wie seine Erfahrungen und Einflüsse zur Entwicklung des Jenaplans führten.
Welche Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert Veränderungen in der familiären Lebenswelt, im Spiel- und Freizeitverhalten, durch Medien, im elterlichen Erziehungsverhalten und durch die kulturelle Vielfalt. Diese Veränderungen werden als Begründung für die Notwendigkeit eines differenzierten Unterrichts wie im Jenaplan angeführt.
Welche Kernelemente des Jenaplan-Konzepts werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Erziehungsidee, den Wochenplan, die Bildungsgrundformen (Gespräch, Spiel, Arbeit, Feier), die Gestaltung der Lernumgebung ("Schulwohnstube"), das Stammgruppenprinzip und die Rolle der Lehrkräfte.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die Arbeit beschreibt die Methodik des narrativen Interviews und der Gruppendiskussion und analysiert die Ergebnisse der Untersuchung zum Jenaplan in der schulischen Praxis. Die konkreten Ergebnisse werden im Kapitel "Der Jenaplan in der schulischen Praxis" detailliert dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit evaluiert die Eignung des Jenaplans für den heutigen Unterricht und untersucht, inwiefern der Jenaplan den Prinzipien der Kindorientierung gerecht wird. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Schlusskapitel zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Jenaplan, Reformpädagogik, Peter Petersen, Offener Unterricht, Wochenplan, Stammgruppen, Schulwohnstube, Grundschule, Kindorientierung, Differenzierung, Demokratie, Gemeinschaft, Erziehung, Lebenswelt der Kinder.
- Arbeit zitieren
- Susanne Müller (Autor:in), 2003, Peter Petersen - eine reformpädagogische Bewegung und ihre heutige Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23825