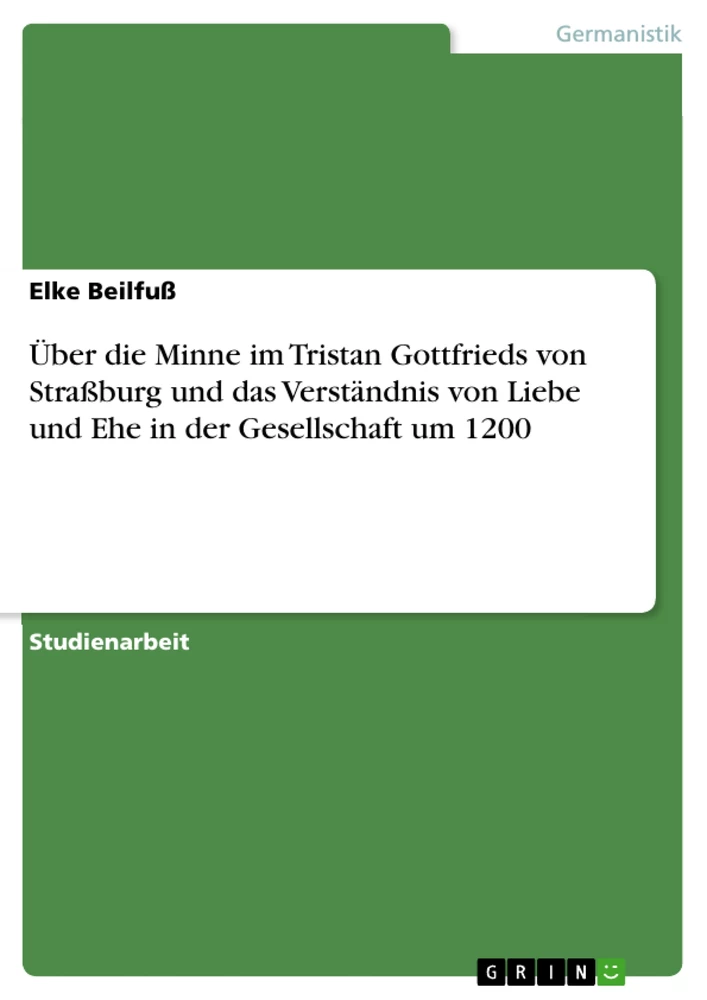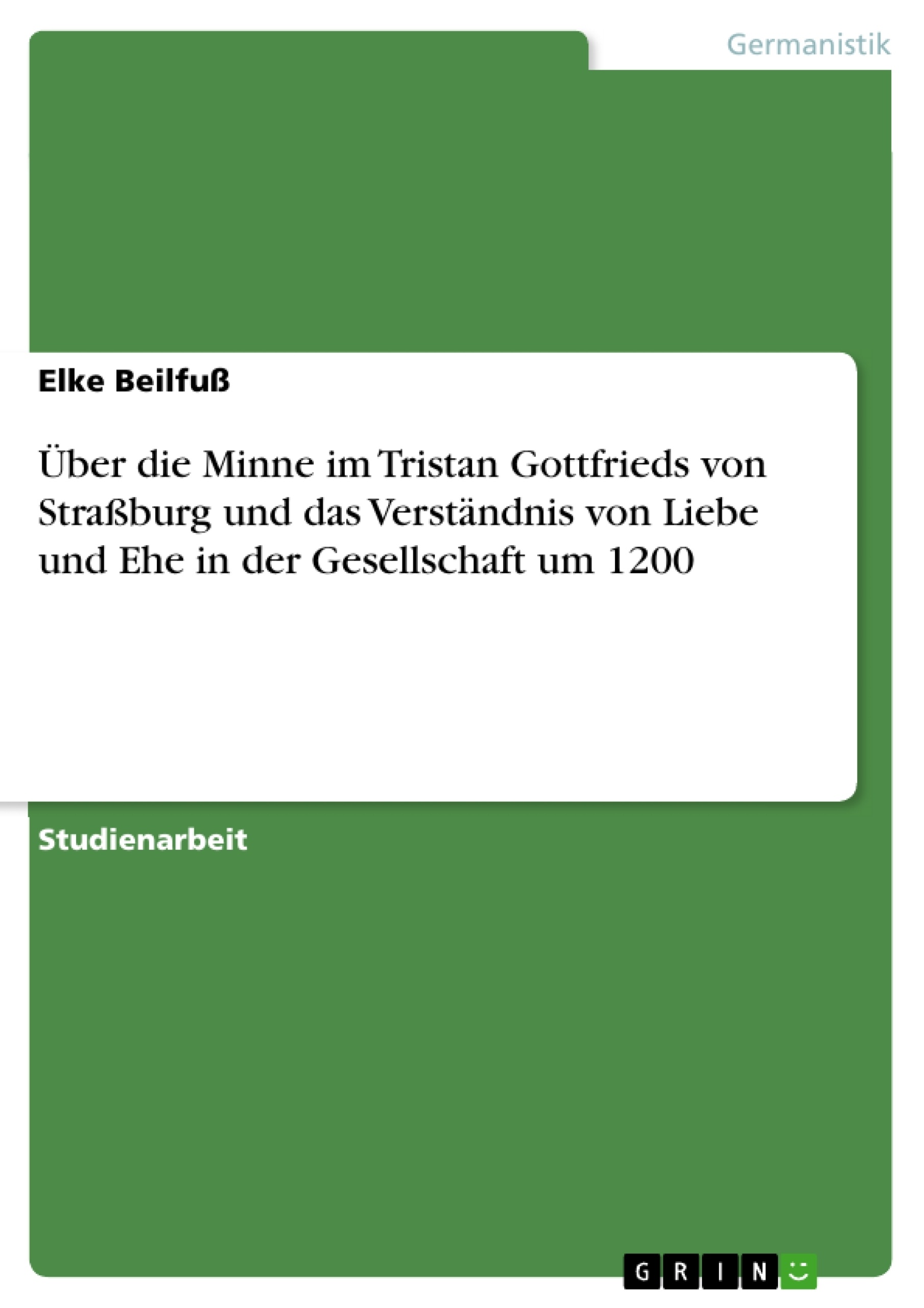Der mittelhochdeutsche Ausdruck ‚Minne‘ wird seit dem 19. Jahrhundert als Terminus in der Literaturgeschichte für die Liebe in der mittelalterlich höfischen Dichtung gebraucht. Im Mittelhochdeutschen meinte das Wort ‚minne‘ nicht nur die Liebesbeziehung zwischen den Geschlechtern, sondern bezeichnete auch die allgemein freundschaftlichen und emotionalen Beziehungen der Menschen untereinander und ein, »freundliches Gedenken« gegenüber Gott. Die Einschränkung des Begriffs ‚Minne‘ auf die erotische und sexuelle Liebe erfolgte erst im Spätmittelalter, dies ist dem Lexikon des Mittelalters zu entnehmen. [...] Damit ist das Thema auch schon angedeutet: Es geht um die Liebe im Tristanroman Gottfrieds von Straßburg und im Vergleich dazu, um die gesellschaftliche Auffassung von der Liebe zur Entstehungszeit des Textes.
Es lässt sich feststellen, dass Gottfried von Straßburgs Beschreibung der Minne im Tristan zur Zeit seiner Entstehung und Rezeption zwar ein Skandalon darstellte, aber dennoch die Vorstellungen der mittelalterlichen Gesellschaft nicht gänzlich von der beschriebenen Minne abwichen: So beschreibt Gottfried die Tristanminne als eine leidenschaftliche körperliche Liebe, die mit Ehe unvereinbar bleibt und in der Ehe keinen Platz hat. Diese Auffassung wurde auch von Zeitgenossen, wie beispielsweise Andreas Capellanus, vertreten. Des weiteren zeigt sich in Isolde zwar eine umfassend beschriebene Frauenfigur, die teilweise sogar eine aktive Rolle einnimmt. Doch als Ehebrecherin verdeutlichte sie der männlichen Leser- und Zuhörerschaft eben jenes Bild von dem unbekannten weiblichen Wesen, welches ihnen schon des öfteren angst gemacht hatte. Das Göttliche der Minne bei Gottfried, das in der Grottenepisode besonders deutlich hervortritt, scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein. In der Minnegrotte wird die Verbindung zur Gottesliebe und zur Vorstellung von der mystischen Erfahrung, wie Bernhard von Clairvaux sie im Hohenlied sieht, äußerst anschaulich. Die Liebe, vor allem als leidvolle Erfahrung, wird zur mystischen Erfahrung, die zu Glückseligkeit führt, aber auch zum Tod.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tristanstoff und Minnetrank
- Die Protagonisten Tristan und Isolde
- Frauen im 12. Jahrhundert
- Sexualität, Ehe, Ehebruch
- Heilige Minne
- Monastische Liebe zu Gott
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung der Liebe im Tristanroman Gottfrieds von Straßburg und setzt sie in Bezug zur gesellschaftlichen Auffassung von Liebe und Ehe um 1200. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen der literarischen Liebeskonzeption und den realen Gegebenheiten der Zeit und analysiert, wie die Minne im Kontext von Ehe, Ehebruch und gesellschaftlichen Normen funktioniert.
- Die Darstellung von Liebe im Tristanroman
- Die Bedeutung der Minne in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Das Verhältnis von Liebe, Ehe und Ehebruch
- Die Rolle der Frau im 12. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Minne im Kontext von Religion und Moral
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff "Minne" im mittelalterlichen Kontext dar und verdeutlicht die unterschiedliche Sichtweise auf Liebe im Tristanroman im Vergleich zur damaligen Gesellschaft.
Tristanstoff und Minnetrank beleuchtet den Einfluss des Mythos auf die Darstellung der Liebe im Roman.
Die Protagonisten Tristan und Isolde untersucht die Charaktere und ihre Beziehung im Kontext von Liebe und Ehe.
Frauen im 12. Jahrhundert erörtert die gesellschaftliche Rolle der Frau im Mittelalter und deren Einfluss auf die Liebeskonzeption.
Sexualität, Ehe, Ehebruch beleuchtet die Beziehung zwischen Sexualität, Liebe und Ehebruch in der mittelalterlichen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Minne, Tristan, Gottfried von Straßburg, Liebe, Ehe, Ehebruch, mittelalterliche Gesellschaft, Frauenrolle, Sexualität, Religion, Moral, Frankreich, 12. Jahrhundert.
- Citation du texte
- M.A. Elke Beilfuß (Auteur), 2000, Über die Minne im Tristan Gottfrieds von Straßburg und das Verständnis von Liebe und Ehe in der Gesellschaft um 1200, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2384