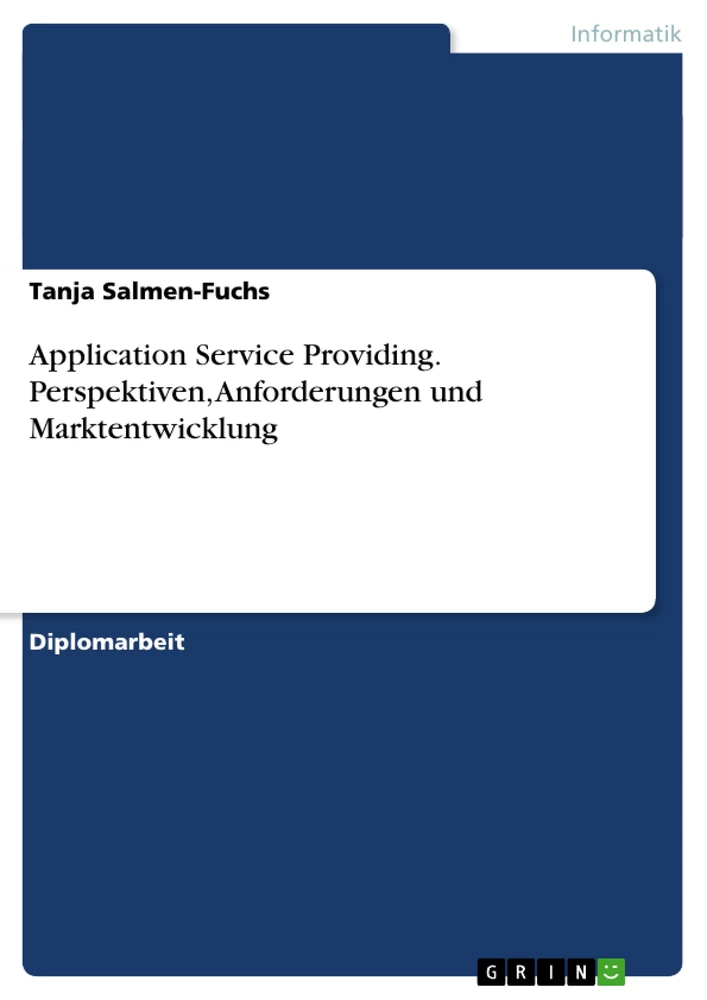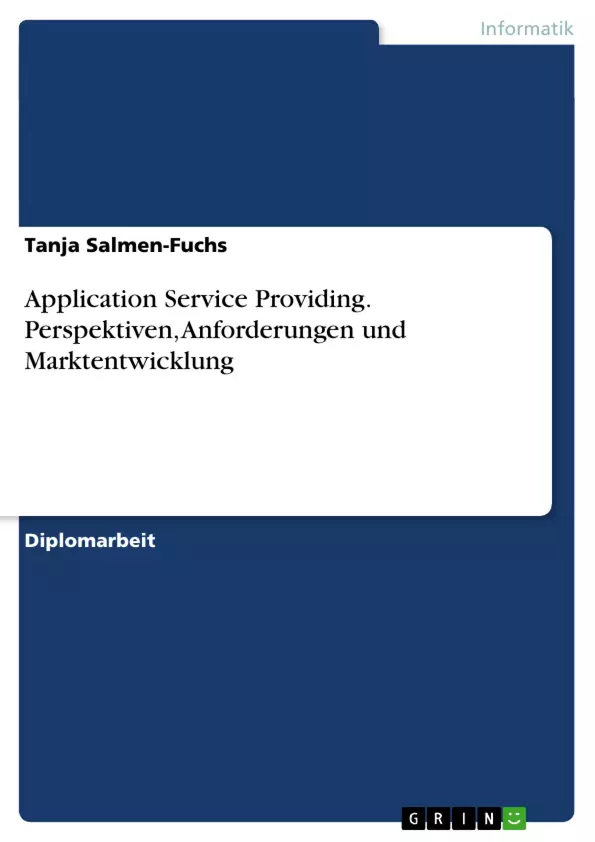Application Service Providing, also die neue Form der Nutzung von Software- Diensten per Datennetz, ist heute ein häufig diskutiertes Thema in der IT – Branche. Dieses vereinfacht unter dem Schlagwort „Software zur Miete“ behandeltes Outsourcingkonzept entwickelte sich in den letzten Jahren von einer Vision zu einem sinnvollen Geschäftsmodell in der Informationstechnologie.
Dieses Modell hat viel Aufmerksamkeit sowohl von den Marktforschern als auch von potenziellen Anbietern erhalten, weniger aber von potenziellen Anwendern. Application Service Providing wurde, entgegen den Prophezeiungen von Analysten, in Europa und im deutschsprachigen Raum eher verhalten aufgenommen und genutzt.
Es galt, die heutige Attraktivität und Profitabilität des ASP–Geschäftsfeldes festzustellen, und die Breite seiner Anwendung sowohl im nationalen und internationalen Umfeld als auch im E-Business zu erkunden. Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Plesnik, dem Geschäftsführer des Ingenieurbüro Dr. Plesnik GmbH in Aachen. Er bekundete Interesse an der Verbreitung des Application Service Providing in Russland. Deswegen beschäftigt sich die Autorin im lezten Kapitel mit diesem Thema.
Es ist anzumerken, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema ASP im Rahmen der akademischen Nachforschungen im Jahr 2004 folgte und hatte eher informativen Charakter. Sicherlich hat sich heute im Bereich dieses Outsoursingkonzepts Einiges getan. Die Beurteilung des Nutzens ist daher dem Leser überlassen.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- APPLICATION SERVICE PROVIDING
- Grundlagen
- Begriff und Definitionen
- Definition von ASP als Dienstleistungskonzept.
- Application Service Provider als Dienstleister.
- ASP als besondere Form des IT -Outsourcing...
- Outsourcing- Arten und ihre Abgrenzung zum ASP.
- ASP-Player.....
- ASP- Liefermodelle.
- ASP -Wertschöpfungskette...
- TECHNISCHE REALISIERUNG..
- ServerBasedASP versus ClientBased ASP.
- Trendentwicklung in der ASP- Infrastruktur.
- Sicherheit.
- Wirtschaftliche Sicht
- ASP-Geschäftsmodelle
- Preismodelle
- Praxisbeispiele Preismodelle
- Billing und Lizenzmanagement im Preismodell
- Kostenbetrachtung .
- Total Cost of Ownership - Analyse
- Augurenschätzungen zu Auwandsbewältigung durch ASP
- Return on Investment- Analyse.
- Juristische Perspektive......
- Allgemeine Vertragsbeziehungen und Vertragstypen.
- Service Level Agreements...
- Lizenzrechtliche Aspekte
- Haftung, Gewährleistung und Konfliktmanagement..
- ANFORDERUNGEN AN SOFTWARE IM ASP- MODELL
- Kategorien der Softwareapplikationen.
- ASP - Anwendungsmodelle.....
- MARKTENTWICKLUNG UND AKTUELLE MARKTSITUATION.....
- Prognosen zur Entwicklung des ASP- Marktes..
- ASP- Lebenszyklus...
- Sorgenkind ASP
- Porter's Analyse zur Messung der ASP- Marktattraktivität..
- Kunden und ihre Verhandlungsmacht: ASP- Zielgruppe.
- Bedrohung durch bzw. Substituten...
- Verhandlungsmacht der Zulieferer..\li>
- Neue Konkurrenten / Wettbewerbssituation im ASP- Markt ...
- E-PROCUREMENT IM ASP - MODELL..
- Definition von E- Procurement..
- Warum E-Procurement?
- Wann ist die elektronische Beschaffung sinnvoll?..\li>
- ONVENTIS GmbH als Procurement Service Provider.
- Möglichkeiten für ASP basiertes E- Procurement..
- ASP- Procurement bei Vorwerk.
- ASP-EINSATZ AUF DEM RUSSISCHEN MARKT
- Internetnutzung in Osteuropa
- Russlands Markt für IT- und IT- Outsourcing..
- Marktsituation in Zahlen
- ASP in Russland
- ASP- Nachfrage und ASP - Angebot in Russland.
- AiTi AG: erfolgreicher Systemintegrator als ASP - Anbieter.....
- ERP-System „Boss-Company“ der Firma „AiTi“ im ASP- Modus
- Human-Ressource-Modul \"Boss Kadrowik\"im ASP- Modus ..
- Diskussion zur Preisbildung am russischen ASP- Markt..
- ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Application Service Providing (ASP) und untersucht dessen Bedeutung im Kontext von E-Procurement und seiner Anwendung auf dem russischen Markt. Die Arbeit analysiert die Attraktivität und Profitabilität des ASP-Geschäftsfeldes und beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der ASP-Technologie, von der technischen Realisierung über die wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen bis hin zu den Anforderungen an Software im ASP-Modell. Darüber hinaus werden die Entwicklung und aktuelle Situation des ASP-Marktes in Europa und Russland beleuchtet, wobei ein Schwerpunkt auf der Integration von E-Procurement-Lösungen im ASP-Modell liegt.
- Die Entwicklung und Anwendung von ASP-Diensten in der IT-Branche
- Die Integration von ASP-Lösungen im Bereich E-Procurement
- Die technischen und wirtschaftlichen Aspekte von ASP-Diensten
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen von ASP-Verträgen
- Die aktuelle Marktlage und das Potenzial von ASP-Diensten im russischen Markt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema ASP und dessen Bedeutung im Kontext von E-Procurement einführt. Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen von ASP, wobei Begriffe und Definitionen geklärt werden und die verschiedenen Formen des IT-Outsourcing vorgestellt werden. In Kapitel 3 werden die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte von ASP-Diensten näher betrachtet. Dabei werden verschiedene ASP-Liefermodelle, Geschäftsmodelle und Preismodelle sowie die Kostenbetrachtung und rechtlichen Rahmenbedingungen diskutiert. Kapitel 4 befasst sich mit den Anforderungen an Software im ASP-Modell und kategorisiert verschiedene Softwareapplikationen. In Kapitel 5 wird die Entwicklung und aktuelle Situation des ASP-Marktes beleuchtet. Dabei werden Prognosen zur Entwicklung des ASP-Marktes, die Marktattraktivität von ASP und die Herausforderungen des ASP-Marktes analysiert. Kapitel 6 behandelt das Thema E-Procurement im ASP-Modell und zeigt die Vorteile und Möglichkeiten von ASP-basierten E-Procurement-Lösungen auf. Kapitel 7 konzentriert sich auf die Anwendung von ASP-Diensten auf dem russischen Markt, wobei die Internetnutzung in Osteuropa, die Situation des IT- und IT-Outsourcing-Marktes in Russland sowie die aktuelle ASP-Nachfrage und das ASP-Angebot in Russland beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Application Service Providing (ASP), E-Procurement, IT-Outsourcing, Software as a Service (SaaS), Cloud Computing, Geschäftsmodelle, Preismodelle, Kostenbetrachtung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Marktentwicklung, Russland, AiTi AG, Boss-Company, Boss Kadrowik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Application Service Providing (ASP)?
ASP ist ein Outsourcing-Konzept, bei dem Software-Dienste über ein Datennetz (Internet) gemietet werden, anstatt sie lokal zu installieren. Es ist ein Vorläufer des heutigen Cloud Computing.
Wie unterscheidet sich ASP von klassischem IT-Outsourcing?
Während klassisches Outsourcing oft ganze IT-Abteilungen umfasst, fokussiert sich ASP spezifisch auf die Bereitstellung und Wartung einzelner Softwareapplikationen als Dienstleistung.
Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet ASP?
Zu den Vorteilen zählen eine Senkung der Total Cost of Ownership (TCO), planbare Mietkosten statt hoher Investitionen und ein schnellerer Return on Investment (ROI).
Welche Rolle spielt ASP im russischen Markt?
Die Arbeit analysiert die Verbreitung von ASP in Russland und stellt Fallbeispiele wie die Firma AiTi AG vor, die ERP-Systeme im ASP-Modus anbietet.
Was sind Service Level Agreements (SLA)?
SLAs sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Anbieter und Kunde, die die Qualität, Verfügbarkeit und den Umfang der ASP-Dienstleistung genau festlegen.
Was ist E-Procurement im ASP-Modell?
Es bezeichnet die Nutzung von elektronischen Beschaffungssystemen, die über einen ASP-Dienstleister bereitgestellt werden, um Einkaufsprozesse in Unternehmen effizienter zu gestalten.
- Citar trabajo
- Diplom-Kauffrau (FH) Tanja Salmen-Fuchs (Autor), 2004, Application Service Providing. Perspektiven, Anforderungen und Marktentwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23854